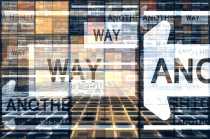Missing Link: KI - die Künstlichen Idioten des digitalen Kapitalismus

(Bild: whiteMocca / shutterstock.com)
Der digitale Kapitalismus hat einen neuen Gesellschaftsvertrag etabliert: Daten gegen Bequemlichkeit. KI spielt für dessen Zukunft eine zentrale Rolle.
1947 wurde die Central Intelligence Agency, der Auslandsgeheimdienst der USA, gegründet, die mit "Zentrale Intelligenz-Agentur" denkbar schlecht übersetzt wäre – deren vorrangige Aufgabe ist schließlich die (nachrichtendienstliche) Informationsbeschaffung und nicht etwa das Versammeln von Intelligenz. Bei Artificial Intelligence ist aber genau das passiert, die immer mitgemeinte Bedeutung von Intelligence als Informationserzeugung ging bei der Übersetzung ins Deutsche verloren. Übrig bleibt nur der Aspekt der KI, bei dem es um den Bau intelligenter bzw. mit menschlichen Denkfähigkeiten konkurrierender Maschinen geht.
Dies vorangestellt: Nun soll es um eben diesem vernachlässigten Aspekt von KI gehen, der zudem der Realität derzeitiger Anwendung von KI-Technologien viel eher entspricht als die von Hollywood dominierten Vorstellungen allgemeiner Künstlicher Intelligenz. Denn wenn heute von KI die Rede ist, dann eben meist von informationsverarbeitenden Maschinen, die ganz bestimmte Aufgaben lösen können. Widmen wir uns also diesen KIs, beschränkten künstlichen Informationsverbeitern, deren Akronym mit "Künstlichen Idioten" vielleicht treffender aufgelöst wäre.
Eine Renaissance
Aus zwei Gründen haben wir es derzeit mit einer Renaissance der Disziplin zu tun: Zum einen sind Methoden maschinellen Lernens dank günstiger und leistungsfähiger Computer-Hardware und der Reifung bestimmter Methoden an die Schwelle massenmarktfähiger Anwendungen gelangt. Der chinesisch-amerikanische Investor und KI-Spezialist Kai Fu Lee sieht KI-Technologien an der Schwelle zum Massenmarkt, profitable Geschäftsmodelle seien in Reichweite und der breiten Anwendung stehe auch technisch nichts mehr im Wege. Er spricht daher vom "Zeitalter der Implementierung". KI-basierte Produkte erreichen Produktreife und erobern den Massenmarkt, wie etwa persönlichen Assistenten, Chatbots oder Software für das autonome Fahren.
Hinzu kommt das Vorhandensein immenser Datenmengen in vielen Anwendungsbereichen, die meist automatisch und kostenlos anfallen, und die als Trainingsdaten für maschinelles Lernen bereitstehen. Die Menge an Trainingsdaten ist dabei entscheidend für die Qualität der damit gefütterten KI-Anwendungen. Infolgedessen habe heute derjenige, der die meisten Daten in einem bestimmten Anwendungsfeld verfügt, die besten Chancen, gute KI-gestützte Anwendungen bereitstellen zu können. Im Gegensatz zu vorangegangenen Phasen in der Disziplin, in der es eher um wissenschaftliche Fortschritte ging, sind wir in das "Zeitalter der Daten" (Kai-Fu Lee) eingetreten.
Daten-Ozeane
Technologien maschinellen Lernens sind geradezu ideal geeignet, in Daten-Ozeanen Strukturen zu erkennen, Modelle zu entwickeln und daraus wiederum Vorhersagen zu generieren. Daraus resultieren kapitalistisch verwertbare Anwendungsfelder, mit denen viel Geld verdient werden kann - so jedenfalls die Hoffnung der Großen der Branche. Die Analyse dieser Rohdaten, die Generierung verwertbarer Information aus ihnen wird zum Kernprozess in der Maschinenhalle des digitalen Kapitalismus, bei dem zunehmend in allen Branchen KI-gestützte selbstlernende Algorithmen eingesetzt werden.

(Bild: PHOTOCREO Michal Bednarek / shutterstock.com)
Bereits im September 2016 gründeten wichtige digitale Unternehmen eine Allianz, um ihre Forschungsprojekte im Bereich Künstliche Intelligenz zu bündeln. Bei der "Partnership on Artificial Intelligence [4]" sind neben der Google-Holding Alphabet (über die Tochterfirma DeepMind) noch Amazon, Facebook, IBM und Microsoft mit von der Partie. Die Großen der KI sind also dieselben Unternehmen, die auch die digitale Plattformökonomie beherrschen. Neben den genannten sind noch Apple, Tesla oder der Chip-Hersteller Nvidia zu erwähnen - nicht zu vergessen: ihre chinesischen Pendants Alibaba, Tencent und Baidu.
Daten-Kapitalismus
War der industrielle Kapitalismus gekennzeichnet durch die Extraktion von Rohstoffen und die Ausbeutung lebendiger Arbeit mit dem Ziel, massenhaft Produkte für den Verkauf am Markt herzustellen, verschiebt sich dieser Fokus nunmehr. Die Extraktion von Daten und die Ausbeutung neuer Arbeitsformen, in erster Linie der User selbst, sind ins Zentrum der ökonomischen Aktivität geraten. Die führenden Digitalkonzerne - Amazon, Alphabet, Apple, Facebook und Microsoft - sind zu den mächtigsten Unternehmen der Welt geworden. Sie haben nicht nur wirtschaftliche, sondern auch beispiellose politische und gesellschaftliche Macht errungen.
Wo man hinschaut, ist von Daten die Rede: Beim autonomen Fahren, auf dem Marketing-Kongress, in der Landwirtschaft, der Logistik, dem Gesundheitswesen, in der Industrie. Auch der US-amerikanische Einzelhandelsriese Walmart hat die Bedeutung von Daten entdeckt und ging jüngst eine Allianz mit Google ein [5], um seinem größten Widersacher Amazon Paroli bieten zu können. Wo man hinschaut, ist von Daten die Rede, deren Analyse zum zentralen Geschäft des Digitalen Kapitalismus erklärt wird. Das ist auch kein Zufall, denn bei der heutigen KI, die darauf abzielt, mit vielen Daten Algorithmen zu trainieren, steht die Menge und Qualität der Trainingsdaten im Vordergrund. Wer also über viele Daten verfügt, erlangt einen strategischen Vorteil.
Zentrale Elemente künftiger Geschäfte
Als Google 2014 die britische Firma DeepMind kaufte, war diese kaum bekannt. Heute hingegen ist klar, dass DeepMinds KI-Technologien für den Mutterkonzern zentral geworden sind: Datenanalyse mit Hilfe von KI-Technologien, Deep-Learning-Verfahren für die Verbesserung von Nutzerschnittstellen, verschiedene Techniken für die Steuerung von Robotern, die Entwicklung von Software für das autonome Fahren - in all diesen Bereichen sind DeepMinds Ergebnisse für den Mutterkonzern von großer Bedeutung.
DeepMinds Know-how ist in den Kern seiner Verwertungsmaschinerie vorgedrungen nach dem Schema: Viele Daten + KI-Algorithmen = profitable Geschäftsmodelle. DeepMind könnte so zur "Algorithmen-Fabrik" für Alphabet werden, mutmaßt The Economist. DeepMinds KI-Know-how kombiniert mit den größten Datensammlungen der Welt, über die Google verfügt, machen deren Allianz überaus schlagkräftig.
Die Großen der Plattformökonomie zu beiden Seiten des Pazifiks arbeiten an KI-getriebenen Softwareanwendungen, die dabei sind, die Schwelle zum Massenprodukt zu überschreiten. Hier zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab wie zu Zeiten der PC-Revolution, als der Computer personal wurde, sprich zum Produkt für jedermann. KI-basierte Produkte wie persönliche Assistenten, Chatbots oder Software für das autonome Fahren erreichen Produktreife und stehen kurz davor, den Massenmarkt zu erobern. An der Hand der Digitalkonzerne, aber auch im Zuge von Industrie 4.0 werden KI-Technologien marktfähig und alltagstauglich und werden in vielen Bereichen auf breiter Basis implementiert.
KI wird so zur Schlüsseltechnologie des Digitalen Kapitalismus, um seine auf Daten und deren Verwertung zentrierten Geschäftsmodelle zu konsolidieren.
Algorithmen-Fabrik
In China zeichnet sich eine ähnliche Entwicklung ab. "Made in China 2025" heißt der strategische Plan Chinas, den Premierminister Li Keqiang und sein Kabinett im Mai 2015 beschlossen, der im Kern die Schaffung einer moderne Netzwerkökonomie umfasst. KI soll dabei eine zentrale Rolle spielen: Bis 2030 will China weltweit führend sein, und sie haben gute Chancen, das auch zu schaffen.
Aus zwei Gründen hat China Vorteile im ökonomischen Wettstreit rund um KI-Technologien. Zum einen kann China mit seinem Staatskapitalismus 3.0 aufwarten, der als kennzeichnend für große Schwellenländer identifiziert wurde, geht aber in der Intensität der strategischen Planung und seiner Verquickung mit autoritärer Überwachungspolitik noch darüber hinaus. Der zweite Grund ist der Vorsprung bei den Daten: Es gibt einfach sehr viele Chinesinnen und Chinesen, viele von ihnen sind Digital Natives, digitale Applikationen begleiten sie auf Schritt und Tritt - ideale Voraussetzungen für datenextraktive Geschäftsmodelle.
Diener ihrer Herren
KI-getriebene Produkte wie etwa Smart-Home-Geräte oder künstliche Sprachassistenten erobern den Massenmarkt und stellen gleichzeitig den Beginn einer neuen Ära in der Geschichte der Nutzer-Schnittstellen dar: Sprach-Interfaces lösen die Maus bzw. den Touchscreen ab. Die Nutzerinnen und Nutzer der KI-getriebenen Assistenten nehmen dabei gleich mehrere Rollen ein: Einerseits sind sie Kunden von Geräten und Diensten, gleichzeitig sind sie aber auch Lieferanten von Feedback-Daten, die für die Optimierung und Weiterentwicklung eben der Dienste genutzt werden, die sie in Anspruch nehmen.
Ihre Käufer stellen einerseits eine Ressource dar, insofern sie beständig neue Sprachkommandos hervorbringen, die als Trainingsdaten zur Optimierung des Systems eingesetzt werden. Gleichzeitig leisten sie kostenlose Arbeit, indem sie unbezahlt Feedback liefern über das Funktionieren der KI. Sie sind Kunde, aber auch Produkt, ihre Profile, ihr Verhalten, sowohl vergangenes, gespeichertes, als auch zukünftiges, vorherzusagendes, können an Dritte veräußert werden.
Digitale Dienste, die durch KI-Feedback auf sich selbst rückgekoppelt sind, verschleißen nicht nur nicht im Laufe der Zeit, sie werden kontinuierlich besser. Auf der Internationalen Funk-Ausstellung 2018 in Berlin schwärmte Jo Seong-jin, der Vorstandschef des Unterhaltungselektronik-Riesen LG, von unter dem Schlagwort "Evolve" präsentierten KI-Technologien, eine "sich durch fortgesetzte, akkumulierte User-Interaktion weiter entwickelnden Maschine."
Das evolutionäre Produkt
Diese ermöglichten Seong-jin zufolge neue Produkte, die niemals schlechter, sondern sogar on the fly besser würden. Im Zug ihrer Benutzung verändern sie sich, lernen dazu, bekommen neue Features, werden gar zu einem ganz neuen Produkt. Für den Hersteller eines Sofas oder einer Schallplatte, der auf natürliche oder absichtlich herbeigeführte Obsoleszenz setzt, mag das verrückt klingen.
Maschinen können nicht denken, aber sie können Prognosen treffen, und das ist für das Kapital interessant. Auch die drei kanadischen Autoren des gerade erschienenen Buches "Prediction Machines" betonen, die derzeitige Welle an KI-Anwendungen keine Intelligenz bringt, sondern eine entscheidende Komponente derselben: Vorhersagefähigkeit.

(Bild: Adrian Grosu / shutterstock.com)
Sie sprechen davon, dass die "Stückkosten" pro maschinelle Vorhersage stetig fallen, und verbinden dies mit der Output-Rate von KI-Anwendungen, die an Moores Gesetz erinnert, also der empirischen Feststellung, dass sich die Leistungsfähigkeit von Computern alle ein bis zwei Jahre verdoppelt. Jack Ma, Gründer von Alibaba, meint sogar, KI würde dazu führen, dass das (chinesische) Kapital Marktunsicherheiten generell überwinden könne und schlussendlich erlauben würde, "die Planwirtschaft zu verwirklichen".
Der daten-industrielle Komplex
Die umfangreichsten Ressourcen, die meiste Rechenkapazität, die besten Leute, die klügsten Wissenschaftler, die avanciertesten neuronalen Netze, die umfangreichsten Datenbanken, kurz, das Beste, was die Menschheit an Wissen hervorgebracht hat, dient - abgesehen von Marketing-Gags wie Go-Spielen und Feigenblättern wie besserer Krebsvorsorge - in erster Linie dazu, herauszufinden, was wir als nächstes kaufen werden.
Technologien um Künstliche Intelligenz stellen für diese Firmen den Kern der algorithmischen Datenauswertung dar, sie werden zur zentralen Verwertungsmaschine des digitalen Kapitalismus. KI ist eine Technologie, um Big Data auszuwerten, kostenlose User-Arbeit effizienter zu verwerten und die digitale Workforce zu überwachen, ganz wie das Fließband einerseits Rationalisierung, andererseits Machtinstrument in der Fabrik war.
Der datenextraktive Kapitalismus der Plattformen versucht sich mit ihrer Hilfe zu konsolidieren und gleichzeitig Fuß zu fassen in fremden Branchen und seine KI-Technologien zum unverzichtbaren Standard zu machen. Ob es um die plattformkapitalistische Verwertungsmaschinerie, die Überwachung von digitaler Arbeit, von Kunden und Nutzerinnen geht oder um die Zukunft bzw. Prekarisierung der Arbeit: In allen drei zentralen Fragen im Rahmen des digitalen Kapitalismus spielen KI-Technologien eine wichtige Rolle.
Ein neuer Gesellschaftsvertrag
Der Digitale Kapitalismus hat einen neuen Gesellschaftsvertrag etabliert: Daten gegen Bequemlichkeit. Kostenlose private Dienste treten an die Stelle öffentlicher Dienste und werden zunehmend Bestandteil der Daseinsvorsorge. Technologien rund um Cloud Computing und Künstliche Intelligenz dienen zur Konsolidierung dieses New Deal.
In China entsteht derweil eine staatsmonopolistische, panoptische Variante des Überwachungs- und Vorhersage-Kapitalismus, die mit dem Silicon-Valley-Modell in Konkurrenz tritt.
Es ist abzusehen, dass Wissen und Fähigkeiten rund um KI, Big-Data-Analysen und maschinelles Lernen ebenfalls zum Alltag, zum nächsten kapitalistischen big thing werden - technologisches Heilsversprechen, soziale Verheißung und finanzieller Hoffnungsträger zugleich. Eine Debatte um Alternativen, jenseits der Verwertungslogik, jenseits verschiedenster Formen der fremdbestimmten Arbeit und jenseits von die persönliche Freiheit bedrohenden Entwicklungen steht auf der Tagesordnung.
- Kai-Fu Lee, AI superpowers: China, Silicon Valley, and the new world order. Houghton Mifflin Harcourt, Boston 2018
- "Google's hippocampus", in: The Economist, 15.12.2016
- Ajay Agrawal, Joshua Gans, Avi Goldfarb, Prediction Machines.The Simple Economics of Artificial Intelligence. Harvard Business Review Press, Boston, Massachusetts 2018
- Timo Daum, Die Künstliche Intelligenz des Kapitals [6]. Hamburg: Edition Nautilus GmbH, 2019
- Jo Seong-jin, "›Think Wise, Be Free: Living Freer with AI‹", IFA Keynote, 31.8.2018
(jk [7])
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-4324653
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/thema/Missing-Link
[2] https://edition-nautilus.de/programm/die-kuenstliche-intelligenz-des-kapitals/
[3] https://edition-nautilus.de/programm/das-kapital-sind-wir/
[4] https://www.partnershiponai.org/
[5] https://www.technologyreview.com/the-download/608723/walmart-and-google-are-taking-on-amazon-with-ai/
[6] https://edition-nautilus.de/programm/die-kuenstliche-intelligenz-des-kapitals/
[7] mailto:jk@heise.de
Copyright © 2019 Heise Medien