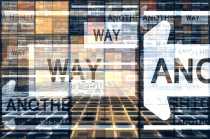Missing Link: Technologie-Rekuperation, oder: Wie subversive Technologien absorbiert werden

Die Freiheit führt das Volk, 28. Juli 1830
"Geschichten aus der Rekuperation": Wie der Kapitalismus subversive Technologien schluckt. Beispiel: GitHub ein Jahr nach der Übernahme durch Microsoft
Anfang Juni 2018 gab Microsoft den Ankauf der Code-Plattform GitHub bekannt. Anders ausgedrückt: Das größte Code-Repository der Welt, eine Art Basislager für alle diejenigen, die mit Software etwas anderes vorhaben als schlicht Profit machen, wird ausgerechnet von dem Konzern übernommen, der wie kein anderer für das Milliardengeschäft mit proprietären Software-Lizenzen steht.
Immer wieder kommt es vor, dass neue Techniken, Erfindungen oder Konzepte Hoffnungen wecken, sie würden wahlweise die Macht von großen Konzernen einschränken, zu mehr Demokratie und Gerechtigkeit führen, kurz: aus der Welt einen besseren Ort machen. Zur Jahrtausendwende bekundete der damalige US-Präsident Bill Clinton solcherart technologische Zuversicht: "Im neuen Jahrhundert wird sich die Freiheit durch Mobiltelefon und Kabelmodem verbreiten." Das Internet, Open-Source-Software, Peer-to-Peer-Anwendungen – Die Liste an technologischen Hoffnungsträgern, von denen ihre Zeitgenossen wundersame Wirkungen erwarteten, ist lang.
Vermittler und Plattformen
Gerne wird auf das Motiv des Ausschlusses von Vermittlern zurückgegriffen, deren Beseitigung wundersame Wirkungen zugeschrieben wird. So behauptete etwa der kanadische Management-Guru Son Tapscott 1996: "Die Mittlerfunktionen zwischen Produzenten und Konsumenten werden durch digitale Netzwerke ausgeschaltet." Tatsächlich haben wie seitdem eher das Gegenteil erlebt: Auf den netzneutralen Protokollen des Internets aufbauend sind neue Gatekeeper entstanden, die mächtigen und zu Monopolen gewordenen Plattformen der Digitalkonzerne.
Tapscott zeigt sich von solchen Entwicklungen gänzlich unbeeindruckt und hat schon die nächste Technologie ausgemacht, mit der es diesmal klappen soll mit der Weltverbesserung: "Die Blockchain Revolution. Wie die Technologie hinter Bitcoin nicht nur das Finanzsystem, sondern die ganze Welt verändert", heißt sein neues Buch. Meiner Skepsis, ob es mit dieser Technologie klappen wird, habe ich bereits in einem "Missing Link" Ausdruck gegeben [4].
Eins wird jedenfalls deutlich: Der Kapitalismus hat es noch jedes Mal geschafft, neue Technologien mitsamt ihrer Potenziale und Dynamiken zu integrieren. Ein besonders schönes Beispiel für eine beeindruckende feindliche Übernahme einer revolutionären, widerständigen Technologie durch einen kapitalistischen Player jährt sich derzeit zum ersten Mal und ist deshalb wert, einmal aus dieser Perspektive gewürdigt zu werden.
Hassobjekte
Der Software-Riese aus Redmond galt lange Zeit als das Hassobjekt Nummer eins der Software-Szene. Hatte doch Bill Gates als Fünfundzwanzigjähriger IBM mit einem Software-Deal über den Tisch gezogen und damit nicht nur das Software-Imperium Microsoft begründet, sondern auch die Ära lizenzierter Software eingeläutet. Beim berühmten IBM-Deal im Jahr 1980 gelingt dem jungen Bill Gates ein kluger Schachzug, der sich als größte und gewinnbringendste Geschäftsidee der zweiten Hälfte des vorigen Jahrhunderts erweisen sollte. Er kaufte das Betriebssystem QDOS vom Programmierer Tim Paterson für 50.000 Dollar, inklusive Quellcode und sämtlicher Nutzungsrechte. Ein guter Geschäftsmann oder eine gute Geschäftsfrau hätte daraufhin wahrscheinlich versucht, das leicht veränderte Programm für einen deutlich höheren Preis an IBM weiterzuverkaufen.
Nicht jedoch Bill Gates. Er war im Gegensatz zum IBM-Management davon überzeugt, dem PC stünde eine goldene Zukunft und der Durchbruch im Massenmarkt für die gerade entstehenden Personal Computer bevor. Er bot ihnen ein Lizenzmodell an: Microsoft erteilte IBM einfache Nutzungsrechte und erhielt pro verkauftem IBM-PC eine Lizenzgebühr – und obendrein kostenlose Werbung, war doch der mit dem Microsoft-Logo versehene Bootscreen ab sofort und jeden Tag aufs Neue das erste, was PC-Benutzer zu sehen bekamen. Zusätzlich konnte Gates allen anderen PC-Herstellern, also IBMs Konkurrenten, den gleichen Deal anbieten, dem diese ebenso bereitwillig zustimmten.
Der Rest ist Geschichte: Die PC-Revolution brach aus, IBM verkaufte Millionen der neuen Geräte und die Konkurrenz ebenso. Sie lieferten sich dabei einen Preiskrieg der als clone war in die Geschichte eingegangen ist, einzig Microsoft profitierte von den Erfolgen beider Seiten. Microsoft [5] erlangte eine Monopolstellung im Bereich PC-Betriebssysteme und Büroanwendungssoftware, die bis heute anhält, und Bill Gates wurde zum reichsten Mann der Welt. Die Firma ist wegen dieser Rolle als Erfinder und maximaler Profiteur von Software-Lizenzierung seitdem beliebtestes Hassobjekt der Gegenbewegung.
Kollektive und Offenheit
Die kollektive Entwicklung von Software, deren Quellcode offen für alle zugänglich ist, die lizenzfrei vertrieben, verändert und zweckentfremdet werden kann, ist das Credo der Gegenseite. Der Linux-Begründer Linus Torvalds initiierte im Jahr 2005 ein Projekt, dessen Ziel ein frei verfügbares Tool für Software-Entwicklung war, das Versionierung ermöglichte, also die Möglichkeit, Entwicklungsstufen zu dokumentieren. Das Projekt bekam den Namen Git und sollte die Verwaltung von Code-Versionen erleichtern und die Koordinierung und Synchronisierung vieler parallel am gleichen Quellcode Arbeitenden ermöglichen.
Vorläufer gab es schon lange, bereits 1972 wurde SCCS erfunden, das erstmals die Möglichkeit bot, ein automatisches Protokoll des Entwicklungsprozesses zu erzeugen. Mit SCCS konnten auch bereits mehrere Personen am gleichen Code arbeiten, wenn auch nicht simultan. Parallele Veränderungen ("branches") waren mögliche, deren Zusammenführung ("merge") und das nachfolgende Einspeisen bzw. Konsolidieren ("commit") musste allerdings immer noch einzeln und von Hand geschehen.
Neu bei Git ist zudem die Dezentralität, es ist als distribuierter Service konzipiert, und erinnert darin etwa an das Design der Blockchain. Es gibt also keinen zentralen Server, alle Beteiligten haben lokal die komplette Version eines Projekts zur Verfügung.
Git stellt sicherlich eine der wichtigsten Innovationen im Bereich Software-Entwicklung dar, seit Margaret Hamilton aus dem Programmieren eine Ingenieurswissenschaft machte. Torvalds Projekt setzte sich – wie so oft bei konkurrierenden Technologien, nicht unbedingt nur auf Grund von sachlichen Kriterien, weltweit gegen die Konkurrenz (etwa von SVN) durch. Gutes Marketing und ein berühmter Name trugen wohl ihren Teil zum bei.
Das soziale Medium einer erlesenen Gemeinschaft
Doch das Versionsverwaltungssystem muss irgendwo "laufen", die Daten irgendwo gehostet werden. Die "Lagerhallen" für Git-Code stellte ab 2008 das kleine Startup GitHub zur Verfügung, die das Hosting der Git-Repositorien anbot, ohne Werbung und gegen geringe Gebühren. Es wurde durch immer neue Funktionen sowie kostenloses Hosting von öffentlichen Projekten schnell zum Anbieter der Wahl für die Entwicklerszene und, wie c't-Redakteur Jan Mahn betont [6], zu einem "sozialen Netzwerk für Entwickler".
Chinesische Aktivisten haben kürzlich unter dem Namen 996.ICU ein Repository auf GitHub eingerichtet, das sich zu einem der erfolgreichsten aller Zeiten entwickelt hat. Die Aktion ist Teil der wachsenden Anti-996-Bewegung in China, die sich auf einen in der dortigen Tech-Industrie verbreitetes Arbeitspensum bezieht – von neun bis neun, sechs Tage die Woche (996) – mit programmiertem Ende auf der Intensivstation (Intensive Care Unit).
Aus dem Netz auf die Intensivstation
In wenigen Monaten hat das Projekt mehr Sterne, die wie Facebook-Likes auf der Plattform funktionieren, als das Open-Source-Framework für künstliche Intelligenz von Google TensorFlow. Im April dann veröffentlichten Katt Gu und Suji Yan die "Anti-996-Lizenz", um die Arbeitsbedingungen für Programmierer zu verbessern. Die Lizenz schreibt Unternehmen vor, die Software des Projekts zu verwenden, um die lokalen Arbeitsgesetze sowie die Standards der Internationalen Arbeitsorganisation zu erfüllen. GitHub ist gut gewählt, fällt es doch chinesischen Zensurbehörden schwer, den für die chinesische IT wichtige Plattform einfach abzuschalten.
In der Schatzkammer der Entwickler-Community befinden sich derzeit 57 Millionen Programmcode-Repositorien, davon sind über die Hälfte öffentlich zugänglich. Über 28 Millionen Benutzer "sprechen" 337 verschiedene Programmiersprachen, "fork it on GitHub" (etwa: mach eine Verzweigung auf GitHub!) ist zum geflügelten Wort für Code-Entwicklung geworden. Allein 2,3 Millionen davon sind JavaScript-Projekte, der häufigsten Sprache auf der Plattform.
Überraschung! Überraschung!
Am 4. Juni 2018 verkündete Microsoft die Übernahme von GitHub. Die Branche war fassungslos, konnten doch die beiden Beteiligten scheinbar gegensätzlicher nicht sein: Als würde sich Volkswagen die Deutsche Umwelthilfe oder RWE das Hambi-Camp 2.0 einverleiben! Boykottaufrufe ließen denn auch nicht lange auf sich warten.
Doch was steckte dahinter? CEO Satya Nadella sagte, dieser Deal würde "das Engagement von [Microsoft] für Entwicklerfreiheit, Offenheit und Innovation stärken". Im Januar 2019 senkte Microsoft sogar die Preise, auch private, d.h. nicht öffentlich einsehbare Repositorien, die vorher 7 US-Dollar pro Monat gekostet haben, wurden kostenlos. Es gibt nach wie vor Bezahlmodelle für Firmen, Teams etc. Trotzdem ein deutlicher Schritt, das Microsoft mit GitHub nicht fürs Hosting Geld verdienen will.
Open-Source-Washing
Microsoft will näher an die Millionen Coder, der Aspekt als soziales Medium einer erlesenen Gemeinschaft ist entscheidend, neben Image-Effekten, die man als "open-source-Washing" bezeichnen könnte. Experten zufolge ist Microsoft bestrebt, sich gegen Google und Apple zu behaupten, die mit dem App Store und dem Play Store hauptsächlich auf Mobilgeräten Armeen von Drittentwicklern angeheuert haben. Microsoft konzentriert sich auf die Erhöhung der Cloud-Präsenz und hat festgestellt, dass dies am besten durch Entwickler erreicht werden kann. Es ist eher ein Schritt für Microsoft, weg vom klassischen Software-Geschäft und hin zur Plattform-Ökonomie.
Und wie sieht das Geschäftsmodell aus? Auf der Heise-Bühne der Cebit 2018 boten GitHub-Manager Einblick: Die Millionen Coder und ihre Repositorien sind eine unerschöpfliche Quelle für Metadaten. Wer arbeitet mit welchen Tools an welchen Projekten in welchen Branchen? Solche und ähnliche Fragen kann GitHub mit einer weltweit konkurrenzlosen Datenbasis beantworten. Informationen, die aus diesen Daten extrahiert werden können, werden wohl künftig für GitHub essenziell: Plattformkapitalistische Daten-Monetarisierung in Reinkultur! Und im Ergebnis ist ein Lieblingsprojekt partizipatorischer Code-Entwicklung zu einem Big-Data-Pool eines Digitalkonzerns geworden.
Rekuperation
Immer wieder werden Dezentralität, Verschlüsselung, Anonymität, Privacy, Transparenz, Offenheit ins Feld geführt; für utopische, die technische Seite transzendierende Eigenschaften, Effekte und Potenziale werden angedichtet, dazu demokratisierende, anti-kapitalistische etc. Dem steht die Fähigkeit des Kapitalismus gegenüber, revolutionäre, ja einmal für unversöhnlich antagonistisch eingeschätzte Technik, Bewegungen, Gedanken nicht nur zu parieren, sondern diese sich einzuverleiben. Und sich dadurch zu verändern, zu mutieren, so dass das Gift nicht nur nicht vergiftet, sondern nach einer Weile zum Nahrungsmittel wird.
Auf die radikale Künstlergruppe der Situationisten, die unter anderem die Hackerbewegung beeinflussten, geht der Begriff Rekuperation zurück. Sie beschrieben bereits in den 1960er Jahren, wie widerständige Kunst vom Kapitalismus einverleibt und neutralisiert wird. Gleichzeitig verändert sich dieser in dem Prozess der "Wiedereinverleibung" und geht gestärkt aus der Krise hervor, die die Intervention zunächst provoziert hat. Das Prinzip der "Wiedereinverleibung" wird seither auch in anderen Bereichen verwendet, nämlich immer dann, wenn zunächst widerständige und oppositionelles Verhalten, Ansichten oder auch Techniken sukzessive einverleibt, verdaut und neutralisiert werden.
Enttäuschungen
Die Liste der diesbezüglichen Enttäuschungen ist ebenso lang. Um den 3D-Druck ist es in letzter Zeit schon stiller geworden, dem noch vor ein paar Jahren das Potenzial zugetraut wurde, die Hegemonie der Industrie zu brechen. Auch die Strahlkraft von Blockchain und Kryptowährungen hat erheblich nachgelassen, derzeit im Hype-Cycle noch eher oben: Künstliche Intelligenz.
Dabei können wir vom Cyber-Theoretiker Stafford Bear eins lernen: "Der Zweck eines Systems ist, was es tut." Egal, was für Potenziale und Fähigkeiten dystopischer oder utopischer Art von ihren Schöpfern oder Anwendern vermutet, welche Hoffnungen oder Befürchtungen in sie gelegt werden – geschenkt! Entscheidend ist, was hinten raus kommt (Helmut Kohl). Gesellschaftliche Veränderungen können nun einmal nicht außerhalb des Gesellschaftlichen erzielt werden; der Kapitalismus hat sich bisher immer als flexibel genug erwiesen, um mit jeder dieser Technologien nicht nur gut leben zu können, sondern auch eine Menge Geld damit zu verdienen.
- Tapscott, Die digitale Revolution. Verheißungen einer vernetzten Welt - die Folgen für Wirtschaft, Management und Gesellschaft, Original: The Digital Economy McGraw, HIll N.Y. 1996
- Stafford Beer, What is Cybernetics?, Kybernetes, Volume 31, Issue 2, 2002, S. 209-219.
- Greenfield, Adam. Radical technologies: the design of everyday life, London New York: Verso, 2018.
- Jan Mahn, Microsoft kauft GitHub. Der Windows-Hersteller erwirbt mehr als eine Code-Plattform [7], c't 14/2018, S. 40
- Varun Kumar, 20 Interesting Facts and Statistics About GitHub [8], RankRed, 14.8.2018,
- Roberto Ohrt (Hrsg.): Der Beginn einer Epoche. Texte der Situationisten, Edition Nautilus, Hamburg 1995, ISBN 3-89401-243-9.
- Hackernoon, How Git Changed The History of Software Version Control [9], Hackernoon, 15.7.2018
(jk [10])
URL dieses Artikels:
https://www.heise.de/-4446943
Links in diesem Artikel:
[1] https://www.heise.de/thema/Missing-Link
[2] https://edition-nautilus.de/programm/die-kuenstliche-intelligenz-des-kapitals/
[3] https://edition-nautilus.de/programm/das-kapital-sind-wir/
[4] https://www.heise.de/news/Missing-Link-Fuer-eine-bessere-Welt-dezentrale-Buchfuehrung-mit-der-Blockchain-4301825.html
[5] https://www.heise.de/thema/Microsoft
[6] https://www.heise.de/select/ct/2018/14/1530920470936017
[7] https://www.heise.de/select/ct/2018/14/1530920470936017
[8] https://www.rankred.com/facts-and-statistics-about-github/
[9] https://hackernoon.com/how-git-changed-the-history-of-software-version-control-5f2c0a0850df
[10] mailto:jk@heise.de
Copyright © 2019 Heise Medien