Von der Corona-App zum Smart Meter
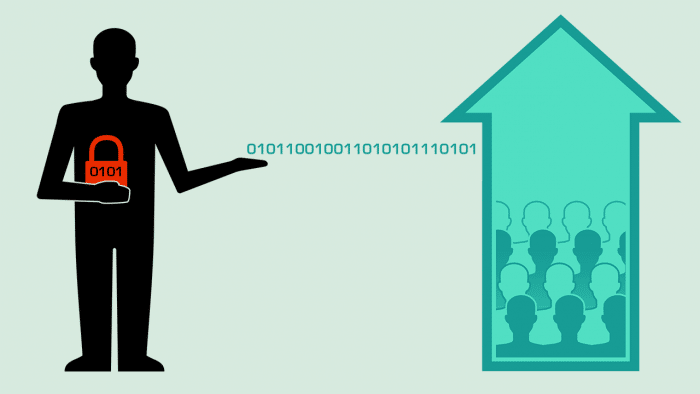
Wie schaffen wir Vertrauen in das Teilen von Daten?
Für die Bewältigung globaler Krisen braucht es vor allem eins: Daten. Je mehr Daten zu Gesundheit, Mobilität oder Klimaschutz ausgewertet werden können, umso wirkungsvoller die Gegenmaßnahmen. Wer seine Daten teilt, hilft so, gesellschaftliche Probleme zu lösen. Die andere Seite: die Sorge um die Privatsphäre - eine Herausforderung. Eine europäische Best-Practice-Studie des Wittenberg-Zentrums für Globale Ethik und der innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft zeigt am Fallbeispiel des Smart-Meter-Rollouts, welche Maßnahmen Vertrauen in das Teilen von Daten schaffen.
Beispiel Corona-Warn-App. Je mehr Bürger bereit sind, über die App ihre Kontaktdaten zu teilen, umso effektiver lassen sich Infektionsketten nachverfolgen, umso besser können wir die Pandemie eindämmen. "Daten teilen - besser heilen": Die Funktionsweise der App führt uns die gesellschaftliche Bedeutung des solidarischen Teilens von Daten vor Augen. Mit den Worten der offizellen Begleitkampagne: "Wird mit jedem Nutzer nützlicher".
Nützlichkeit versus Selbstbestimmung
Die begleitenden Debatten machten die ethischen Herausforderungen des Datenteilens sichtbar. Da ist erstens der Interessenkonflikt zwischen dem Teilen eigener Daten fürs Gemeinwohl und dem Wunsch nach informationeller Selbstbestimmung. Dieser Konflikt stand im Mittelpunkt der Debatte um die Corona-Warn-App. Die Lösung: Vertrauen. Vertrauen in einen fairen Ausgleich zwischen gesellschaftlichen Datenverwertungsinteressen und individueller Datensouverantität.
Doch für echtes Vertrauen reichen - zweitens - ritualisierte Vertrauensappelle nicht aus. Vielmehr stellt sich drittens die Frage: Welche Anstrengungen sind notwendig, um dieses Vertrauen zu schaffen? Was muss geschehen, damit ich jenen, denen ich meine Daten anvertraue, vertraue?
Eine Frage der Ethik: Fallbeispiel Energiewende
Mit diesem Konflikt setzt sich das Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik (WZGE) in Zusammenarbeit mit der innogy Stiftung für Energie und Gesellschaft bereits seit Längerem im Projekt "Ethische Herausforderungen der digitalen Energiewende" auseinander.
Im komplexen Energiesystem der Zukunft nehmen Daten eine Schlüsselrolle ein: Die Zahl erneuerbarer, dezentraler Energiequellen - allen voran: Windräder und Solaranlagen - wächst, eng gekoppelt mit den Sektoren Verkehr, Wärme und (energieintensive) Industrie. Um Stromangebot und Nachfrage effizient und sicher aufeinander abzustimmen, braucht es ein intelligentes Netz. Ein Netz also, das pausenlos Daten verarbeitet, zum Beispiel zum Wetter und Energieverbrauch. Für optimale Auslastung, optimale Versorgung, optimale Einsparung. Kurz: Eine rasche und klimagerechte Energiewende ist ohne Digitalisierung und das Teilen von Daten undenkbar.
Diese Daten liefern intelligente Messsysteme, sogenannte "Smart Meter", also intelligente Zähler. Als Schnittstelle zwischen Energieunternehmen und Energieverbrauchenden versprechen sie Mehrwert auf verschiedenen Ebenen: mehr Energietransparenz und mehr Teilhabe. Bürger beteiligen sich - im Sinne des "Green Deal" - aktiv an der Energiewende, indem sie ihren Stromverbrauch reduzieren oder - als "Prosumer" - selbst Strom ins Netz einspeisen. Für Unternehmen eröffnen sich innovative Geschäftsmodelle. Vor allem bieten Smart Meter auf gesellschaftlicher Ebene die Chance, die energiepolitischen Ziele der Energiewende voranzutreiben: Wirtschaftlichkeit, Versorgungssicherheit und Nachhaltigkeit.
Energieverbrauch: Privatsache?
Eine positive Vision - der jedoch in der Praxis ähnliche Herausforderungen entgegenstehen wie der Corona-Warn-App. Einerseits betrachten laut dem Sozialen Nachhaltigkeitsbarometer der Energiewende 2019 rund 80 Prozent der Befragten die Energiewende als Gemeinschaftsaufgabe, zu der jede:r einen Beitrag leisten sollte.
Für das gemeinsame Ziel sind laut einer Dena-Studie aus dem Jahr 2018 aber nur knapp die Hälfte der Befragten bereit, per Smart Meter Daten zu Energieverbräuchen zu übermitteln. 44 Prozent der Befragten akzeptieren diese Datenweitergabe nicht. Der Grund: Sorgen um ihre Privatsphäre. Es fehlt Vertrauen. Darum verläuft der Smart-Meter-Rollout hierzulande im Vergleich zu vielen europäischen Ländern eher schleppend - und verzögert so letztlich die Energiewende als Ganzes.
Soweit das Problem. Also haben das WZGE und die innogy Stiftung gefragt: Wie lässt sich Vertrauen in das Teilen von Energiedaten fördern? Dazu hat das Projektteam eine europäische Best-Practice-Studie durchgeführt und drei "Front Runner" des europäischen Smart-Meter-Rollouts - Niederlande, Schweden und Großbritannien - analysiert. Qualitative Interviews mit Experten aus Wirtschaft, Politik und Zivilgesellschaft sowie eine begleitende Diskursanalyse haben klare Ergebnisse erbracht: vier zentrale Gestaltungsansätze zur Vertrauensbildung in Smart Meter - und mithin das Teilen von Daten.
Daten teilen - Vertrauen schaffen. Aber wie?
Freiwillige Nutzung: Beispiel Niederlande. Hier hatte die Regierung zunächst vorgesehen, Smart Meter verpflichtend einzuführen. Datenschützer hatten rechtliche Bedenken, die Bevölkerung protestierte. 2008 ließ die Regierung ihre Pläne fallen. Und steuerte um: Eine Gesetzesänderung garantierte nun die freiwillige Nutzung von Smart Metern. Ein mehrstufiges Einwilligungssystem - dem Privacy-by-Design-Ansatz verpflichtet, also dem Prinzip, Datenschutz durch entsprechende Technik zu gewährleisten - sichert die Datensouveränität der Energieverbraucher. Im Ergebnis wurde so Vertrauen zurückgewonnen.
Schrittweise Einführung: Schweden führte 2009 flächendeckend eine erste Generation von Smart Metern ein, die zunächst nur über Basisfunktionen verfügten und eingeschränkt Energieverbrauchsdaten übermittelten. Der niedrigschwellige Einstieg und erste positive Erfahrungen bauten sukzessive Vertrauen bei den Verbraucheren auf. Eine gute Basis, um nun bei der Einführung einer zweiten Generation den Funktionsumfang und damit das Teilen von Daten auszuweiten. Ohne Vertrauensverlust.
Partizipation und Dialog: Das Beispiel Großbritannien zeigt, dass die frühe Einbeziehung von Stakeholdern in Dialogrunden hilft, Erwartungen und Sorgen zu klären und Misstrauen abzubauen. Die Verbraucher wurden gezielt befragt - und zwar im Vorfeld. So banal es klingt: So werden ihre Perspektiven in den Entwicklungsprozess einbezogen. Sie werden ernst genommen. Und mitgenommen.
Transparente Multi-Channel-Kommunikation: Noch einmal Großbritannien. Die "Smart Energy"-Kampagne adressiert sprachlich und visuell eingängig verbraucherrelevante Themen. Auch Kritisches: Dabei greift sie aktiv Bedenken zu Datenschutz und Datensicherheit auf. Zugleich betont die Kampagne den Mehrwert geteilter Energiedaten, sowohl aus individueller Sicht als auch aus Gesellschaftsperspektive. All das mit einem inklusiven Ansatz, der auf die Bedürfnisse vulnerabler Gruppen - etwa älterer Menschen - explizit eingeht.
Vertrauen braucht Zutrauen
Die Ergebnisse zeigen: Wer die Bereitschaft zum Datenteilen fördern will, darf nicht nur an das Vertrauen anderer appellieren, sondern muss selbst in vertrauensbildende Orientierungen investieren. Dazu zählt vor allem das Zugeständnis von Freiwilligkeit. Denn wer den Bürgern prinzipiell keinen verantwortlichen Gebrauch digitaler Technologien und Services zutraut und vorauseilend auf Zwangsmaßnahmen setzt, kann umgekehrt auch kein Vertrauen jener Bürger erwarten.
Mehr noch: Unter Zwang spielt Vertrauen keine Rolle mehr, denn die Möglichkeit des Vertrauensentzugs entfällt. Im Kontrast dazu zeigt sich: Partizipation und Dialog, transparente Kommunikation sowie eine schrittweise "behutsame" Einführung von digitalen Innovationen wie dem Smart Meter sind Vertrauensinvestitionen, die zum Game Changer werden können.
Im Ansatz funktioniert dies auch bei der Corona-Warn-App: Auch hier haben Freiwilligkeit, Privacy-by-Design, ein partizipativer Entwickungs- und Entscheidungsprozess sowie ein niedrigschwelliger Funktionsansatz, der auf dezentrale, lokale Auswertung der Kontaktdaten setzt, zum Durchbruch geführt. Die Vertrauensinvestionen haben sich ausgezahlt - wie die mehr als 18 Millionen Downloads deutlich machen. Mit Blick darauf ziehen die Entwickler der App, SAP und Deutsche Telekom, nach den ersten 100 Tagen auch ein positives Fazit und sprechen von einem "Vertrauensbeweis der Bevölkerung".
Keine Frage: Was die Nutzerzahlen und die effektive Bekämpfung von Covid-19 angeht, ist sicherlich noch reichlich (Entwicklungs-)Potenzial vorhanden. Darauf verweist auch die aktuelle Diskussion zum kleinen Jubiläum der Anwendung. Die beschriebenen Vertrauensinvestionen haben jedoch überhaupt erst die Grundlagen dafür geschaffen, um dieses Potential ausschöpfen zu können. Darin zeigt sich auch die übergreifende Bedeutung der Corona-Warn-App: Analog zu den behandelten Smart-Meter-Fallstudien kann sie als Blaupause dafür dienen, um künftig bei der Entwicklung digitaler Technologien das ethische Dilemma zwischen gemeinwohldienlichem Teilen von Daten und informationeller Selbstbestimmung erfolgreich auszubalancieren.
Michael Walter ist Leiter des Projekts „Ethische Herausforderungen der digitalen Energiewende“ am Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik.
Martin von Broock ist Vorstandsvorsitzender des Wittenberg-Zentrum für Globale Ethik.
