Der Weg in die Eurokrise
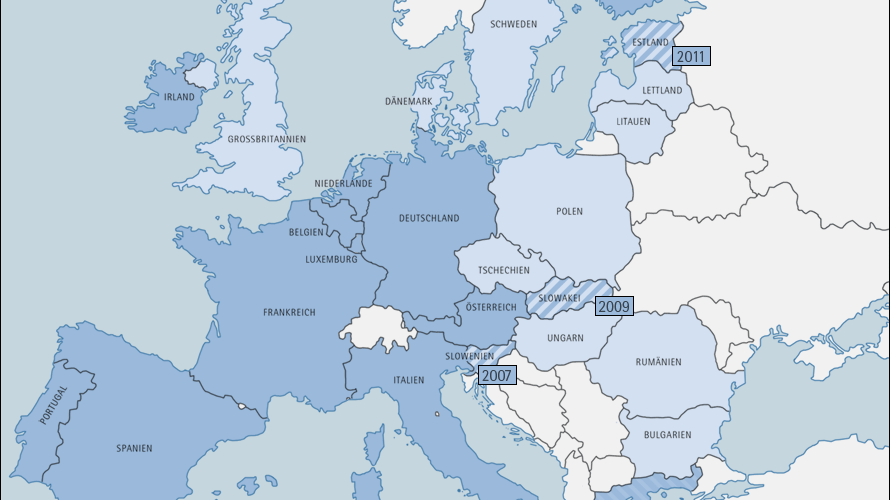
Mitgliedsländer der EU und der Eurozone
Von der Deutschen Wiedervereinigung bis zur Pleite Griechenlands - eine kleine historische Bilanz nach zehn Jahren Eurozone
Dass der Euro Schwächephasen aufweisen wird, damit musste gerechnet werden. Immerhin war der Euro 1999 mit 1,15 zum Dollar an den Start gegangen und hatte schon 2001 nur noch 85 Cents gekostet. Wenn die Kaufkraftparität zum Dollar überwiegend mit rund 1,25 angegeben wird, sollte zum aktuellen Wechselkurs von um die 1,32 eigentlich noch nicht einmal von einer Eurokrise, sondern eher von einer Überbewertung die Rede sein. Dennoch gehen Gerüchte um, die Bundesbank sei bereits wieder dabei, vorsorglich D-Mark zu drucken, während US-Ökonomen bereits die Tage bis zum Auseinanderbrechen der Eurozone zählen sollen.
Nun sind die strukturellen Probleme der Eurozone offenkundig. Von Anfang an war bekannt, dass es sehr schwer sein wird, angesichts der in den einzelnen Ländern voraussichtlich sehr unterschiedlichen Wachstums- und Preissteigerungsraten einen einheitlichen Zins vorzuschreiben. Ebenso war von Anfang an klar, dass für Länder mit Leistungsbilanzproblemen der übliche Ausgleich über den Wechselkurs unmöglich wird.
Politisch begegnet wurde diesen Problemen einerseits mit der Hoffnung, dass der gemeinsame Währungsraum zu einer starken Konvergenz der Wirtschaftszyklen führen werde, anderseits wurden die fiskalischen Konvergenzkriterien einer maximal dreiprozentigen Neuverschuldung und einer Schuldenobergrenze von 60 Prozent verordnet, was die Solvenz der Eurozonestaaten sicherstellen sollte. Es gilt übrigens vor allem als Idee der Bundesbank, dass staatliche Budgetdisziplin und eine strikte Unabhängigkeit der Notenbank quasi automatisch zu einer wirksamen Stabilitätskultur führen würden, so dass das Problem eines Staatsbankrotts folglich nicht einmal angedacht wurde.
Das alles hat sich inzwischen als Wunschtraum erwiesen, wobei mit Griechenland und Irland auch schon die Prototypen negativer ökonomischer Eskalationsszenarien vorliegen. Griechenland muss dabei für ausuferndes Klientelwesen und Bürokratie herhalten, wie sich unschwer aus dem Ausmaß der gezielten Manipulation der Statistiken oder aus den geschäftlichen Erfahrungen von Siemens schließen lässt.
Irland zeigte hingegen, dass die fiskalischen Stabilitätskriterien besonders leicht zu erfüllen sind, wenn zu niedrige Zinsen und massenhaft aus dem Ausland einströmendes öffentliches wie privates Kapital für einen jahrzehntelangen Boom sorgen. Ökonomisch bedeutet hereinströmendes Kapital allerdings, dass inländisches Vermögen verkauft oder von Inländern Kredite aufgenommen wurden. Insofern ist zwar nicht verwunderlich, dass die privaten Schulden aus dem Ruder gelaufen sind, kaum jemand hatte hingegen vorausgesehen, dass durch den Zwang, das Finanzsystem zu retten, die privaten zu öffentlichen Schulden wurden, wie es nicht nur dem einstigen "Keltische Tiger" und Budgetmusterschüler zugestoßen ist.
Belastung durch Fehler bei der Wiedervereinigung
Wie es so weit gekommen ist, lässt sich im Rückblick gut erkennen und soll hier kurz nachgezeichnet werden. Die Geschichte beginnt wohl am besten mit der Wiedervereinigung Deutschlands, die nicht nur die Voraussetzung für die Euroeinführung war – schließlich war die Zustimmung Frankreichs zur Wiedervereinigung an die Zustimmung Deutschlands zur Währungsunion geknüpft -, sondern wohl auch der wichtigste Grund für die schweren ökonomischen Verwerfungen innerhalb der Eurozone sein dürfte.
Denn in jenem historischen Pakt gab Deutschland seine langjährige Forderung auf, die Währungsunion mit einer engen politischen Union zu verknüpfen, die es möglich gemacht hätte, den unterschiedlichen Preis- und Wachstumsdynamiken der einzelnen Länder mit einer europaweit koordinierten Fiskalpolitik entgegenzutreten.
Als besonders gravierend sollte sich erweisen, dass sich Deutschland zuvor durch eine extrem ungeschickte Vorgehensweise bei der Wiedervereinigung selbst in eine prekäre Lage gebracht hatte. Denn Deutschland beging bei seiner eigenen kleinen Währungsunion mit der Ex-DDR denselben Fehler, den schon Adolf Hitler bei der Annexion Österreichs gemacht hatte: Um seinen Landsleuten einen "Gefallen" zu tun, gewährte der faschistische Diktator dem österreichischen Schilling einen Wechselkurs, der weit jenseits der Marktpreise stand. Das ermöglichte den Österreichern anfangs zwar günstige Urlaubs- und Einkaufsreisen nach Deutschland, die preislich nicht mehr konkurrenzfähige österreichische Industrie wurde jedoch stranguliert.
Die Politiker des wiedervereinigten Deutschland – namentlich Helmut Kohl – hatten diese finanzhistorische Lektion offenbar verschlafen bzw. ignoriert: Gegen den heftigen Widerstand von Bundesbankchef Pohl wurde 1990 der Vertrag über die Währungsunion unterzeichnet und von Bundestag und Volkskammer mit großer Mehrheit bestätigt. Die Geldbestände wurden generell 2:1 und bis zu 6.000 DM pro Privatperson wurde sogar 1:1 umgetauscht. Parität galt auch für laufende Zahlungen, während alle Schulden 2:1 umgestellt wurden. Am Markt war die Ostmark hingegen mit einem Kurs von mindestens 4:1 gehandelt worden, woraus sich enorme ökonomische Verwerfungen ergeben mussten.
In Summe wurden am 1. Juli 1990 mehr als 180 Mrd. DM ausgezahlt, was wenig daran änderte, das der Westgüter-Kaufrausch nur sehr kurze Zeit anhielt. Der so genannte "Vereinigungsboom" war zudem mit dem vollständigen Zusammenbruch des ostdeutschen Inlandsabsatzes und der Exporte erkauft, so dass es Ende 1991 in der ehemaligen DDR und Ost-Berlin bereits etwa eine Million Arbeitslose gab. Mit der darauf folgenden Wirtschaftskrise stieg die Arbeitslosigkeit in den alten Bundesländern rasch auf 30 Prozent an. Gesamtdeutschland bezahlt die monetäre Wiedervereinigung über die folgenden Jahrzehnte mit unterdurchschnittlichen Wachstumsraten und fiel in der internationalen Reichtums-Rangliste bei Einkommen und Vermögen um mehr als zehn Plätze und damit hinter Länder wie Österreich und Frankreich zurück.
Euro-Einführung und die platzende Dotcom-Blase
Erst mit dem New Economy-Boom der späten 1990er Jahre schien diese Krise überwunden. Und so startete der Euro 1999 mit einem damals als ambitioniert eingeschätzten Wechselkurs von 1,15 zum Dollar. Als nach 2000, kurz nach der realen Euroeinführung, die Blase platzte, erwies sich Deutschland neuerlich als kranker Mann Europas, der offenbar in einer Situation gefangen war, die als Bilanz-Rezession bezeichnet werden kann. Während die Wiedervereinigung noch immer nicht verdaut war, hatte nun besonders der jugendlich-dynamische Teil der Wirtschaft durch den Börsencrash einen empfindlichen Vermögensverlust zu verkraften, obgleich der Wert ihrer Schulden gleich geblieben war. Unternehmen und Haushalte hatten im Schnitt also zu hohe Schulden angehäuft und versuchten diese zu reduzieren, um ihre Vermögensbilanzen zu verbessern - allerdings um den Preis einer schwächelnden Binnennachfrage. Da der Privatsektor sparte, blieben nur der Staat und der Auslandssektor, um wenigstens etwas Wachstum zu erzielen.
Da kam die neue Währungsunion gerade recht. Denn die Eurozoneländer, die sich keine DDR und keinen großen "Neuen Markt" geleistet hatten, standen nun wesentlich besser da, viel besser jedenfalls. Insbesondere die traditionellen Hochzinsländer an der südlichen Peripherie traten mit Ausnahme Italiens nun in kräftige Boomphasen ein und Irland legte noch einen letzten Gang zu, trotzdem hielt die EZB die Zinsen Deutschland zuliebe lange sehr niedrig.
Das war gleichzeitig aber auch in Japan, den USA und Großbritannien der Fall, so dass die niedrigen Eurozinsen nicht zu einer starken Euro-Abwertung und einer gesamteuropäisch aktiven Handelsbilanz führten, sondern zu einem Aufblähen der Ungleichgewichte innerhalb Europas. Denn während in Deutschland Lohnzurückhaltung und Sparsamkeit geübt wurde, führten die Niedrigzinsen in den jetzigen Krisenländern nicht nur zu Bau-Booms oder einer Verluderung der Bürokratie, sondern auch zu hohen Preis- und Lohnsteigerungen, die vor allem die Wettbewerbsfähigkeit gegenüber Deutschland und ihre Attraktivität im Tourismus unterminierten. Während es Deutschland also gelang, seine internen Defizite durch eine hochaktive Handelsbilanz auszugleichen, drehten die Leistungsbilanzen der Boomstaaten massiv ins Minus, was den enormen Anstieg der Auslandsverschuldung mit sich brachte, die heute so problematisch erscheint.
Die kurze Zeit der great moderation
Bis 2008 waren die hohen Wachstumsraten der Peripherie jedoch noch als ausgesprochen positiv gesehen worden, da sie anscheinend einen erfolgreichen Aufholprozess dokumentierten. Auch an den Bondmärkten wurde diese Story geglaubt. So hatten die Aufschläge für Staatsschulden gegenüber der Deutschen Benchmark vor der Lehman-Pleite bei keinem Eurozonenland mehr als 0,5 Prozentpunkte betragen, was zudem hauptsächlich mit der geringeren Liquidität dieser Titel als mit einem höheren Ausfallsrisiko begründet wurde – schließlich galt es schlicht als undenkbar, dass ein Eurozonenland seine Gläubiger werde hängen lassen, wovon damals übrigens auch die Ratingagenturen überzeugt waren.
Aber diese hatten zu diesem Zeitung auch AAA-Ratings für Anleihen vergeben, die ausschließlich auf US-Hypotheken gestützt waren, von denen bei näherer Betrachtung auch damals schon hätte vermutet werden können, dass außer in der besten aller möglichen Welten nur wenige davon bis zum Abreifen korrekt bedient werden würden.
Für den klassisch geschulten Ökonomen hatte bis dahin jedoch das Dogma gegolten, dass eine Notenbank nur den kurzfristigen Zinssatz beeinflussen könne. Setzt sie diesen zu niedrig an, würden die Bondmärkte das Vertrauen in die Solidität der Geldpolitik verlieren und höhere Langfristzinsen verlangen um die Inflationsrisiken auszugleichen. Diesmal war der Boom jedoch mit der "search für yield", einer Jagd nach höheren Renditen verbunden, die die Preise für alle Arten von Risiken in die Höhe trieb und die Risikoprämien weltweit fallen ließ.
Folglich sanken auch die Zinsen für langfristige Staatsschulden, und als die Notenbanken endlich die Kurzfristzinsen anhoben, kam es zur Kompression von kurz- und langfristigen Zinsen. Denn während die kurzfristigen Zinsen anstiegen, gingen die langfristigen Zinsen weiter zurück. Da die Banken traditionell aber über die sogenannte Fristentransformation vor allem an dieser Differenz verdienen, mussten sie, um ihre Eigenkapitalrentabilität auch nur zu halten, einerseits ihre Bilanzen ausweiten und ihr Leverage erhöhen. Anderseits mussten sie gegen immer weniger Kompensation immer höhere Risiken eingehen, um etwas mehr an Zinsen zu erhalten, dies zudem verstärkt außerhalb der Bilanzen und mit Hilfe von Finanzderivaten.
Aus Sicht der herrschenden makroökonomischen Ideologie war dies auch durchaus begründbar, denn inzwischen hatten sich ausgehend von den USA die Geldpolitiker weltweit davon berauschen lassen, dass die zahlreichen Finanzcrashes wie die Asienkrise, die Russlandkrise oder die New Economy-Krise nicht zu dramatischen Einbrüchen der Realwirtschaft geführt hatten: Dafür klopften sich die Notenbanker nun gegenseitig auf die Schultern und von der Fed wurde für die vergangenen 20 Jahre der Ausdruck "Great Moderation" erfunden, die von einer hohen Stabilität von Beschäftigung, Wachstum und Inflation in den westlichen Industriestaaten geprägt sein und laut nicht wenigen neoliberalen Wirtschaftsprofessoren ewig währen sollte.
Das Kartenhaus bricht zusammen
Die Banken vergaben folglich sorglos Kredite an zunehmend weniger kreditwürdige Kunden und refinanzierten diese mit kurzfristigen Interbankkrediten, wobei die großen US-Banken zwar den Takt vorgaben, sich aber auch die europäischen Banken mitreißen ließen. In den Boomjahren vor 2008, als die Wall Street noch meinte "jede" Übernahme finanzieren zu können und die Preise für alle Arten von Risiken so niedrig waren wie nie zuvor, hatten die strengen Sittenwächter der Bondmärkte indes keine Chance gehabt, ihre zuvor jahrelang geübte Aufsicht über die finanzielle Stabilität der Kreditnehmer aufrecht zu erhalte.
Nicht wenige professionelle Real-Money Bondinvestoren, die typischerweise Pensionsgelder langfristig veranlagen und zumeist über eine solide ökonomische Ausbildung verfügen, hatten schon vor der Krise zu den Skeptikern gezählt, womit sich teilweise begründen lässt, warum die umlaufenden Schrottanleihen in so großer Zahl bei den Banken geblieben waren. Dass sie weder die ruinösen Privatkreditvergaben der Banken noch die Erosion z.B. der griechischen Bürokratie verhindern konnten, lag aber wohl vor allem daran, dass Aufsichtbehörden und Notenbanken es zugelassen hatten, dass die Banken außerbilanzielle Sondergesellschaften errichteten, die mit billigen kurzfristigen Geldern gewaltige Portfolios aus langfristigen Wertpapieren finanzierten, ohne viel Eigenkapital dafür bereitstellen zu müssen.
Der Absatz der Schrottanleihen war damit also auch ohne langfristige Real-Money-Investoren sichergestellt. Allerdings hatten sich Banken wie Privatschuldner wie gigantische Hedge Fonds verhalten. So verließen sich die Banken darauf, ihre kurzfristigen Verbindlichkeiten stets problemlos prolongieren zu können und strichen die Differenz zu den Langfristzinsen ein. Die US-Hypothekenschuldner spekulierten hingegen darauf, dass der Wert ihrer Immobilien immer weiter steigen werde und verkonsumierten die noch nicht realisierten Vermögenszuwächse.
Als dann im Sommer 2007 die Werthaltigkeit der strukturierten Schuldtitel, die allesamt auf privaten Schulden basierten, infrage gestellt wurde, brach das Kartenhaus zusammen. Den Anfang machten die berüchtigten US-Subprimehypotheken, die tatsächlich von kaum der Hälfte der Kreditnehmer ordnungsgemäß bedient wurden und zudem über kompliziert verschachtelte Verbriefungen weltweit an unbekannte Investoren verkauft worden waren. Zudem stellte sich nun heraus, dass sich diese Papiere großteils noch immer in den Bilanzen der Banken befanden, und dass auch etliche weitere Kreditkategorien ähnliche Probleme hatten. Folglich ging das Vertrauen der Banken untereinander immer weiter zurück, bis sie nach der Lehmanpleite die gegenseitigen Finanzierungen praktisch völlig einstellten.
Zu diesem Zeitpunkt war es völlig egal, wie werthaltig die Bilanz einer Bank tatsächlich beschaffen war, denn das wussten oft nicht einmal die Banken selbst, die noch dazu auch riesige Portfolios aus Derivaten aufgebaut hatten, deren Wert im Falle in der Krise ebenfalls zusehends fraglich wurde. Da praktisch alle Banken aber auf laufend revolvierende Interbankfinanzierungen angewiesen waren, brach das globale Finanzsystem zusammen und musste von Notenbanken und Politik gerettet werden.
Dadurch kam nicht zum Erliegen des Welthandels die schwerste globale Wirtschaftskrise nach dem 2. Weltkrieg, sondern es gingen auch die privaten Schulden auf die Regierungen über. Damit hatten die Bondmärkte endlich wieder die Macht über die Regierungen an sich gerissen.
Die üblichen Verdächtigen erwischte es sofort, etwa einige osteuropäische Staaten oder Island, das umgehend unter seinen strauchelnden Banken zusammenbrach. Angesichts der unzähligen Staatspleiten seit dem 2. Weltkrieg war dies aber eher eine Rückkehr zur Normalität.
Im Frühjahr 2008 legten die Bondmärkte indes ein Schäuflein zu und nahmen zuerst Österreich aufs Korn. Denn die österreichischen Banken waren überproportional in Osteuropa engagiert, wobei sie allerdings glaubhaft machen konnten, dass sie diese Krise durchstehen würden. Österreich verschwand nach kurzer Panik wieder aus dem Radar der Märkte – allerdings hatte der vorübergehend um fast einen Prozentpunkt angestiegener Zins das Land wohl mehr als hundert Millionen Euro gekostet. Ende Herbst 2008 war zuerst auch Dubai in Probleme geraten, dann traf es mit Griechenland den nächsten Eurozonenstaat, dies freilich mit etwas mehr Erfolg.
