Biologie, Evolution und das globale Gehirn
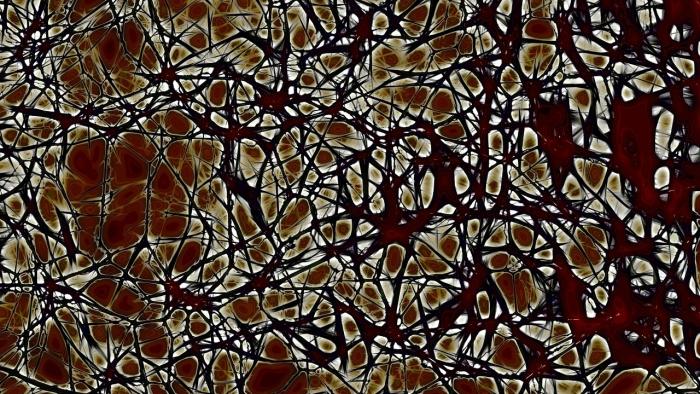
Bild: Maxpixel.net/CC0
Geschichte des globalen Gehirns I
Viele Anhänger der Vision eines globalen Gehirns gehen davon aus, daß eine kollektive Intelligenz erst aus der engen Verknüpfung der Menschen durch die Medien und Computernetze hervorgeht. Der Paläopsychologe Howard Bloom zeigt aber, daß viele Tiere und die Menschen schon immer in einem "Superorganismus" leben, dessen Strukturen sich in ihrer Physiologie mit teilweise erschreckenden Folgen eingeprägt haben. Aus dieser biologischen Perspektive ergibt sich auch eine neue Bewertung der bislang verfemten Evolutionstheorie der "Gruppenselektion", die das beherrschende Dogma der meisten Evolutionstheoretiker verletzt. Müssen wir in den Gesellschaftswissenschaften und in der Evolutionstheorie radikal umdenken?
Das globale Gehirn und das Dogma der individuellen Selektion
Unlängst wurde in Telepolis ein Kapitel aus dem Buch "The Global Brain Awakens" von Peter Russell veröffentlicht. Peter Russell kündigte hier die Entstehung einer weltweiten, durch Computernetze verbundenen Intelligenz an.
Für den britischen Computerwissenschaftler, Experimentalbiologen und Physiker könnte die Entdeckung überraschend sein, daß Forscher und Theoretiker, die auf Evolution spezialisiert sind, die grundlegenden Voraussetzungen dieser Vision in Frage stellen würden. Der Grund für die Skepsis der Evolutionswissenschaftler ist das sogenannte Konzept der individuellen Selektion. Diese Idee hat gewinnbringende neue Perspektiven auf das menschliche Verhalten eröffnet, nachdem sie vor ungefähr 30 Jahren erstmals gefaßt wurde. Aber seitdem ist dieses Konzept teilweise von einer intellektuellen Brille zu einem blindmachenden Instrument geworden.
Dieser Beitrag wird die wackeligen Wurzeln der individuellen Selektion herausarbeiten und ein Modell - das meine - vorstellen, das die fehlende Verbindung zwischen den Skeptikern - den Evolutionswissenschaftlern - und den Gläubigen herstellen könnte, die man unter den Computerfachleuten findet, welche einen von gemeinsamer Information pulsierenden Planeten erträumen, dem, wie Peter Russell es sagt, ein globales Nervensystem gewachsen ist.
Der wissenschaftliche Hintergrund derjenigen, die eine weltweite Intelligenz vorhersagen, ist makellos. Peter Russell studierte Mathematik und theoretische Physik in Cambridge, arbeitete mit Stephen Hawking, erhielt (noch einmal in Cambridge) einen akamdemischen Titel und promovierte in Experimentalpsychologie. Joel de Rosnay, der Autor des Buches "Das globale Gehirn" (1986), war Direktor für Forschungsanwendungen am Institut Pasteur, Wissenschaftler für Biologie und Computergrafik am MIT und wirkte an der Einrichtung des französischen Zentrums für Systemtheorien und neue Technologien mit. Valentin Turchin, ein zentrales Mitglied der internationalen "Global Brain Study Group" hat eine dreifache Doktorwürde in theoretischer Physik. Gottfried Mayer-Kress, Autor von "The Emergence of Global Brains in Cyberspace", hat in theoretischer Physik an der Universität Stuttgart promoviert und war mit solchen berühmten Institutionen wie dem CERN, dem Los Alamos National Lab oder dem Santa Fe Institute verbunden. Francis Heylighen, ein weiteres Gründungsmitglied der Global Brain Study Group, promovierte in Physik in Brüssel und ist unter anderem ein Direktor des multidisziplinären Center Leo Apostel in Brüssel.
Warum also würde eine internationale Gruppe ebenso hehrer Spezialisten den Begriff der Intelligenz eines Superorganismus belächeln? Die individuellen Selektionisten, die heute die "neodarwinistische" Überzeugung beherrschen, glauben, daß jedes tierische und menschliche Verhalten das Ergebnis der genetischen Habgier ist. Selbst die offensichtlichste selbstaufopfernde Tat ist das Ergebnis einer verborgenen Berechnung der genetischen Kosten und Gewinne. Ein Gen, das genügend nach der Garantie giert, daß zwei seiner Kopien auf die nächste Generation übergehen, wird sich schnell vermehren. Gene, die Selbstverleugnung programmieren, werden Mittel aufgeben, anderen zu helfen. Folglich werden einige dieser Gruppenspieler keine Kopien von sich verbreiten. Die Population der nicht-egoistischen Gene werden von Generation zu Generation dahinschwinden, bis sich die Unterstützer des allgemeineren Guten aus dem Leben philanthropisiert haben. Und die für lange Zeit Überlebenden werden so vorprogrammiert sein, daß sie nur kooperieren, wenn der Preis von dem, was sie aufzugeben genötigt sind, sich in einem genetischen Profit auszahlt.
Die verfemte Alternative der Gruppenselektion
In der Zwischenzeit ist untergründig eine andere Schule evolutionären Denkens entstanden, die man die der Gruppenselektion nennt. Die wenigen Evolutionswissenschaftler, die bereit sind, ihren Glauben an die Gruppenselektion einzugestehen, behaupten, daß die Individuen ihre einzigartige genetische Erbschaft für das Interesse eines größeren Ganzen zu opfern. Ein derartiges Bedürfnis nach Kooperation und Konvergenz müßte vorhanden sein, um das globale Gehirn und das planetare Nervensystem zu ermöglichen. Andererseits werden Menschen, wenn die individuellen Selektionisten Recht behalten, ihr Wissen nicht mit anderen teilen wollen, weil das ihnen einen Vorteil verschaffen könnte. Das Cybermeer des WWW und seiner technischen Nachfolger wird eher der Schlund eines Barracuta als ein Metaintellekt sein.
Zahlreiche Wissenschaftler haben in Zeitschriften, die eine emotional getönte Sprache meiden, die Gruppenselektion als "Häresie" bezeichnet. Robert Wright, der Chronist der auf individueller Selektion beruhenden Evolutionspsychologie, ist in seiner Verdammung gnädiger. Gruppenselektion, so sagt er, ist nur eine verführerische "Versuchung".
Robert Wright bezeichnet die auf der individuellen Selektion aufbauende Psychologie als das "das neue Paradigma", doch der Begriff der individuellen Selektion zeigt bereits die Erstarrung des Alters. Die Ansicht, daß jedes Verhalten letztlich auf Selbstinteresse zurückgehe, setzte sich früh im 20. Jahrhundert durch. Als "Überlebensinstinkt" verschleiert, beherrschte sie eine weitere hinterfragbare Orthodoxie: das Flucht- oder Kampfsyndrom, das von William McDougall 1908 aufgespürt und von Walter Cannon 1929 bekannt gemacht wurde. Als Experimentalpsychologe meint jedoch Robert E. Thayer, daß "bestimmte Aspekte des Flucht- und Kampfmodells zu keiner Zeit durch wissenschaftlicher Evidenz unterstützt wurden." Überdies kann dieses Modell nur teilweise richtig sein. Wenn Tiere mit einer überwältigenden Bedrohung konfrontiert sind, dann erstarren sie häufig aufgrund von Angst, Resignation und einer Reihe miteinander verbundener physiologischer Mechanismen. Anstatt zu kämpfen oder wegzurennen, um ihr Leben zu retten, überlassen sie sich den Klauen des Jägers. Soviel also zur Allgegenwart des Überlebensinstinkts! Dennoch gilt das Prinzip Kampf oder Flucht bis heute als absolute Wahrheit. Über 30 Jahre nach Cannon hatten aber W. D. Hamilton und andere den Mut, zumindest ein Haar in der Suppe des Selbstinteresses zu erkennen. Wenn das individuelle Überleben das ein und alles jeder Existenz ist, wie kann man dann Altruismus erklären?
Während der frühen 60er Jahre konzentrierte sich Hamilton auf das selbstlose Verhalten von weiblichen Arbeitsbienen, die ihre Reproduktionsansprüche opfern und keusch ihrer Königin dienen. Sein Triumph war eine mathematische Beweisführung, daß die Arbeiterinnen im wesentlichen dieselben Gene als ihre Königin besitzen. Wenn daher ein Individuum zugunsten seines Monarchen lebt, scheint sie lediglich ihre eigenen Bedürfnisse zu ignorieren. Durch das Versorgen der Eier einer Kolonie brütet jede Arbeiterin Kopien ihres eigenen biologischen Erbguts aus. Altruismus, so behauptete Hamilton, ist verschleiertes Selbstinteresse.
Hamiltons Ideen und die darauf aufbauenden Theorieansätze haben sehr zu unserem Verständnis der evolutionären Mechanismen von der Medizin, Ökologie und Psychologie bis hin zur Ethologie - der Untersuchung von freilebenden Tieren - beigetragen. Doch fast 25 Jahre nach der Entdeckung Hamiltons hat die Untersuchung an wirklichen Bienenkolonien gezeigt, daß seine Mathematik nicht mit den Tatsachen übereinstimmt. In den Gesellschaften nicht-egoistischer Insekten gab es weitaus mehr genetische Varianz, als die Gleichungen erlauben würden. Individuen schwören nicht ihren Interessen einfach deswegen ab, weil sie ähnliche Klone ihres eigenen Genoms schützen wollen. Offensichtlich geschieht irgend etwas anderes.
Trotzdem verhärteten sich die auf der sogenannten individuellen Selektion basierenden Theorien zum Dogma. Und viele, die andere Ansätze als Hamilton verfolgten, wurden durch die stillschweigende Bedrohung gestoppt, von der professionellen Anerkennung ausgeschlossen zu werden, in ihrer Karriere behindert zu werden und keine Forschungsgelder mehr zu erhalten.
Mitte der 90er Jahre ging eine wachsende Gruppe von Wissenschaftlern das Risiko ein, lächerlich gemacht zu werden, indem sie für die gleichzeitige Gültigkeit von individueller und Gruppenselektion eintraten. David Sloan Wilson von der State University of New York ist der anerkannte Pionier dieser Gruppe. Ich war Organisator einer seiner Guerillaeinheiten: "The Group Selection Quad". Und meine theoretischen Arbeiten zeigen deutlich, daß die Sozial- und Biowissenschaften einen großen Gewinn aus der Neubewertung der Selektion gewinnen könnten.
Physiologische Wirkungen der Gruppenselektion im Individuum
David Sloane Wilson hat auf über 400 Untersuchungen hingewiesen, die die Perspektive der Gruppenselektion unterstützen. Seine Forschungen hat er auf den Nachweis ausgerichtet, daß bei Menschen diejenigen, die ihr Denken vereinigen, normalerweise bessere Entscheidungen treffen als jene, die das, was sie denken, für sich behalten. Ich habe meine Bemühungen auf die Einführung einer wissenschaftlichen Disziplin gerichtet, deren Daten die individuellen Selektionisten nicht zur Kenntnis nehmen wollen. Dieser halsstarrig vernächlässigte Bereich ist die Pychoneuroimmunologie, also die Untersuchung der Beziehungen zwischen der Physiologie und den Bedingungen in der "mentalen" oder psychosozialen Umwelt.
Wie wir bereits gesehen haben, bestehen die individuellen Selektionisten darauf, daß ein Lebewesen, egal ob es sich um ein Tier oder um einen Menschen handelt, seinen Eigennutz nur dann opfert, wenn der Gewinn für seine Gene größer ist als das, was es aufgibt. Sein selbstverleugnendes Verhalten muß nahen Verwandten zugute kommen, die dieselben Gene besitzen. Das nennt man "Familienselektion". Ein Lebewesen kann zugunsten eines Nicht-Verwandten einen Aspekt seines Wohlergehens aufgeben ... aber nur, wenn es begründet erwarten darf, daß diese Gunst auch wieder zurückerstattet wird. Dieses theoretische Hintertürchen ist als "reziproker Altruismus" bekannt.
Aber bereits in den frühen 40er Jahren begannen Wissenschaftler wie René Spitz zu entdecken, daß der genetische Überlebensinstinkt bei Menschen ein Gegenstück unerwarteter Natur hat. Das war ein physiologischer Zwilling von Freuds angenommenen Thanatos, vom Todestrieb. Die neuen Empiristen hatten nicht die Begabung Freuds, einprägsame Begriffe zu prägen. Sie stellten nur fest, was vor sich ging, und erfanden neue Bezeichnungen ("anaklitischer Schock", "erlernte Hilflosigkeit") für jeden von ihnen identifizierten Vorfall. In meinem Buch "The Lucifer Principle: a scientific expedition into the forces of history" habe ich mir die Freiheit genommen, eine allgemeine Bezeichnung einzuführen. Jeder Forscher, von René Spitz, Harry Harlow oder Lydia Temeshok bis hin zu Martin Seligman und Robert Sapolsky, hat ein Beispiel für einen "selbstzerstörerischen Mechanismus" ans Tageslicht gebracht.
Nehmen wir ein typisches Beispiel. Zahlreiche Untersuchungen von Wissenschaftlern mit sehr unterschiedlichen Perspektiven haben gezeigt, daß jene Krankenhauspatienten, die am meisten Hilfe benötigen, diese am wenigsten erhalten. Depressive Patienten verhalten sich auf eine Weise, die Ärzte und Schwestern veranlaßt, sie zu meiden. Sie werden unkommunikativ und gereizt. Sie bringen andere mit allen Mitteln vom Gesichtsausdruck und der Sprachbetonung bis zur Körpersprache durcheinander. Ein individueller Selektionist würde das so erklären, daß ein derartiges selbstschädigendes Verhalten das Ergebnis einer adaptiven Reaktion ist, die enge Verwandte von einer Last befreit, ihnen einen Vorteil verschafft ("Familienselektion") oder den guten Willen eines anderen auflädt, der das sich selbst opfernde Individuum oder andere Träger seiner Gene in der Zukunft kompensiert ("reziproker Altruismus").
Empirische Untersuchungen zeigen jedoch Gegenteiliges. Die Patienten mit der größten Zahl von Verwandten und Freunden sind am wenigsten anfällig für Depression. Sie neigen dazu, fröhliche Seelen zu sein, die selbst angesichts des Todes freundlich sind und Ärzte sowie Schwestern dazu veranlassen, sich mit Sympathie an ihrem Bett zu versammeln. Daher sind diejenigen, die nach Ansicht der individuellen Selektionisten Kopien ihrer Gene durch ihr Ausscheiden fördern könnten, am geringsten davon bedroht, vorzeitig von der Sense des Todes gefällt zu werden.
Andererseits haben Untersuchungen an Menschen und Tieren gezeigt, daß die individuellen Selektionisten gerade als letztes erwarten würden, daß depressive Lebewesen mit ihrem Sensenmann flirten, da sie zumindest Gene bevorzugen sollten, die den ihren ähnlich sind. Ihre Familienbande sind entweder beschädigt oder nicht vorhanden. Die Immunsysteme von Lebewesen mit wenigen oder keinen Freunden und eng verbundenen Verwandten brechen zusammen, während die Immunresistenz derjenigen, die Teil eines sozialen Netzes sind, viel größer ist. Isolierte Individuen erleben, um es anders auszudrücken, eine ganz unwillentliche Unterwerfung unter Krankheit und körperlichen Zerfall. Sie werden von etwas ergriffen, das dem Selbstmordmechanismus ähnlich ist, den man Apoptosis nennt, eine Folge von selbstzerstörerischen Vorgängen, die in nahezu jeder lebendigen Zelle vorprogrammiert sind und dann aktiviert werden, wenn die Zelle Signale erhält, daß sie für die größere Gemeinschaft, deren Teil sie ist, keinen Nutzen mehr bringt. Zwischen ihrem Immunsystem, das sich selbst lahmlegt, und ihren Verhaltensweisen der Selbstverteidigung gefangen, lassen isolierte Individuen ihre Todeschancen schnell anwachsen. Die Gewinnauszahlung für ihre Kopien geht gegen Null. Nichts dergleichen paßt zum ausgearbeiteten Dogma des individuellen Selektionismus.
Wenn sie in einer Falle gefangen werden, behaupten individuelle Selektionisten oft, daß wir Zeugen eines Instinktes sind, der während unserer Tage als Sammler und Jäger hilfreich war, der also unter den Bedingungen des Pleistozäns die Überlebenschancen derjenigen mit ähnlichen Genen erhöhte. Was diese Apologeten jedoch behaupten, ist, daß das, was den Genen in unserem Innersten während der Tage der ersten Steinaxt zum Vorteil diente, in der modernen Industriegesellschaft hinsichtlich seines Zweck pervertiert wurde.
Aber dieses Argument hält vermutlich nicht lange stand. Die Isolation von Schimpansen, Hunden, Labormäusen und vielen anderen Tieren führt zur Depression, zu einer Schwächung des Immunsystems und zu einer Unfähigkeit, Fluchtwege zu sehen oder zu benutzen. Auch Lebewesen ohne Industrialismus erhöhen wie wir ihre Todeschancen, wenn sie aus ihren sozialen Verbindungen herausgelöst werden, und nicht, wenn ihr Verschwinden einen Vorteil für Träger von Genen bringt, die den ihren ähnlich sind.
Superorganismus, neuronale Netze und Immunsysteme
An diesem Punkt wird das neue Modell des evolutionären Prozesses begreifbar, das ich in "The Lucifer Principle" eingeführt. Nehmen wir für einen Augenblick an, daß die Vertreter der Gruppenselektion richtig liegen. Individuen werden sich selbst zugunsten des Wohls eines größeren Ganzen opfern. Diese größeren Einheiten liegen miteinander im Wettstreit. Wenn Gruppen einander bekämpfen, werden diejenigen gewinnen, die sich der wirkungsvollsten organisatorischen, strategischen und technischen Vorteile rühmen können. Individuen, die einen Beitrag zur Virtuosität ihrer Gruppe leisten, werden Teil eines überlebenden Teams sein. Und auf diese Weise schreitet die Evolution voran.
Fügen wir jetzt noch zu den Annahmen der Gruppenselektionisten ein weiteres Konzept hinzu, das den Mathematikern der Komplexität vertraut ist. Komplexe adaptive Maschinen sind lernende Systeme, die aus zahlreichen Komponenten bestehen. Neuronale Netze und Immunsysteme sind besonders gute Beispiele dafür. Beide wenden einen Algorithmus an, der auf nicht mathematische Weise am besten von Jesus von Nazareth formuliert wurde: "To him who hath it shall be given; from he who hath not even he hath shall be taken away."
Das neuronale Netz besteht aus einer großen Population individueller Schaltstellen, von elektronischen Knoten, deren Verbindung mit dem größeren Netz verstärkt oder radikal vermindert werden kann. Ein Immunsystem führt dieses Prinzip noch einen Schritt weiter. Es besitzt zwischen 10 Millionen und 10 Milliarden unterschiedlicher Antikörper. Zusätzlich enthält es eine Menge an Einheiten, die man "individuelle virenspezifische T-Zellen" nennt. Sowohl das Immunsystem als auch das neuronale Netz gehorchen dem biblischen Gesetz. Elemente, die zur Lösung eines gemeinsamen Problems beitragen, erhalten Ressourcen und Einfluß, aber das Los vieler Elemente, die der Gruppe nicht dienen können, ist der Entzug von diesen. Im Immunsystem treffen die T-Zellen auf die MHC-Zeichen eines Eindringlings. Ein kleiner Anteil der Verteidiger entdeckt, daß ihre einzigartigen Rezeptoren es ihnen ermöglichen, die Angreifer zu besiegen. Diese Champions dürfen sich dann in explosiver Geschwindigkeit reproduzieren, und ihnen wird das Rohmaterial übergeben, das sie benötigen, um ihre Zahl ansteigen zu lassen. T-Zellen, die für den gegenwärtigen Angriff nicht dienlich sind, werden ihrer Ernährung, ihrer Fähigkeit, sich fortzupflanzen, und oft auch ihres Lebens beraubt. Jede unterliegt der internen Zerstörung durch den "vorprogrammierten Zelltod" der Apoptosis.
Im neuronalen Netz werden Knoten, deren Zusammenarbeit zur Lösung eines Problems beiträgt, mit mehr elektrischer Energie und mit Verbindungen zu weit entfernten Horden von Rekruten belohnt, während die Knoten, deren Arbeit für das anstehende Problem unbedeutend ist, weniger elektrische Energie erhalten und ihre Möglichkeit, sich mit anderen zu verbinden und sie zu erregen, dramatisch verringert wird. Sowohl T-Zellen als auch Netzknoten konkurrieren um das Recht, die Ressourcen des größeren Systems zu beherrschen. Beide zeigen eine offensichtliche "Bereitschaft", an den Regeln festzuhalten, die Verleugnung erzwingen. Diese Kombination von Konkurrenz und Selbstlosigkeit verwandelt eine Ansammlung von elektronischen oder biologischen Elementen in eine lernende Maschine, die als Ganzes eine adaptive Kraft besitzt, die weit über die jedes einzelnen Elements innerhalb ihrer hinausgeht.
Derselbe modus operandi ist in das biologische Gerüst der meisten sozialen Lebewesens eingebaut. Offensichtlich wird das beispielsweise bei dem Phänomen, das seine Entdecker "erlernte Hilflosigkeit" genannt haben. Tiere und Menschen, die ein wiederholt auftretendes Problem lösen können, bleiben kräftig. Aber Mäuse, Affen, Hunde und Menschen, die nicht mit immer wieder auftretendem Unglück umgehen können, werden zu Opfern der zuvor erwähnten selbstzerstörerischen Mechanismen. Lassen Sie uns etwas mehr ins Detail gehen. Experimente über den physiologischen Einfluß beim Umgang mit einem Problem begannen in den 50er Jahren, als Joseph Brady und seine Kollegen sich einen grausamen, aber klugen Mechanismus ausdachten. Sie stellten zwei Stühle nebeneinander. Die Stühle waren mit einem elektrischen Schaltkreis vernetzt, der gleichzeitig Stromstöße mit derselben Spannung auf die darin Sitzenden austeilen konnte. Die Versuchsobjekte, die in diesen heißen Stühlen festgeschnallt wurden, waren Affen. Es gab nur einen Unterschied zwischen den beiden Affen: der auf der rechten Seite sitzende Affe hatte einen Knopf, mit dem er das dem Paar gemeinsame Problem lösen konnte. Mit dem Knopf konnte er jeden Stromstoß ausschalten, wenn er ankam. Die Wissenschaftler nahmen an, daß der Primat mit dem Schalter schwere gesundheitliche Probleme entwickeln würde. Er war der "Chef", der von der Verantwortung belastet sein würde. Das neben ihm sitzende Tier wurde im selben Augenblick von seinem Schmerz erlöst. Doch dieser Mitfahrer mußte nichts beurteilen oder leisten. Das Tiere ohne Schalter würde sich sicherlich besser entwickeln, da er von der doppelten Last der Sorge und der Wachsamkeit entlastet war. Frühe Auswertungen schienen tatsächlich zu beweisen, daß diese Annahme richtig war. Die Affen mit dem Auftrag der Entscheidungsfindung galten als diejenigen, die eine weitaus größere Neigung zur Ausbildung von Magengeschwüren ausprägen sollten.
Untersuchungen über "erlernte Hilflosigkeit"
Doch eine spätere Untersuchung zeigte, daß die Experimente mit dem "Chefaffen" fatale Designschwächen hatten. Ihre Ergebnisse waren ungültig. Zwanzig Jahre später ließen Experimente etwas ganz anderes sehen. Wenn zwei Ratten - eine mit einem Schalter und eine ohne - in angrenzende Käfige gesteckt wurden, trippelten und sprangen sie zunächst herum, um einen Fluchtweg zu finden, der sie von der zufälligen Austeilung von Thors Blitzen befreite. Die eine Ratte fand schnell ihren Steuerknopf. Sobald der Strom ihre Fußsohlen verbrutzelte, rannte sie zum Schalter und schaltete ihn ab, wodurch sie sich und ihren Kameraden rettete. Andererseits gab die Ratte, deren verzweifelter Versuch, ein Steuerungsmittel zu finden, zu keinem Erfolg führte, meist ihren Kampf auf, legte sich im Käfig nieder und akzeptierte die Schocks mit einer Haltung der Resignation.
Als die Experimente über "erlernte Hilflosigkeit" fortgesetzt wurden, entdeckte man, daß nicht nur Faulheit das Tier aktionsunfähig machte, das nichts zur Lösung des gemeinsamen Dilemmas beitragen konnte. Sein Immunsystem schützte es nicht mehr vor Krankheiten. Wenn man ihm eine Fluchtmöglichkeit anbot, dann war seine Wahrnehmung zu trübe, um sie zu sehen oder ihre Nützlichkeit zu bemerken. Seine selbstzerstörerischen Mechanismen hatten die Macht übernommen. Alles wies darauf hin, daß diese selbstverstümmelnden Reflexe physiologisch vorprogrammiert sind. Am deutlichsten legte davon der Sachverhalt Zeugnis ab, daß das Tier, das mit den Angriffen eines grausamen, vom Wissenschaftler gespielten Schicksal zurechtkam, ein kräftiges Immunsystem behielt, eine relativ deutliche Wahrnehmung der Welt um es herum besaß und aktiv und kraftvoll blieb - trotz seiner immer wiederkehrenden Spurts, um der Quälerei zu entrinnen. Wie würde die von außen verhängte Unfähigkeit seines Nachbarn die Weitergabe der Gene des Opfers in die nächste Generation unterstützen? Offensichtlich kümmerte sich niemand um diese Fragestellung.
C. Wynne Edwards hatte bereits die Auswirkungen dieser Phänomene in einem sozialen Kontext beobachtet. Unter natürlichen Bedingungen sind Tiere nicht durch einen Käfig voneinander getrennt, sondern leben als Teil einer größeren Gruppe. Edwards untersuchte schottische Moorhühner. Bestrafungen und Belohnungen wurden hier nicht von Wissenschaftlern, sondern von der natürlichen und sozialen Umwelt verteilt. Männliche Moorhühner, die durch Beherrschung ihrer Umwelt gute Nahrungs- und Schlafbedingungen finden konnten, wurden kräftig und entwickelten Selbstvertrauen. Diejenigen, deren Futtersuche weniger erfolgreich war und die nicht die sichersten Stangen finden konnten, wurden körperlich weniger robust. Sie gingen geschwächt in den jahreszeitlichen Wettstreit um die Hennen. Sie kämpften einzeln mit ihren erfolgreicheren Gruppenmitgliedern und verloren den Kampf normalerweise. Ihr Versagen, eine Möglichkeit zu finden, wie sie ihre Umwelt beherrschen konnten, führte zu einem korrespondierenden Versagen, Macht in ihrer sozialen Umwelt zu erlangen.
Die erfolgreichen Vögel erwarben einen Harem, einen Zugang zu sogar noch mehr Nahrung als zuvor und einen höheren Grad an Scharfsinn und Leistungskraft. Die Verlierer empfanden Schmach. Als sich ihre selbstzerstörerischen Mechanismen einschalteten, zeigten sie Symptome, die komparative Psychologen als direkte Analogie zur menschlichen Depression bezeichneten. Wie die Ratten, die keinen Einfluß auf ihr Schicksal ausüben konnten, gaben diese Unglücklichen auf und zogen sich resigniert auf eine Position am Rande der Gruppe zurück, an der sie für einen vorbeilaufenden Fuchs am verführerischsten waren. Sie hatten keine Appetit mehr. Da ihr Immunsystem in einen niedrigeren Gang umschaltete, wurden sie immer kränker. In Zeiten der Knappheit waren sie die ersten, die starben.
Wynne-Edwards zog daraus den Schluß, daß er hier die Gruppenselektion beobachtete. Die Vögel, deren Mißgeschick zu einem körperlichen Zerfall geführt hatte, opferten sich selbst, wie er empfand, um die Gruppengröße an die Umgebungsressourcen - die Menge an Nahrung und anderen Notwendigkeiten - anzupassen. Der Schotte veröffentlichte seine Schlußfolgerungen 1962. William Hamiltons Gleichungen hatten 1964 die Gruppe der Evolutionisten im Sturm genommen. Wynne-Edwards wurde der Prügelknabe der Gruppenselektion und büßte seine wissenschaftliche Anerkennung ein. In verbreiteten Nachschlagewerken wird er vor allem als Beispiel eines wissenschaftlichen Irrtums erwähnt.
Was Wynne-Edwards beobachtet hatte, war ein komplexes adaptives System, das einem neuronalen Netz teuflisch ähnlich war. Die Gruppenmitglieder, die Lösungen für aktuelle Probleme finden konnten, wurden mit Macht, Nahrung, Unterkunft und sexuellen Privilegien belohnt. Die schwachen Glieder im neuronalen Netz der Gruppe, die nicht in der Lage waren, Mittel zur Lösung der Umweltpuzzles auf ihrem Weg zu finden, wurden isoliert, das soziale System ließ sie verkümmern und durch Selbstzerstörung zum Krüppel werden.
Die Gruppe hatte, in anderen Worten, ihre wesentlichen Eigenschaften als eine funktionale lernende Maschine, als ein komplexes adaptives System oder, wenn man will, als Superorganismus gezeigt. Später sollte der israelische Naturforscher Amoth Zahavi zeigen, daß Vogelschwärme als gemeinsame Informationsverarbeitungssysteme funktionieren. Zahavi brachte seine Beobachtungen aber nicht mit denen von Wynne-Edwards, den Untersuchungen über "erlernte Hilflosigkeit" und den Prinzipien komplexer adaptiver Systeme zusammen.
Die Perspektive einer vernetzten Intelligenz
Seit 1981 bestand meine Arbeit darin zu zeigen, daß diese Elemente Teile eines einzigen Puzzles sind. Die Existenz selbstzerstörerischer Mechanismen, die Tatsache, daß diese über die Umwelt ein- und ausgeschaltet werden, und die Gegebenheit, daß soziale Tiere durch Netze des Informationsaustauschs verbunden sind, erklären den durch die Schlußfolgerungen der Forschungsübersicht von David Sloane Wilson gestützten Mechanismus, daß eine Gruppe normalerweise besser als die in ihr lebenden Individuen Probleme löst.
Wenn man, kurz gesagt, anerkennt, daß Individuen wie die Moorhühner zwar wirklich um Reproduktionsvorteile kämpfen (man denke an saisonal stattfindenden Turniere, durch die festgelegt wird, welche Hähne Sexualpartner erhalten), daß aber ihr Wettstreit im Rahmen einer vernetzten Intelligenz stattfindet, dann scheint die Idee der Gruppenselektion notwendig zu werden. Man lasse einen massiv parallel verarbeitenden Rechner gegen einen anderen antreten, was in der Natur dauernd geschieht, dann sollte derjenige, der die größten Vorteile aus den Regeln komplexer adaptiver Systeme herausholen kann, der die beste kooperativ lernenden Maschine ist, fast immer gewinnen.
Es ist an der Zeit, daß die Evolutionstheoretiker ihren Geist öffnen und den individuellen Selektionismus als rigides Glaubensbekenntnis aufgeben, das nicht mit seinem vermeintlichen Gegenteil, der Gruppenselektion, koexistieren kann. Wenn ich richtig liege, dann gibt es die vernetzte Intelligenz, die von Computerwissenschaftlern und Physikern als ein Ergebnis der entstehenden Technologien angekündigt wird, bereits seit langem. Sie hat die perverse physiologische Eigenschaft herausgearbeitet, die sich in unserer depressiven Lethargie, in unserer lähmenden Ängstlichkeit, in der Reizbarkeit, durch die wir andere abstoßen, wenn wir sie am meisten benötigen, in unserer Resignation, wenn uns ein Scheitern wiederholt enttäuscht, und im Abbau unserer Gesundheit manifestiert, wenn wir zum Opfer eines überwältigenden Verlustes oder einer Krise werden. Diese physiologisch verdrahteten Merkmale haben uns zu Mikroprozessoren in der am meisten faszinierenden Form von Parallelcomputern werden lassen, die je auf diesem Planeten gebaut wurden. Ohne Transistoren haben sie jeden von uns zu einer Zelle eines vernetzten Gehirns werden lassen.
Drei Fragen an Howard Bloom
Wird Gruppenselektion als Modell in der Hirnforschung, beispielsweise bei Gerald Edelmans "neuronalen Darwinismus", im Hinblick auf Neuronenpopulationen angewendet? Oder dominiert hier auch das Paradigma der individuellen Selektion?
Howard Bloom: Ja und Nein. Zunächst ist es richtig, die Forschungsarbeit von Gerald Edelman mit den Prinzipien der komplexen adaptiven Systeme zu verbinden. 50 % der Gehirnzellen werden bekanntlich im ersten Lebensjahr durch Apoptosis abgetötet. Die Zellen, die nicht mit den Herausforderungen in der Umwelt des Babies klarkommen, müssen verschwinden. Das ist das Prinzip: "To him who hath it shall be given, from he who hath not even waht he hath shall be taken away."
Individuelle Selektionisten würden jedoch die Idee von sich weisen, daß dies eine Gruppenselektion darstellt, obgleich unterschiedliche Neuronenpopulationen miteinander im Wettstreit liegen und durch ihren Erfolg leben oder sterben. Individuelle Selektionisten würden sagen, daß das wirksame Prinzip, weil alle am Wettstreit beteiligten Neuronen denselben genetischen Inhalt haben, dasselbe ist wie in Hamiltons ursprünglichem (und unangemessenem) Modell einer Insektenkolonie. Jeder Vorfall einer Selbstzerstörung stellt folglich eine Familienselektion dar, in der eine suizidale Zelle einen altruistischen Akt begeht, um Kopien ihrer Gene in anderen Zellen des Makroorganismus zu fördern.
Wenn das ein bißchen nach Haarspalterei von Scholastikern des Mittelalters klingt, dann ist dies in der Tat so. Wissenschaftler sind jedoch zu oft besessen davon, sich über den Weg über ein Astloch in einem Baum zu streiten, und können dann nicht mehr den Wald wahrnehmen, dessen Teil der Baum ist. Sie werden vielleicht sogar behaupten, daß der Baum gar nicht existiert.
Steht die Gruppenselektion auch hinter gesellschaftlichen Entwicklungen? Läßt sie sich beispielsweise gegenwärtig in der Abschaffung des Wohlfahrtsstaates sehen, die parallel mit der Globalisierung geschieht?
Howard Bloom: Ja, die Ausbreitung von und die Konkurrenz zwischen Subkulturen ist eine Form der Gruppenselektion, die den Machenschaften des kollektiven Gehirns Macht verleiht. Wie das funktioniert, werde ich in meinem neuen Buch "The Irrational Invention Machine" zeigen. Zudem haben Gesellschaftskritiker wie John Naisbitt (Megatrends) und verschiedene Geschichtswissenschaftler überzeugend zeigen können, daß eine gesellschaftliche Strömung zur Geburt ihres Gegenteils führt. Hegel hätte dem sicher zugestimmt. Die heutige Globalisierung bringt eine gegensätzliche, aber gleiche Reaktion hervor: die Tribalisierung, die Fragmentierung der Gesellschaft in zunehmend in sich selbst abgeschlossene Kleinstgruppen. Aber durch diese Form der Differenzierung und Konkurrenz erfindet ein komplexes adaptives System neue Modalitäten, um seine Umwelt zu verändern. In anderen Worten ist das, was Sie fragen, in meinen Augen richtig. Was Ökonomen eine konstruktive Zerstörung nennen, gehört zur Funktionsweise des Gruppengehirns.
Gruppenselektion und selbstzerstörerische Mechanismen scheinen eine grausame Sache zu sein und schlecht in einen ethischen Standpunkt zu passen. Welche Bedeutung könnte Ethik im Rahmen eines gruppenselektionistischen Zugangs zur Gesellschaft besitzen?
Howard Bloom: Die Natur ist im Sinne des "Teuflischen Prinzips" nicht die gütige Mutter, für die ihre Fürsprecher sie halten. Sie ist vielmehr eine Mutter, die über den Mißbrauch des Kindes jubelt. Ihre Bösartigkeit ist auf so vielen Ebenen in unsere Biologie eingebaut, daß sie nicht nur zu unserer Physiologie, sondern auch zu jeder menschlichen Kultur gehört. Alle Gesellschaften, auch die präkolonialistischen Inuit, die so oft für ihre Friedlichkeit gelobt werden, identifizieren Gruppen von Menschen, die man hassen darf. Der Haß auf Außenseiter als eines der mächtigsten Bande, die eine kulturelle oder subkulturelle Gruppe zusammenhält, wurde von unzähligen wissenschaftlichen Untersuchungen nachgewiesen. Auch wenn dies uns unfreiwillig aufgezwungen wurde, so ist dieser modus operandi doch ethisch verabscheuungswürdig. Infolgedessen ist es für jeden von uns mit einer moralischen Sensibilität eine Pflicht, folgendes zu tun: Rebelliere gegen die Natur und ihre Wege! Beende Gewalttätigkeit, wo immer du kannst! Wenn du einen Straßenraub beobachtest, greife ein (Ich mache das immer ... und ich bin sowohl schwächlich als auch unsportlich)! Wenn du einen Massenmord siehst und es nicht schaffst, ihn zu stoppen, dann bist du hinsichtlich seiner Ausführung ein Komplize. Und das bin ich.
Am wichtigsten ist, auf die dunklen Seiten des eigenen Idealismus und moralischen Gefühls zu schauen. Beides entsteht aus unserem Arsenal natürlicher Instinkte. Und beides degeneriert zu einer Entschuldigung für Angriffe auf andere. Wenn unsere gerechte Empörung in Wut gegen einen "Schurken" umschlägt, werden wir allzu oft zur Beute eines natürlichen Programms von Zähnen und Klauen. Es werden keine Lebewesen vom Mars oder himmlische Weisen kommen, um uns vor unserem eingeborenen Bösen zu retten. Wir müssen die äußere Natur und die in uns bekämpfen, um uns und unser Selbst zu retten.
Aus dem Englischen übersetzt von Florian Rötzer
