Bargeldobergrenzen und Bankengeschäft
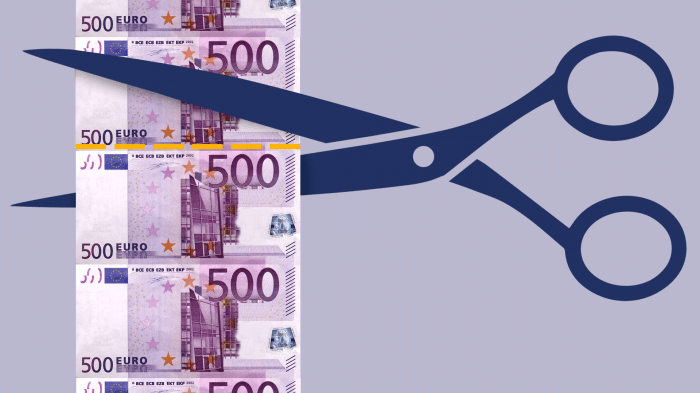
Dass Papiergeld und Münzen nicht vor der Abschaffung stehen, weiß man. Bargeldoberlimits in europäischen Ländern sollten aber vorsichtig beäugt werden
Jeder kennt das: schon das Ansprechen von Geldangelegenheiten stellt zumindest in manchen Situationen - wenn nicht sogar ein Tabu - zumindest ein unbequemes Thema dar, worauf man den Gesprächsgegenstand nur ungern reduzieren möchte. Wenn man dieser Tatsache hinzufügt, dass Bargeld das wohl greifbarste Zahlungsmittel ist (und als Symbol von Wohlstand gelten kann), neigen Gelddebatten oft zur Polarisierung.
Es sei also vorbemerkt, dass Papiergeld und Münzen "selbst im digitalen Zeitalter nach wie vor unerlässlich für unsere Wirtschaft" sind, wie auf höchster Zentralbankebene neulich betont wurde. Unabhängig davon soll dem Thema "Bargeldobergrenzen", die den täglichen Gebrauch von ebensolchen Zahlungsmitteln in einigen europäischen Ländern schon jetzt einschränken, aber kaum geringere Achtung geschenkt werden. Schließlich sind die Abschaffung der 500-Euro-Banknote seitens der EZB gegen Ende 2018 und neulich von Kleingeld (d.h. Ein- und Zwei-Cent-Münzen) in Italien ab 2018 deutliche Zeichen, dass materielle Zahlungsmittel im Fokus der Gesetzgeber sind.
Mit den bereits erwähnten (meistens in naher Vergangenheit eingeführten) Bargeldoberlimits haben sich die jeweiligen Länder in vielen Fällen vorgenommen, Geldwäsche sowie (potenziell) illegale Transaktionen mit der Annahme zu erschweren, dass obskure Geschäfte von schwierigerer Rückverfolgbarkeit von Zahlungen profitieren würden. Dass es dazu auch einer gewissen Instaneität bedarf (die von Bargeld aufgrund dessen Materialität nur schwer ausgehen kann), wird in solchen Debatten aber weniger berücksichtigt.
Nebenbei trifft es also auch zu - wie in verschiedenen Fällen genauso oft argumentiert wird -, dass Bargeld im Vergleich zu den vielfältigen Möglichkeiten der Zahlungsabwicklung (auch größerer Beträge) durch einfachen Rückgriff auf eine beliebige Kreditkarte an Praktizität eingebüßt hat. Was in folgendem Text nichtsdestotrotz zur Sprache kommen soll (und in weiteren Beiträgen des Autors aus diversen Blickwinkeln betrachtet worden ist), soll vor allem die Risikomöglichkeit sein, die von der Einführung von Bargeldeinschränkungen ausgehen könnte, wenn die jeweilige Nationalwirtschaft eine ausgeprägte Präferenz für ebensolche Zahlungsmittel aufweisen sollte.
Noch anderweitiger formuliert: Welchen Effekt könnte man beispielsweise aus der Festlegung einer zu niedrigen Bargeldgrenze erwarten, wenn Individuen sehr an Papiergeld und Münzen hängen würden?
| Obergrenzen zu Bargeldgebrauch in einigen EU-Ländern | ||
| Belgien | 3.000 € | |
| Bulgarien | 9.999 BGN (≈ 5.110 €) | |
| Frankreich | 1.000 € (Ansässige; gewerbliche Nichtansässige) | 15.000 € (nicht ansässige Verbraucher) |
| Griechenland | 1.500 € | |
| Italien | 2.999,99 € | |
| Kroatien | 15.000 € | |
| Polen | 62.220 PLN (≈ 15.000 €) | |
| Portugal | 1.000 € (Transaktionen zwischen Verbrauchern und Gewerbetreibenden) | |
| Rumänien | 10.000 RON (≈ 2.260 €) pro Person/Tag | |
| Slowakische Republik | 5.000 € (business-to-business; consumers-to-business; business-to-consumers) | 15.000 € (natürliche Personen, die ausserhalb ihres normalen Geschäfts handeln) |
| Spanien | 2.500 € (Ansässige) | 15.000 € (Nichtansässige) |
| Tschechische Republik | 350.000 CZK (≈ 14.000 €) pro Tag | |
| Ungarn | 1,5 Millionen HUF (≈ 5.000 €) pro Monat (juristische Personen; Wirtschaftsgesellschaften ohne Rechtspersönlichkeit; für Mehrwertsteuerzwecke registrierte Privatpersonen) | |
Wie vom Autor oft betont, könnten sich Bargeldeinschränkungen in stark papiergeldorientierten Gesellschaften möglicherweise sogar konsumhemmend auswirken. Und dies, egal ob alternative Zahlungsmittel (zu nicht nennenswerten Kosten) verfügbar wären oder - falls man der Annahme folgen sollte, dass Bargeldzahlungen in manchen Fällen illegale Geschäfte verschleiern - man nichts zu verbergen hätte.
Aus verhaltensökonomischer Sicht besteht jeder Kauf nämlich aus einer Vielzahl von Variablen, die sich perfekt fügen müssen, damit dieser auch zustande kommen kann. Jedes Mal, wenn die (immer noch häufig) vorgezogene Zahlungsmöglichkeit (wie eben Bargeld) per Gesetz mit einem Top-down-Beschlussverfahren geregelt wird, sind negative Nebenerscheinungen im Alltagskonsum nicht auszuschließen.
Man könnte das Thema aus etlichen Perspektiven unter die Lupe nehmen - zum Beispiel mit Bezug auf die Entscheidungsfreiheit, den "gläsernen" Bürger, den Beitrag zu weniger Privatverschuldung (wegen der Greifbarkeit der auszugebenden Ressourcen), die mit Herstellung und Ersetzung von Papier- und Münzgeld verbundenen Kosten oder die Instantaneität im alltäglichen Gebrauch. Selbst die Tatsache, dass einige Arten der Bargeldobergrenzen in manchen Ländern zwischen Ansässigen und Nichtansässigen unterscheiden (wobei letztere von höheren Limits profitieren) oder pro Person bzw. Tag gelten, mag fraglich sein. Jede dieser Argumentation weist jedenfalls genauso viele Stärken und Schwächen auf, auf die von Befürwortern gepocht wird und die von Gegnern kritisch beäugt werden.
Auswirkungen auf die Banken
Ein weiterer Aspekt, der ebenso analysewürdig ist (und doch weniger im Fokus steht), sind mögliche Auswirkungen auf Bankenebene. Wie könnten anders formuliert solche Bargeldkappungen beim Bankengeschäft ankommen? Auch in diesem Fall lässt sich wenig mit einem eindeutigen "Ja" oder "Nein" beantworten, da die Wirtschaftswissenschaften schließlich "Sozial-" und keine "Naturwissenschaften" sind.
Zentral- und Geschäftsbanken würden vermutlich über mehr Geldvolumina verfügen, wenn Individuen nicht mehr die gleichen Bargeldbestände (da nur bedingt benutzbar) bei sich halten wollten. Sekundärbanken könnten potenziell über mehr Ressourcen, nämlich die zusätzlichen Geldsummen an nicht in bar abgehobenen Bankendepots, verfügen, um Zahlungen abzuwickeln, Aktien, Obligationen sowie andere Finanzinstrumente zu erwerben oder Kredite zu vergeben.
Wahrscheinlich bekämen selbst Notenbanken bei höheren Bankendepotsbeständen einen größeren Spielraum, um antizyklische Währungspolitik zu betreiben. Die Geldnachfrage (Md) hängt nämlich meistens mit Nominaleinkommen (d.h. Transaktionsvolumina) und gezahlten Zinsen (d.h. Opportunitätskosten der Geldhaltung) nach folgender Relation zusammen:
Md = PYL(i),
wo Md eben die Geldnachfrage, PY das Nominaleinkommen und L(i) die zu erhaltenden Zinsen sind.
Alles gut also? In wirtschaftstheoretischer Hinsicht weiß man aber auch, dass - wenn der Zinssatz hoch ist - der so genannte Kassenhaltungskoeffizient (Geldhaltung/Nominaleinkommen) dann niedrig sein sollte. Wenn der Zinssatz hingegen tief liegen sollte, dann würde eben dieser Kassenhaltungskoeffizient hoch sein. Wenn die Attraktivität von Bargeld aber "künstlich" geschmälert werden sollte, indem dessen Ausgabefähigkeit weiterhin per Dekret beschränkt werden würde, würden Leute bei niedrigen Zinssätzen geringeren Nutzen daraus ziehen, Bargeld (da nur bedingt brauchbar) zu haben.
Individuen würden in Niedrigzinsphasen unnötig vor die Wahl gestellt werden, entweder zu wenig Erträge auf Ersparnisse zu dulden oder an Konditionen geknüpftes Bargeld zu besitzen oder weiter noch nach rentableren (und daher riskanteren) Anlagemöglichkeiten zu suchen. Nichts davon wäre jedenfalls optimal.
Bei Auseinandersetzung mit dem Thema sollte man jedenfalls mit großer Vorsicht vorgehen, weil es kein eindeutiges "Richtig" oder "Falsch" gibt. Jede Analyse im Vorfeld sollte nämlich immer den besonderen Merkmalen von Nationen und deren Sparern gerecht werden, aus denen sich die Vorliebe für materielle versus elektronische Zahlungsmittel insgesamt erklären ließe. Alles Weitere wäre nämlich eine unnötige, selbst auferlegte Einschränkung der positiven Möglichkeiten, die von der Globalisierung ausgehen.
