Wortobergrenze für Wissenschaftler?
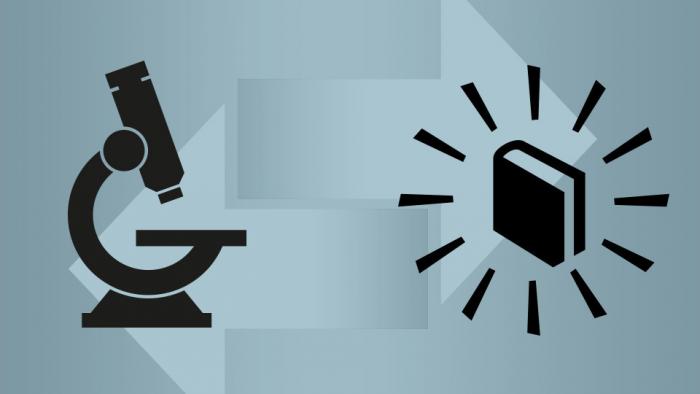
Grafik: TP
Brian Martinson will dem tendenziellen Qualitätsverfall durch den Publish-or-Perish-Effekt entgegentreten
Der am Health Partners Institute in Bloomington im US-Bundesstaat Minnesota tätige Forschungsintegritätsexperte Brian Martinson hat in der neuen Ausgabe der Fachzeitschrift Nature einen Vorschlag gemacht, wie man den tendenziellen Fall der Qualitätsrate im aktuellen Wissenschaftsbetrieb bremsen könnte. Dabei geht er davon aus, dass die Ursache des Übels in einer Quantifizierungskultur besteht, die Akademiker vor allem nach der Zahl ihrer Veröffentlichungen bewertet. Für die Konsequenz aus diesen Effekt, der im Journal of the American Medical Association bereits 1994 beschrieben wurde, hat sich der Slogan "Publish or Perish" ("Veröffentliche oder Verschwinde") eingebürgert.
Dieser Druck hat Martinson Worten nach die Gründe dafür, wissenschaftliche Beiträge zu verfassen, grundlegend verändert. War es früher das "vorrangige Ziel" wissenschaftlicher Autoren, "Wissen zu verbreiten", so wollen sie nun vor allem ihre Publikationslisten verlängern, um ihre Karrieren zu befördern. "Autorenschaft", so Martinson, "ist dadurch zu einer wertvollen Ware geworden". Und weil sie eine Ware ist, geht sie den Weg aller Waren: Sie wird gehandelt, zum Beispiel als Publikationsplatz in Fachzeitschriften, die für die Veröffentlichung dort kein Geld bezahlen, sondern kassieren.
"Schlampereien gefördert, die Forschung verschlechtert und eine offensichtliches Motiv für Plagiate geliefert"
Das hat der Beobachung des Integritätsexperten nach "Schlampereien gefördert, die Forschung verschlechtert und eine offensichtliches Motiv für Plagiate geliefert" (vgl. Prof. Dr. Plagiat). Auf den entstandenen Märkten können Akademiker nicht nur Autorenschaften für Artikel kaufen, die sie nicht selbst geschrieben haben, sondern auch ganze Studien in Auftrag geben, die dann unter ihrem Namen publiziert werden (vgl. Unethische Autorenschaften in den Wissenschaften).
Die Maßnahme, die Martinson zur Lösung dieses Problems vorschlägt, ist von einer Idee des australischen Autors Michael McGirr inspiriert: Der hatte angesichts einer sich weltweit ausbreitenden Logorrhoe mit der Überlegung gespielt, ob man Menschen nicht Wortzähler einbauen könnte, damit sich feststellen lässt, ob und wann ihr Wortausstoß eine vorher festgelegt Obergrenze überschreitet.
Die fünf Millionen Wörter, die McGirr dafür vorschwebten, lägen deutlich oberhalb des vom Linguisten Matthias Mehl an der Universität von Arizona in Tucson errechneten Durchschnittswerts von etwa einer halben Milliarde. Martinson nennt für seine Publikationsobergrenze keine konkrete Zahl und meint lediglich, dass die Grenze für unterschiedliche Fachgebiete unterschiedlich hoch sein sollte.
Vorteile und Nachteile
Zu den Vorteilen einer Wortobergrenze bei wissenschaftlichen Publikationen zählt er neben einem starken Anreiz zur Beschränkung auf das Wesentliche auch einen auf interessantere Themen, weil Forscher sich dann nicht nur fragen müssen, wie viel Zeit, sondern auch wie viele Worte sie ein Projekt kostet. Und mit Blick auf seine eigene Publikationsliste meint der Integritätsforscher selbstkritisch, dass er manchmal vielleicht wichtigeren Fragen nachgegangen wäre, wenn es eine Wortobergrenze gegeben hätte.
Potenziell würde so eine Grenze seiner Meinung nach nicht nur deshalb zu höherer Qualität führen, weil Wissenschaftler dann mehr Zeit hätten, sondern auch, weil sie das knappe Gut Publikationsplatz nicht für Studien verschwenden wollen, die widerlegt oder anderweitig diskreditiert werden. Das würde dem Druck, etwas schnell zu veröffentlichen, ein Gegengewicht entgegensetzen. Martinsons Erwartung nach würde sich auch die Lesbarkeit der Texte verbessern, weil Autoren ohne lange Umschweife auf den Punkt kämen, um keine wertvollen Worte zu verschwenden.
Auswahlkomitees zur Besetzung von Stellen würden Martinsons Einschätzung nach bei der Evaluation von Kandidaten weniger auf bedingt aussagekräftige Kriterien wie die Länge der Publikationsliste achten, sondern die Texte der Bewerber häufiger wirklich lesen. Darüber hinaus erwartet der Amerikaner eine Entlastung der heute aus Zeitmangel häufig recht schnell und wenig gründlich erledigten Peer Reviews, die seiner Ansicht nach deutlich mehr Spaß machen würden, wenn die Rezensenten wieder mehr Zeit hätten, sich den Rezensionsobjekten zu widmen, da es dann weniger davon gibt.
Potenzielle Probleme ergeben sich seinen Überlegungen nach dadurch, dass - vor allem im Bereich Medizin - Studien unpubliziert bleiben werden, wenn sie nicht die gewünschten Ergebnisse bringen. Diesen Effekt gibt es bereits heute, wenn Pharmaunternehmen solche Forschungen durchführen (vgl. Tamiflu - und raus bist Du). Auch Zweifel und Einschränkungen könnten unter den Tisch fallen. Dieser Effekt ließe sich Martinsons Ansicht nach zumindest verringern, wenn man Wort-Boni für sorgfältige Interpretationen und genau beschriebene Methoden gewährt.
