Im Holocaust-Gedächtnis-Zentrum
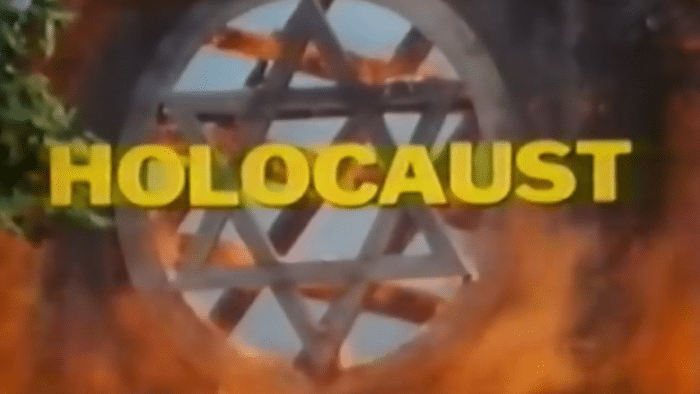
Holocaust-Serie. Screenshot: TP
Stefan George, Karl Wolfskehl, eine Serie, und Juden in Neuseeland
Unlängst erhielt ich eine Einladung ins Holocaust Centre in Wellington, Neuseeland. Kurz zuvor war ich schon bei einer Karl Wolfskehl-Feier im lokalen Goethe-Institut gewesen.
Der zeitliche Zusammenfall zwischen diesen beiden Ereignissen war eher zufällig. Wolfskehl war ein Lyriker aus dem Umfeld des Dichters George — nicht etwa George the Poet, wie man heutzutage leicht meinen könnte —, sondern Stefan George, dem Gründer jener poetischen Päderasten-Vereinigung, dem sogenannten "George-Kreis", dessen oberstes Ziel offenbar, Jahrzehnte vorher, "der ungeheuerliche Versuch [gewesen war], die Päderastie mit pädagogischem Eifer zur höchsten geistigen Daseinsform zu erklären", so Wikipedia.
George starb Ende 1933, aber schon zu Beginn des Jahres waren die Nazis in Deutschland ans Ruder gekommen - und kurze Zeit darauf begann die Verfolgung aller irgendwie ethnisch, sexuell oder politisch anders gepolten Menschen.
Ob Wolfskehl schwul war oder Neigungen zur Päderastie hatte, lässt sich für mich nicht eruieren, aber es besteht kein Zweifel daran, dass er Jude war und 1938 in Neuseeland politisches Exil suchte und fand. Bis zu seinem Tod 1948 lebte er hier, in der damals noch phantastischen Gartenstadt Auckland. Er schrieb Briefe und Gedichte, alle ohne einen für mich irgendwie erkennbaren Zeitbezug. Das heißt, er lebte, wenn auch in geographischer Ferne, mitten in der Zeit des Holocausts, aber er erlebte ihn nicht, reflektierte ihn nicht, schien als "Schöngeist" an diesem Horror vorbei zu schweben.
Der bedeutendste deutsche Lyriker, der je in Neuseeland gelebt hat
Trotzdem war er der bedeutendste deutsche Lyriker, der je in Neuseeland gelebt hat. Als Jude war er natürlich Opfer der Verhältnisse, ein paar Verszeilen von ihm zieren heute das Eingangsportal des jüdischen Museums in Wien.
Und ich bin dankbar für die beiden Bücher, die hier jetzt erschienen sind, die übersetzten Briefe und die zweisprachigen Gedichte, die ich mir selber kaufte, mit eigenem Geld und aus eigenen Stücken; ich schulde also niemandem eine Gefälligkeitsrezension, auch wenn die Briefe von meinem Freund und Übersetzerkollegen Nelson Wattie ins Englische gebracht wurden. Ich bin überzeugt, diese beiden Bände werden über kurz oder lang die Vorlage für einen neuseeländischen Film liefern. Das Interessante an Wolfskehl ist ja weniger die Literatur, die er hervorgebracht hat, als die Gestalt des Mannes selber: einer gewaltigen Zwei-Meter-Erscheinung eines Darmstädters, der auch mit 70 noch in Begleitung von —- zwei — jungen Frauen fotografiert wurde.
Wer weiß, ob er im wirklichen Leben jüdische Trauergesänge anstimmte? Der Filmheld Wolfskehl hat jedenfalls den richtigen Namen dafür, um wortlose Nigundln — jüdische Gesänge ohne Texte — hervorzubringen, zu vokalisieren, aus der Kehle des Wolfes - und manche seiner Gedichte wirken wie Gesangsverse. Songtexte, zu denen man die Melodien nur noch nicht gefunden hat.
Diese Gestalt Wolfskehls, seine Stimme, ging unter im Publikum des Goethe Instituts, vor rund 50 Besuchern über 70, gut bedient mit Wein und Canapes, Kleinsthappen am Zahnstocher, bei Lesungen ohne Mikrofon, in einem schallschluckenden Empfangs-Großraum.
Historisches, verpackt in die Geschichte einer Familie
Dann, ein paar Tage später fand ich mich im Holocaust Centre wieder. Ich dachte irrtümlich, ich sei zur Eröffnung des Zentrums geladen, denn von seiner Existenz hatte ich bis dato noch nichts vernommen. Aber nein — es war das zehnjährige Jubiläum seines Bestehens. Gegründet 2007, war es also auch so schon arg verspätet dazu gekommen — eine Ewigkeit nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, nach Gründung des Staates Israel, oder nach jener TV-Serie, Holocaust, die 1978 dieses Wort als Allgemeinbegriff für die Massenvernichtung der Juden in die Welt gesetzte hatte.
Die Seventies waren die Zeit der großen Immigrantenromane. Historisches, verpackt in die Geschichte einer Familie, deren "Roots" in Afrika waren, deren "Pate" an Sizilien gemahnte. Marlon Brando musste sich für seine Lebensrolle nur ein paar Papierservietten in die Pausbacken knüllen.
Jüdische Geschichten hatten Hollywood von Anfang an beglückt, aber die Geschichte der Judenverfolgung in der Nazi-Zeit hatte sich bis eben noch als Kassengift erwiesen. Dass das Thema unter einem griffigen Markennamen zu einem erfolgreichen eigenen Genre avancieren könnte erkannte man erst nach Steven Spielbergs "Schindlers Liste" (1993.)
Den Auftakt dazu lieferte - eher unscheinbar - eine holzschnittartige Billig-Serie im US-Fernsehen, die sich qualitativ noch um etliche Grade unterhalb beispielsweise eines deutschen "Tatort"-Niveaus bewegte. Selbst wenn man, aus heutiger Sicht, auf Darsteller wie Meryl Streep oder James Woods verweisen möchte — so standen diese doch hier, 1978, noch am Anfang ihrer Karrieren und führten nur ein trauriges Ensemble drittrangiger Darsteller an, die schwerfällig ihre Texte "live" ins Mikrophon sprachen, ganz ohne modernes Foley, ohne jedwede Nachsynchronisation im Studio.
Holocaust, Holokaust und Sho'ah
"Holocaust" war bis dahin das englische Wort für "Feuersbrunst" oder "Inferno" gewesen. Mit der jüdischen Massenvernichtung durch die Nazis und ihre verschiedenen Helfersgruppen war es in Deutschland noch nicht in Verbindung gebracht worden, selbst wenn die Krematoriumsöfen mit ihrem spezifischen Aroma zum deutschen Alltag der Nazizeit gehörten und noch bis in die späten Sechzigerjahre etwa im Bonner Raum an Regentagen mit dem "spaßigen" Hinweis, "et riescht mal widda nach Krematorium" quittiert wurden. (Wenn es sich in Wirklichkeit nur um die Dämpfe der Süßwarenfabrik in Friesdorf handelte.)
Vor allem war das Wort noch nicht international als automatisches Synonym, oder als Hauptbezeichnung für die nationalsozialistische Massenvernichtung von Juden verwendet worden.
Die Erinnerung an die TV-Ursprünge des Wortes aus dem Jahr 1978 sind verblasst. Fast jeder Erwachsene, der heute auf der Welt lebt, meint, das Wort "Holocaust" habe es schon immer gegeben und es könne legitim auf jeden großformatigen Genozid aufgeklebt werden - sei es die Ermordung der Armenier durch die Türken, die Ermordung der Ziganen durch die Nazis, die Ermordung der Kongolesen durch das belgische Königshaus und so weiter.
Tatsächlich ist die Mini-Serie "Holocaust" verschwunden, auch wenn sie nach wie vor auf Youtube komplett zu sehen ist.
Geblieben ist von ihr lediglich der Markenname, der sich international durchgesetzt hat. "Holocaust", im Deutschen heute öfters auch mit "k" geschrieben, bezeichnet als solchen allerdings ausschließlich den Genozid an den Juden.
Die historische Begriffserklärung bei Wikipedia würde es theoretisch zulassen, das Wort auf alle solchen Gräuel anzuwenden. Fakt bleibt jedoch: Wenn man die grauenvollen Massenmorde an anderen Menschen anderer Völker als "Holocaust" bezeichnet, erfährt man bald, dass man dafür ein anderes Wort finden muss.
In Palästina bediente man sich bereits ab 1943 des Begriffs "Sho'ah", als Kennzeichnung einer vom Himmel (d.h., von Gott) gesandten Plage gegen das jüdische Volk, vergleichbar der im Alten Testament erwähnten Heuschreckenplage, die somit auch den Holocaust als spezifisch jüdisches Schicksal markierte. Als solches lieferte der Holocaust dann zugleich den Eckstein, die religiöse Definition, für die Errichtung eines jüdischen Staates Israel in Palästina.
Ich bin gewissermaßen ein solcher Shabbes-Goy
So weit, so unlogisch. Mein Interesse am Holocaust stammte jedoch von Anfang an aus einer anderen, nicht religiös diktierten Beobachtung. Mir war nämlich aufgefallen, dass überall dort, wo ein Holocaust Centre fehlte, wo es kein jüdisches Museum gab, das öffentlich allen Menschen eines Landes Zutritt gewährte, dass sich dort geradezu automatisch der Antisemitismus ausbreitete.
Auch in Wien wäre die ganze Chose, wie sie jetzt ungebremst aus den Schienen hüpft, sicherlich noch schneller, noch früher, noch weiter nach Rechts abgerutscht, hätte es nicht schon lange ein Jüdisches Museum gegeben. In all den früher real-existent sozialistischen Ländern, inklusive DDR, Polen, Ungarn, Rumänien, hatte der niedergetretene Faschismus frische Wurzeln, Nachtschattengewächse des Judenhasses, des Fremdenhasses, des Tötungswillens, des "Fidschisklatschens" hervorgetrieben. Einzig in Polen hatte man es verstanden, wohlhabende amerikanische Touristen nach Krakau zu locken und ihnen dort den Sänger Theodore Bikel — noch mit 90 Jahren — live zu präsentieren.
Ich sandte also umgehend mein RSVP an das Holocaust Centre — per Email, denn telefonisch hob niemand ab. Ich kam dann auch verspätet per Taxi — der Taxifahrer hatte noch nie davon gehört, dass es hier eine solche Einrichtung gäbe (Baustellen blockierten zusätzlich die Anfahrt) — und fand mich vor verschlossenen Türen, extra-soliden Türen, als ob man einem Panzer den Einlass verwehren wollte.
Drinnen saßen rund 20 ältere Leute, oft schon um die 80, einst Kinder oder Enkel von Holocaust-Überlebenden, jetzt teils im Rollstuhl, teils schon artikulationsunfähig. Auch hier wieder die schreckliche Akustik, die wahrscheinlich aus der landesüblichen Isolierung mit Holzwolle-Dämmplatten herrührt. Man gratulierte sich zum 10jährigen Bestehen.
Ich lauschte aus unmittelbarer Nähe den Ausführungen zweier Chefs des Unternehmens, ohne akustisch allzu viel zu verstehen. Nach der Veranstaltung dann die Tasse Tee und kleine Schnabuliereien, koscher und "bio". Und an mich die altgewohnte Frage, ob ich nun eigentlich selber Jude sei?
Dazu musste ich dem Chef des Zentrums, Steven, einst als 9jähriger Istvan aus Ungarn hier eingetroffen, Folgendes sagen: "Du kennst die gute alte Sitte religiöser Juden, am Samstag kein Radio, keinen Ofen, und nicht mal das Fernsehen anzuschalten. Wenn man doch Radio hören will, muss man einen nichtjüdischen Nachbarn, einen Goy, herüber bitten, damit er das Radio oder die Mikrowelle betätigt. Den Nachbarn, der diese kleinen Dienstleistungen vollführt, nennt man einen Shabbes-Goy. Ich bin gewissermaßen ein solcher Shabbes-Goy."
Es war mir klar, dass man, bevor man meine Einladung ins Zentrum bestätigte, auch bei der Polizei oder sogar beim Geheimdienst nach meinem Leumund gefragt hatte. Auf alle Fälle war ich Steven bereits bei der Buchpräsentation im Goethe-Institut aufgefallen, nicht zuletzt deshalb, weil ich mich nie zur Rede melde, ohne auch meinen Namen zu nennen.
Wie ich nun mit diesen alten Menschen in einem hermetisch abgeschlossenen Raum beisammen stand, spürte ich die Angst, die Befürchtung, dass irgendein Fremder sich als Freund ausgeben und dann als todbringender Feind entpuppen könnte.
Ausdruck und Objekt einer Gefährdung
Neuseelands Juden, zum Gutteil aus England stammend, sind traditionell extrem zurückhaltend. Sie versuchen, unsichtbar zu bleiben, vor allem als Juden unerkannt. Ich habe es schon erlebt, dass mir jemand nach einem längeren Gespräch oder einer längeren Bekanntschaft, das eh Offensichtliche fast flüsternd gestand: "We are Jewish, you know."
Den deutschen Juden gegenüber kam man damals, als sie gelegentlich hier eintrafen, extrem reserviert entgegen, weil man den Unterschied zwischen deutschen Juden und nichtjüdischen Deutschen oft nicht erkennen konnte.
So kommt es, dass man natürlich auch heute noch Angst davor hat, Kinder irgendwelcher Schulklassen ins Zentrum einzuladen, außer wenn es ohnehin jüdische Kinder sind. Man stelle sich nur einen Anschlag vor, bei dem beispielsweise 30 nichtjüdische Kinder ums Leben kämen. Der stets latent flackernde Antisemitismus im Lande würde vermutlich tatsächlich zu einem Inferno aufflammen.
Das Holocaust Centre ist somit Ausdruck einer Gefährdung und zugleich Objekt einer Gefährdung. Es verlangt nach einer kompletten architektonischen Umgestaltung, nach einer größtmöglichen Sicherung und der Wahrnehmung seiner Selbst als eines jüdischen Medienzentrums für das 21. Jahrhundert.
Die Bücher, die es hier gibt, stehen ungreifbar jenseits der Reichweite von Kinderhänden, sie dürfen auch nur hier gelesen werden. Ob es Zweitkopien in der Stadtbibliothek gibt? Darüber hatte man keine genaue Kenntnis.
Nichtjüdische Kinder aus normalen Schulklassen werden hierher offenbar seltener eingeladen - und ein Holocaust-Zweitzentrum in der städtischen Bibliothek, das auch über Genozide an anderen Menschen anderer Länder informieren würde - Indonesien, Ost-Timor, Laos, Abessinien - scheint für die jüdische Gemeinde in Wellington keine Priorität zu besitzen.
Bevor ich mich verabschiede, erzähle ich Steven noch, dass ich Linda P. kenne, die letzte Jiddisch sprechende Frau in Wellington. Immer wenn jüdische Touristen aus aller Welt vor der Stadthalle dem Bus entsteigen, werden sie von Linda auf Jiddisch begrüßt. Jiddisch ist, wie man sieht, immer noch eine internationale Sprache jüdischer Verständigung.
Steven erzählt mir, man habe auch hier, im Holocaust-Zentrum, eine große Menge, sicher über 500 Bücher, auf Jiddisch gehabt, alle mit hebräischen Buchstaben gedruckt. "Zum Schluss wussten wir nicht mehr, wohin damit. Wir mussten sie alle wegschmeißen," sagt er. Oh, denke ich. Schade, dass ich davon nichts gewusst habe. Ich hätte ihnen gerne bei mir zuhause einige Regale freigeräumt.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
