Denken first, Digitalisierung second!
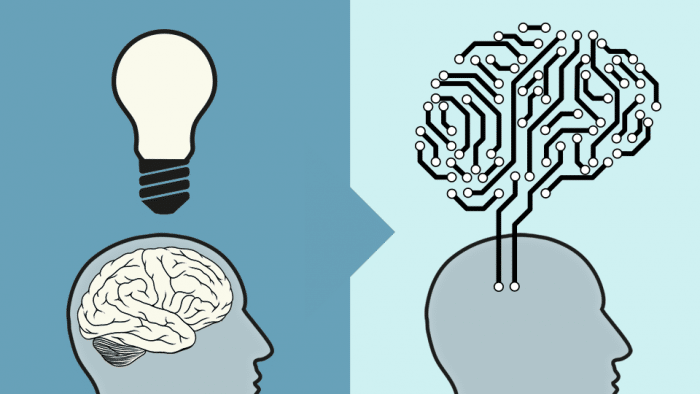
Big Data, Bildung und Kontrollgesellschaft
"Smarte grüne Welt?" heißt das jüngst erschienene Buch der Sozialwissenschaftler und Ökonomen Tilman Santarius und Steffen Lange. Faktenreich dokumentieren sie darin, dass die "schöne neue Welt" der Digitalisierung weder aus einer immateriellen "Cloud" besteht noch zwangsläufig zu ressourcenschonenderen Wirtschaftspraktiken, sondern bisher nur zu einem weiter steigenden Energie- und Ressourcenverbrauch führt. Allein der Stromverbrauch von Informations- und Kommunikationstechnologien (IKT) könnte bis 2030 von heute bereits zehn Prozent auf 30 oder gar 50 Prozent des globalen Gesamtverbrauchs anwachsen. Und zur Herstellung all der "smarten Dinge" unseres jetzigen und zukünftigen Alltags sind wiederum riesige Mengen an Rohstoffen wie Kupfer, Silber oder Aluminium erforderlich. Als eines der Leitprinzipien für eine "nachhaltigere Digitalisierung" fordern Santarius und Lange deshalb "digitale Suffizienz" - also etwa auch einen sparsameren Umgang mit der Sammlung und dem Gebrauch von Daten.
In Zeiten, in denen Gesellschaften weltweit der Faszination wachsender Möglichkeiten der Informations- und Kommunikationstechnologien wie im Rausch erliegen und Experten und Politiker in Deutschland einhellig zu "mehr und schnellerer" Digitalisierung mahnen, klingt eine solche Forderung - so richtig sie prinzipiell wohl ist - fast weltfremd und auch wenig attraktiv.
Bei einer Diskussion über das Buch in Berlin mit Santarius, der Informatikerin Ina Schieferdecker und dem Soziologen Harald Welzer fühlte sich Schieferdecker, Gründungsdirektorin des "Weizenbaum-Instituts für die vernetzte Gesellschaft", einer der drei großen neuen Forschungseinrichtungen zur Digitalisierung in Berlin, darum gleich bemüßigt, das Plädoyer für "Datensuffizienz" zu relativieren. So erklärte sie, dass es im Rahmen der Stadtplanung für Berlin ein "riesiges Problem" sei, dass man nicht auf aktuelle, sondern nur auf fünf Jahre alte Datensätze zurückgreifen könne, weshalb für eine gelungene Stadtentwicklung dringend mehr und nicht weniger Daten gebraucht würden.
Diese Aussage ist in vielfacher Hinsicht ein gutes Beispiel, um wesentliche Punkte der Digitaldebatte etwas näher zu betrachten. Denn man könnte dem zunächst entgegenhalten, dass es sich mit der Nachhaltigkeit gerade umgekehrt verhält: Das Problem moderner Gesellschaften besteht hierbei nicht in einem Mangel an Wissen ("Daten"), sondern darin, dass man vom umfänglichen Wissen um den bedrohten Zustand der Biosphäre nicht zum Handeln gelangt.
Bezüglich einer nachhaltigeren Stadtentwicklung etwa ist das Konzept der "autofreien Stadt" - für das in der Diskussion Santarius und Welzer plädierten - schon lange vor dem Internet und Big Data entwickelt worden. Um zur Erkenntnis zu gelangen, dass eine nicht mehr primär auf motorisierten Individualverkehr ausgerichtete Stadt sowohl eine nachhaltigere als vielleicht auch lebenswertere Stadt wäre, bedarf es prinzipiell also überhaupt keiner neuen Daten. Vielmehr bräuchte es zuerst eine politische Debatte über Inhalte, Ziele und Folgen von Big Data und Digitalisierung. Oder allgemeiner gesagt: Bevor man alles mit allem vernetzt, müsste man sich erstmal darüber verständigen, an welchen Werten die Organisation von Gesellschaft ausgerichtet werden soll - und wie es dann etwa gelingen kann, Nachhaltigkeit und (Generationen-)Gerechtigkeit innerhalb eines Wirtschaftssystem wirksam werden zu lassen, das bei der Verwirklichung dieser Werte bis jetzt offensichtlich strukturell versagt. Wäre dies die Reihenfolge der Debatte, würde nämlich kenntlich werden, dass es bei der Digitalisierung primär nicht um technische, sondern um Werte-, Macht- und Verteilungsfragen, ja um die grundsätzliche Struktur des ökonomischen und politischen Systems geht.
Zur technisch-praktischen Implementierung von beispielsweise nachhaltigeren Mobilitätskonzepten wie einer "intelligenten Vernetzung" von ÖPNV, Auto- und Fahrradsharing können Daten und Digitalisierung dann wiederum einen - oder gar den - entscheidenden Beitrag leisten. Doch hierfür müsste eben erstmal der politische Wille existieren, solche Konzepte auch umsetzen zu wollen. Bezüglich der Erhebung und Bewertung von Daten wäre deshalb zunächst zu fragen: Wer erhebt und bewertet welche Daten wie und warum (mit welchem Ziel)?
Die "Silicon-Valley-Ideologie" hinter der Propagierung von "Smart Cities" und einer "smarten Gesellschaft" vertritt schlicht den Satz: Je mehr Daten gesammelt werden - die dann von immer schlaueren Algorithmen geordnet und bewertet werden -, desto effizienter (und damit "besser") lässt sich die Organisation von Gesellschaft "wie ein Radio" (Morozov) einstellen. In der Extremvorstellung wird die Organisation der Gesellschaft dann zu "sozialer Physik", zu einer (technischen) Frage der Ingenieurskunst.
Will man die Debatte politisch aufladen, müssten im Kontext von Big Data deshalb nicht allein Fragen der Privatsphäre und des Datenschutzes, sondern auch weitere strukturelle Merkmale und Zusammenhänge der "Datafizierung" der Welt in den Blick genommen werden. Dabei gilt: Die messbare Seite der Welt ist nicht die Welt, und die Messung der Welt ist auch nicht zwangsläufig ein wertneutrales Abbilden einer "objektiven Realität", sondern oftmals ein performativer Akt, durch den bestimmte Weltbeziehungen erst neu entstehen beziehungsweise verstärkt und legitimiert werden.
Der Soziologe Steffen Mau hat diesen zentralen Zusammenhang in seinem Buch "Das metrische Wir" eindrucksvoll analysiert. In den Worten Maus stellen Daten nicht notwendigerweise "Repräsentationen der Wirklichkeit", sondern vielmehr oft "Repräsentationen von Wertigkeitsordnungen" dar. Oder anders ausgedrückt: "Zahlen zeigen Wert nicht nur an, sie teilen ihn auch zu."
Besonders gut lässt sich dies am Beispiel der Ratingagenturen zeigen. Deren Bewertung, wie kreditwürdig ein Land ist oder nicht, hängt von Faktoren ab, die sicherlich nicht wertneutral sind, sondern gewisse politische und ökonomische Ideen und Prinzipien repräsentieren - zumal die maßgeblichen Ratingagenturen keine öffentlichen Einrichtungen, sondern private Unternehmen im Eigentum von Banken und anderen Finanzmarktakteuren sind. So könnte man beispielsweise annehmen, dass Privatisierungen und Deregulierungen des Finanzmarktes von den Ratingagenturen als positiv für das Rating eines Landes bewertet werden. Damit setzen sie nicht nur Anreize für ein bestimmtes staatliches Handeln oder Nichthandeln, sondern durch ihre Bewertungskriterien ergeben sich zudem selbst verstärkende Effekte: Wenn ein Land die Kriterien nicht erfüllt oder ihnen nicht genügt - also etwa entsprechende "Strukturreformen" nicht durchführt -, bekommt es ein schlechteres Rating und dadurch teurere Kredite, die wiederum schwieriger zurückgezahlt werden können, wodurch sich das Rating wiederum verschlechtert und neue Kredite noch teurer werden usw.
Diesen Effekt zeigt Mau auch am Beispiel des Bildungssystems. Denn Universitäten befinden sich mittlerweile ebenfalls im Wettbewerb verschiedener Rankings. Wer besser gerankt ist, erhält mehr Fördermittel, mehr (oder "bessere") Studenten und Dozenten, mehr Aufmerksamkeit und hat damit wiederum größere Chancen, seine Position innerhalb des Rankings weiter zu verbessern, während es für andere Mitbewerber entsprechend schwieriger wird - ein Phänomen, das schon in der Bibel mit dem Satz "Wer hat, dem wird gegeben" beschrieben wurde und in der Soziologie deshalb auch als "Matthäus-Effekt" bezeichnet wird.
Hinzukommt, dass sobald sich ein solches Ranking als Maßstab etabliert hat, die Faktoren, die zur Einstufung innerhalb des Rankings führen, nicht mehr hinterfragt werden oder gar nicht hinterfragt werden können, weshalb sich die Universitäten den beim Ranking zugrunde gelegten Faktoren unterwerfen müssen, wenn sie im Ranking nicht herabgestuft werden wollen. Was schon Max Weber als grundsätzliche Anforderung an das Individuum im Kapitalismus erkannte, gilt somit nun auch für Universitäten: "Wer sich in seiner Lebensführung den Bedingungen kapitalistischen Erfolges nicht anpaßt, geht unter oder kommt nicht hoch."
Ein diesen Zusammenhängen zugrunde liegendes strukturelles Merkmal der sich ausbreitenden Vermessung und Bewertung der Welt ist dabei, dass Messungen Vergleichbarkeit schaffen, wo vorher keine war, und damit auch Wettbewerb, wo vorher keiner war. Es entstehen so genannte "Quasimärkte", auf denen nicht der Preis eine Leistung anzeigt, sondern ein Rating oder Ranking. Und als Folge werden Lebensbereiche, die einst von einer Markt- und Wettbewerbslogik ausgenommen waren, (unfreiwillig) in diese miteinbezogen. Gemessen wird dabei zudem immer nur, was auch gemessen werden kann. Die Messungen werden dann aber wiederum zum Maßstab für das Handeln der gesamten Organisation, so dass andere, nicht messbare Kriterien verstärkt ins Hintertreffen geraten. Obwohl diese nicht messbaren Kriterien womöglich viel wichtigere Werte und Mittel zum Erreichen bestimmter Ziele repräsentieren.
Die entscheidende Frage ist deshalb die eingangs gestellte: Wer misst was, wie und warum? Und wenn mehr Wettbewerb Folge der Messungen ist: Ist Wettbewerb in allen Gesellschaftsbereichen überhaupt wünschenswert? Am Beispiel der Universitäten: Inwiefern sind Lernerfolge, inwiefern ist Bildung überhaupt messbar? Spielen hierbei nicht eine Reihe "weicher Faktoren" eine wesentliche Rolle, die vielleicht gar nicht (oder noch nicht) messbar und auch nicht objektivierbar sind? Hängt es nicht ganz individuell von jedem Einzelnen und dessen Voraussetzungen, Zielen und Wünschen ab, was für diesen einen "Lernerfolg" bedeutet?
Das neue digitale Kontrollregime verspricht zwar gerade im Bildungssystem genau das: Wenn jeder Lernschritt jedes Einzelnen von Lernsoftware digital überwacht wird, ist auch jeder Lernprozess ganz individuell steuerbar und "optimierbar". In einigen Fächern mögen solche neuen digitalen Mittel auch durchaus hilfreich und nützlich sein. Aber sie sind eben Mittel und kein Zweck an sich. Deshalb wäre auch hier erstmal zu fragen: Was sollen überhaupt die Inhalte und Ziele von Bildung sein? Ist die geplante Totalüberwachung in der Schule zum Beispiel ein geeignetes Mittel zur Charakterbildung? Lassen sich dadurch auch Eigenschaften wie Empathie, Ausgeglichenheit, Geduld, Selbstvertrauen, Kreativität, eigenständiges und kritisches Denken oder allgemeiner gesagt auch emotionale Intelligenz und soziale Kompetenz ausbilden? Oder schafft ein solches Kontrollregime einen noch höheren Konkurrenzdruck und damit verstärkt auch Ängste, Missgunst und Egoismus?
All dies gälte es zumindest erstmal zu bedenken, bevor man gedankenlos auf allen Kanälen "digital first" plärrt und aufgeregt davor warnt, bei der Digitalisierung "den Anschluss zu verlieren". Dann könnte man nämlich auch zu dem Ergebnis kommen, dass es genau jene genannten Eigenschaften und Kompetenzen sind, derer es bedarf, um im 21. Jahrhundert Gesellschaft positiv zu gestalten, und dass zu ihrer Förderung vielleicht ganz andere Maßnahmen nötig sind, als Lehrer durch Computer zu ersetzen. Denn in einer Welt, in der zum einen Roboter und Rechner immer mehr Arbeit übernehmen (werden) und zum anderen die gewaltige Herausforderung wartet, den Planeten für menschliches Leben noch bewohnbar zu erhalten, braucht es vielleicht gerade kein roboterhaftes Denken, sondern eben Kreativität, kritischen Verstand und emotionale Intelligenz.
Zu bedenken gilt dabei noch ein weiterer Effekt der "Ausweitung der Wettbewerbszone": Durch die Ausrichtung an Zahlen, Rankings und Ratings verwandeln sich Weltbeziehungen zunehmend in "Um-zu-Beziehungen". Im Bildungssystem wird dies bereits seit langem (mit zweifelhaftem Erfolg) praktiziert: Gelernt wird oft nicht um etwas zu lernen, sondern um eine gute Note zu erhalten. Als extremstes (und dystopisches) Szenario für eine Gesellschaft, in der man nichts mehr um seiner selbst willen sagt oder tut, sondern nur noch wegen Aussicht auf Belohnung oder Bestrafung, in der also aus intrinsischen ausschließlich extrinsische Motive werden, darf das in China geplante "Sozialkredit-System" gelten. Mit diesem soll künftig sämtliches Handeln einer Person nach staatlich definierten Kriterien erfasst und bewertet werden. Politik würde so tatsächlich zu "sozialer Physik" - einem totalitären Kontrollregime.
Möchte man ein solches verhindern, müsste deshalb neben der Durchsetzung rechtlicher Maßnahmen für einen effektiven Datenschutz auch eine gesellschaftspolitische Debatte darüber geführt werden, welche Lebensbereiche von Wettbewerb ausgenommen werden sollen und wie ein kultureller Wandel geschehen könnte, der die Frage nach dem Lebenswerten in den Mittelpunkt stellt - als Gegenspieler zu einer technisch-utilitaristisch-instrumentellen Vernunft, die die Welt zunehmend in Zweck-Beziehungen einteilt und verwandelt.
Wie Hartmut Rosa in seinem jüngsten Buch "Resonanz" gezeigt hat, realisieren sich Momente des Glücks gerade nicht in einem Modus des "um zu", sondern in Momenten der Zweckfreiheit, in Momenten ohne Absicht, in Momenten, in denen wir Kontrolle abgeben und ergriffen und berührt werden. Je mehr wir uns bedingungslos an Big Data, die dahinter stehenden (Macht-)Interessen und den heiligen Gral der Effizienz ausliefern, desto mehr könnten wir womöglich jene Momente der Resonanzerfahrung verpassen oder gar verlernen, sie zu erleben.
Dies betrifft nicht zuletzt auch das Lernen. Denn Lernen geschieht am "nachhaltigsten" oft gerade nicht durch "Instant-Gratifikationen" auf dem schnellsten ("effizientesten") Weg, sondern durch intrinsische Motivation, durch Freude am Lernen an sich - ohne dahinter eine Belohnung zu erwarten oder eine Bestrafung zu befürchten. Und ebenso gilt, dass man aus Fehlern, aus Scheitern, aus Erfahrungen und mit dem Durchschreiten von Widerständen lernt. Eine Gesellschaft, die jedoch alle Unebenheiten, Verirrungen, Widrigkeiten, Zufälle, Mehrdeutigkeiten und Hindernisse schon im Vorhinein eliminieren will und jeden Schritt ihrer Mitglieder überwacht, kontrolliert und in Wettbewerb zu einander setzt, zerstört Solidarität und erzieht zu Konformität statt Kreativität. Nicht zuletzt könnte sie so auch verlernen - zu lernen.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
