Ohne Emotionen geht gar nichts, aber mit Emotionen geht längst nicht alles
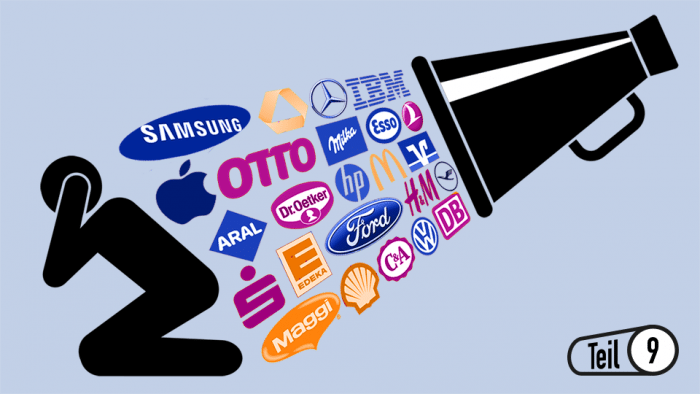
Wie Werbung wirklich wirkt - Teil 9
Teil 8: Von hinten herum durchs Knie mitten ins Unterbewusstsein
Alle Praktiker und Theoretiker sind überzeugt, emotionale Werbung sei der Weisheit allerletzter Schluss. Wenn sie wirken will, muss Werbung Emotionen ansprechen. Das leuchtet auf den ersten und vielleicht sogar auf den zweiten Blick noch ein.
Auch Waschmaschinen, Computer und kompliziertes technisches Gerät werden heute emotional beworben. In gesättigten Märkten sorgen emotionale Erlebniswerte für eine Strategie der Abhebung von der Konkurrenz. Die Abnehmer nehmen Qualitätsunterschiede kaum noch wahr. Häufig ist das produktbezogene Interesse gering.
Doch die emotionale Dauerberieselung verfehlt in der Masse oft genug ihre Wirkung. Die pausenlose Emotionalisierung stumpft ab, zumal wenn man als Konsument über die konkreten Eigenschaften eines Produkts rein gar nichts mehr erfährt. Man kann ja schließlich nicht 24 Stunden am Tag Leuten beim Jubilieren zuschauen, und selbst dauernd jubilieren kann man erst recht nicht.
Als sich die Überzeugung durchsetzte, Werbung solle vor allem das "Emotionale" betonen, brach das lange Jahrzehnt der fröhlich am Karibikstrand umhertanzenden Bacardi-Menschen aus.
Das beruhte indes auf einem ausgesprochen blöden und eher peinlichen Denkfehler: Die Werbefritzen glaubten allen Ernstes, "große Emotionalität" bestehe darin, dass lauter alberne Deppen halbnackt und angeschickert an einem Traumstrand herumhopsen - so wie sich Lieschen Müller wohl das perfekte Urlaubsglück herbeifantasiert.
Die Psychologie hatte jedoch ganz etwas anderes herausgefunden: Emotion ist immer wichtig, um das Gehirn in Gang zu bringen. Das ist aber nicht besoffenes Gehampel im Urlaub, sondern zum Beispiel die einfache Freude daran, eine mathematische Aufgabe zu lösen. Durch gefühlloses Rechnen ohne innere Beteiligung kommt kein noch so kühler Kopf auf die Lösung. Er oder sie muss sich schon dafür begeistern. Emotional ist die Begeisterung für die Lösung, nicht jedoch der Suff am Strand voller Halbnackter.
Das haben die Werbefuzzis noch immer nicht kapiert, sie merkten aber wohl, dass es am Ende so viele Werbespots mit fröhlich hampelnden Halbnackten gab, dass man nicht mehr unterscheiden konnte, für welches Produkt die jeweils gerade warben. In der ganzen deutschen Werbewelt herrscht noch immer trunkene Karibik.
Eigentlich müsste das doch reibungslos funktionieren: Will man die Leute vor den Gefahren des Rauchens warnen, zeigt man ihnen die Großaufnahme eines offenen Raucherbeins mit dem verwesenden Eiter drauf. Farbecht, detailgetreu und Ekel erregend. Dann stehen ihnen die Haare zu Berge, und sie rühren nie mehr eine Zigarette an.
Solchen Unfug denken sich Politiker in aller Welt gern aus. Seit Neuestem müssen solche drastischen Horrorbilder auf allen Zigarettenschachteln in Australien abgebildet werden. Aber Politiker gehören nun einmal nicht zu den hellsten Köpfen.
Doch Gedächtnisinhalte mit unangenehmem Gefühlston werden mäßig, mit neutralem Gefühlston schlecht und mit angenehmem Gefühlston gut behalten. Aber: Je stärker die Emotionalisierung, desto schwächer die Werbewirkung. Ausgeprägte Furchtappelle führen zu Abwehrreaktionen und werden kaum verhaltenswirksam. Dies zeigt auch der empirische Befund, dass in Nichtraucherkampagnen Moral-, Rational- und Angstappelle überhaupt nicht wirken.
Rauchen macht blind: Die Gesundheitsbehörde warnt
Doch wegen dieser ach so abschreckenden Horrorvision hat kaum ein australischer Raucher das Rauchen sein gelassen, der es nicht sowieso schon sein lassen wollte. Und das hat einen einfachen Grund: Die Leute lassen sich durch Furcht oder Angst erregende Appelle so gut wie nie beeinflussen. Und wenn doch, dann meistens nicht in die gewünschte Richtung. Es gibt massenhaft Trotzreaktionen: jetzt erst recht.
Die meisten Raucher kennen längst die gesundheitlichen Risiken des Rauchens. Man muss ihnen das nicht erzählen. Da hilft es nicht, wenn man ihnen noch einmal die Krebskeule vor den Latz knallt.
Das ist ja gerade die Problematik der Raucher. Sie leben in einer ambivalenten Situation. Sie wissen längst und meist auch ziemlich genau, wie schädlich das Rauchen ist und rauchen trotzdem. Wer ihnen jetzt noch einmal mit dem Holzhammer erklärt, was sie sowieso schon wissen, ist ihnen lästig - aber überzeugt nicht.
Die Psychologie unterscheidet etwas genauer zwischen Angst und Furcht. Sie bezeichnet Angst als eine freischwebende Empfindung der Bedrohung im Gegensatz zu Furcht, die eine emotionale Reaktion auf eine spezifische, bewusst wahrgenommene Gefahr darstellt.
Furcht ist gewissermaßen "normal"; denn ihr Auslöser ist eine konkrete Gefahr. Angst ist das Feld, auf dem die Psychologen ihren Lebensunterhalt verdienen. Furcht ist die rationale Reaktion auf Alltagsgefahren. Furcht ist das mulmige Gefühl, das einen beschleicht, wenn plötzlich ein wilder Löwe vor einem steht. Angst ist das Gefühl der Lebensbedrohung, das einen ängstlichen Menschen beim Anblick eines harmlosen Insekts übermannt.
Angst schüren ist ein schlechter Ratgeber und bringt nichts
Antirauchen-Werbung will Angst machen. Sie schürt Angst: Alle öffentlichen Propagandakampagnen wollen nicht wirklich vor konkreten Gefahren warnen, sondern diffuse Ängste schüren. Und deshalb sind sie zum Scheitern verdammt. Eine ähnliche Kampagne, die Wladimir Putin höchstpersönlich in Russland durchsetzte, wurde wenig später wieder eingestellt.
Die Werbepsychologie verwendet Angst und Furcht weitgehend synonym, und zwar im Sinne von Furcht. Angst oder Furcht induzierende Werbung ist vor allem in der nichtkommerziellen Werbung, also etwa in der Gesundheitsfürsorge, bei Sicherheitsmaßnahmen gegen Einbruch oder beim Anlegen von Sicherheitsgurten verbreitet.
Man schildert den Leuten also eine konkrete Gefahr und sagt: "Wenn Ihr dies oder jenes tut oder dieses oder jenes Produkt kauft, dann geratet Ihr erst gar nicht in diese Gefahr."
Die Sozialpsychologie und die Kommunikationsforschung haben sich eingehend mit der Wirkung solcher Furchtappelle in Propaganda, in Öffentlichkeitsarbeit und Werbung beschäftigt. Werbung mit Furchtappellen besteht stets aus zwei Teilen: Der erste Teil beschreibt eine Angst erzeugende Situation wie eine Katastrophe, ein Unglück, eine Krankheit - kurzum den eigentlichen "Furchtappell" - und der zweite Teil das Verhalten oder das Produkt, mit dessen Hilfe man die Gefahr aus dem Wege räumen kann - das "Furcht reduzierende Verhalten".
Die Erkenntnisse der Sozialpsychologie und der Kommunikationsforschung sind nicht eindeutig. Jedenfalls ist der Einsatz negativer Emotionen zur Aktivierung von Konsumenten ein zweischneidiges Schwert. Zwar ist mit Hilfe von Furchtappellen ohne jeden Zweifel eine Aktivierung der Konsumenten leicht zu erreichen.
Sie werden also aufmerksam und vielleicht sogar etwas beunruhigt. Es können jedoch unbeabsichtigte Nebenwirkungen auftreten. Bei Werbung mit Angstauslösern können die Leute ihre Angst ja auch durch Verdrängung bewältigen, statt die Empfehlung zu befolgen.
Seit den frühesten Untersuchungen der Wirkung von Furchtappellen verschiedener Intensitäten gab es oft, aber nicht durchgängig ein überraschendes Ergebnis: Weder der drastische noch der mittlere Angstappell führten zu Einstellungsänderungen, sondern der schwache Appell.
Auch hier gilt eines der eisernen Grundgesetze der Werbegestaltung: Man darf einfach nicht zu dick auftragen. Wer zu dick aufträgt, kriegt’s oft knüppeldick zurück.
Der Saarbrücker Werbeforscher Werner Kroeber-Riel (1934-1995) beschrieb die emotionale Aktivierung so: "Gefühle sind das trojanische Pferd der Werbung". Es hat sich nämlich gezeigt, dass die Werbung mit ausgeprägt negativen Emotionen auf längere Sicht weniger wirksam ist als die werbliche Auslösung angenehmer Gefühle.
Ausgeprägte Furchtappelle führen zu einer defensiven Wahrnehmungssperre bei den Konsumenten und werden deshalb kaum verhaltenswirksam. In allen Nichtraucherkampagnen hat sich immer wieder gezeigt, dass Moral-, Rational- und Angstappelle nicht sehr wirkungsvoll sind.
Auch dieser Befund ist allerdings nicht eindeutig. Eine Untersuchung der amerikanischen Werbeforscher Michael L. Ray und William L. Wilkie zu einer mit starken Angstappellen operierenden Anti-Raucher-Kampagne fand 1970 heraus, dass zwischen dem später beobachtbaren Rückgang des Zigarettenkonsums und der mit Furchtappellen operierenden Kampagne ein deutlicher Zusammenhang besteht.
In dieser Kampagne trat allerdings ein bekannter Schauspieler auf: der Marlboro-Mann. Er gab öffentlich bekannt, dass er wegen jahrelangen Zigarettenrauchens an Lungenkrebs sterbe.
Aus dieser Untersuchung schlossen die Autoren, dass Angstappelle durchaus Erfolg versprechen bei Zielpersonen, die "low in anxiety and high in self-esteem" sind, also bei Personen, die selbst wenig Angst haben und über ein hohes Selbstwertgefühl verfügen. Die Chose funktioniert also anders, als man erwarten würde: Nicht die Ängstlichen werden noch ängstlicher, wenn man ihnen durch Werbung Angst einjagt. Die Mutigen und Selbstbewussten lassen sich durch die Heraufbeschwörung drohender Gefahren beeindrucken.
Die Frage, was die Bedingungen dafür sind, dass sich Personen einer Botschaft zuwenden, um Gefahr abzuwenden, ist Gegenstand des von Ronald W. Rogers 1975 entwickelten "Protection-Motivations-Modells", das im Laufe der Jahrzehnte von neueren Autoren zum "Ordered Protection Motivation Model (OPM Model)" und zum "Extended Protection Motivation Model (EPM Model)" weiterentwickelt wurde.
Drei kritische Variablen bestimmen demgemäß die Wirkung von Furchtappellen: (1) das Ausmaß möglicher Schädigung: (2) die vom Empfänger vermutete Wahrscheinlichkeit, persönlich betroffen zu sein, wenn er nichts dagegen unternimmt, und (3) die vermutete Wirksamkeit möglicher Gegenmaßnahmen.
Zentral ist das Konzept der Schutzmotivation ("protection motivation"), also gesundheitsspezifische Vorsätze, Absichten und Intentionen. So ist ein Raucher, der nur beabsichtigt, das Rauchen einzustellen, mindestens einen "Schritt" näher an der gesunden Verhaltensalternative als derjenige, der darüber nur nachdenkt.
Ein Mensch, der durch negative Appelle aus seinem emotionalen Gleichgewicht gebracht worden ist, sucht nach einer Möglichkeit, das Gleichgewicht wiederherzustellen und die "Bedrohung" abzuwenden. Wird ihm mit der Furcht erregenden Botschaft ein geeigneter Ausweg angeboten (Nichtrauchen, Impfen, Abschluss einer Versicherung), so akzeptiert er ihn oft und merkt sich ihn auch gut. Erreicht die Angst indes eine subjektiv nicht mehr ertragbare Höhe, kommt es zu Abwehrmechanismen: Die Botschaft wird - unbewusst - geleugnet oder aber der Werbende wird als unglaubwürdig abgelehnt.
Welche Wirkung ein Angstappell bei einer bestimmten Zielperson hervorruft, hängt unter anderem von deren Persönlichkeit und ihrem Angstniveau, der Bedeutung des Themas für sie, der Stärke des Angstappells in der Botschaft, der empfundenen Wahrscheinlichkeit, mit der die unangenehmen Konsequenzen eintreten werden, dem Zeitraum, der bis zum möglichen Eintreten der Folgen verstreichen wird, und der Glaubwürdigkeit des Senders ab.
Die zahlreichen Anstrengungen zur Aids-Vorsorge haben neue Forschungen gefördert, die sich kritisch mit dem Einsatz von Furchtappellen beschäftigen. Entscheidend sind danach die Risikowahrnehmung ("risk perception") der Zielpersonen und ihre Vorstellung über Möglichkeiten der Eigentätigkeit ("self-efficacy"). Wenn die Zielpersonen nicht überzeugt sind, dass sie einer Ansteckung durch Kondome vorbeugen können, dann verwenden sie die auch nicht.
Verhaltensverstärkend wirkt meist die Darbietung von Belohnungen oder das Vermeiden von Bestrafungen - nicht aber die Androhung von Strafen oder schrecklichen Folgen. Die Werbung wirkt nur, wenn sie positive Konsequenzen verheisst. Als Verstärker stehen Belohnungen wie finanzielle Vorteile, persönliches Wohlbefinden und soziale Anerkennung zur Verfügung.
Bei Werbung mit negativen Appellen sind verschiedene Reaktionen denkbar: Ist die Wirkung des Werbemittels zu sehr von negativen Erlebnissen geprägt - etwa Angst oder Ekel -, so kann das Produkt selbst dann abstoßend erscheinen, wenn es Rettung vor dem Unangenehmen verheißt. Allerdings kann man sich auch hier auf so gut wie nichts verlassen, was die Forschung zutage gefördert hat. Zu den meisten Befunden gibt es meist auch Gegenbefunde.
So halten die beiden US-Forscher Anthony Pratkanis und Elliott Aronson 1991 in ihrem Buch "Age of Propaganda. The Everyday Use and Abuse of Persuasion" (Das Zeitalter der Propaganda. Der alltägliche Gebrauch und Missbrauch von Beeinflussung) ausdrücklich fest, dass man überhaupt nicht dick genug auftragen kann, wenn man Ängste mobilisieren will: "All other things being equal, the more frightened a person is, the more likely he or she is to take positive preventive action." (Je mehr Angst jemand hat, desto wahrscheinlicher ist es, dass er oder sie etwas unternimmt.)
Ein gelungenes Beispiel für die erfolgreiche Werbung mit negativen Appellen stellt die Mitte der 1980er Jahre vom deutschen Bundesministerium für Jugend, Familie, Frauen und Gesundheit durchgeführte Kampagne zur AIDS-Vorbeugung dar. Das Ausmaß möglicher Schädigung steht außer Frage. Die Kampagne betonte die persönliche Betroffenheit des Einzelnen ("Warum glaubst Du, der Einzige zu sein, der AIDS nicht bekommen kann?") und wies darauf hin, dass jeder die Möglichkeit hat, sich selbst zu schützen. Insgesamt operierte die Kampagne eher behutsam mit Angst.
Alle Untersuchungen aus den USA und aus Europa weisen deutlich darauf hin, dass es stets und unter gar allen Umständen, wirksamer ist, Zielpersonen mit positiven Appellen anzusprechen. Das bestätigte 1997 eine Studie der University of Dayton über Aufrufe zum Organspenden. In der Vergangenheit hatte man dazu mit geringem Erfolg vor allem Appelle eingesetzt, die das Elend der Menschen betonten, die auf Spenderorgane warten.
Die Studie verwendete vier verschiedene Appelle - zwei mit "fear appeals" und zwei mit "positive appeals", die den Segen für die Empfänger betonten. Resultat: 25 Prozent derjenigen, die per Furchtappell angesprochen worden waren, sagten, sie hätten keinerlei Absicht, ihre Organe zu spenden. Bei denen, die per "positive appeal" angesprochen worden waren, sagten das nur fünf Prozent.
Ziemlich eindeutig ist auch der Zusammenhang mit dem Alter der Zielpersonen. Das hat sich in den zahlreichen Kampagnen gegen Drogenmissbrauch in aller Welt gezeigt. Furchtappelle wirken umso besser, je älter die Zielpersonen sind. Je jünger die Zielpersonen, desto stärker verbreitet ist die Vorstellung von der eigenen Unsterblichkeit. Ein wahrer Fluch; denn alle Anti-Drogen-Kampagnen richten sich vor allem an junge Leute. Und ausgerechnet bei denen zieht das nicht.
Unabhängig von der Frage deren Wirksamkeit macht die Werbebranche allerdings relativ selten von unverhüllten Angstappellen Gebrauch. Das hat gute Gründe. Wirtschaftswerbung mit der Angst wirkt auf die Psyche des Adressaten ein: Sie weist ihn auf eine angebliche oder tatsächliche Gefahr hin. Rechtlich gesehen ist die unverhohlene Wirtschaftswerbung mit der Angst wettbewerbswidrig. Sie verstößt gegen den Grundsatz des fairen Wettbewerbs; denn sie wirbt nicht mit der eigenen Leistung, sondern weckt oder verstärkt Ängste, um die Kaufentscheidung zu beeinflussen.
Die mehr oder minder milde Form der Weckung von Ängsten ist in der tagtäglichen Werbung indes gang und gäbe: "Wenn Ihr nicht das Mundwasser 'Anti-Faul-Gestank' benutzt, dann kriegt Ihr Mundgeruch, verliert alle Freunde und kommt sexuell auf den Hund." Auch das ist natürlich ein wettbewerbswidriger Furchtappell.
Unter Kreativen in der Werbebranche wird Emotion stets gern als Gegensatz zur Rationalität gesehen und interpretiert. Sie nehmen dann an, dass sie in ihren Werbespots emotional gnadenlos auf die Pauke hauen müssen, um Beachtung beim Publikum zu finden, und demonstrieren damit für jedermann leicht erkennbar, dass sie die Rolle der Emotionen überhaupt nicht verstanden haben; denn Emotion ist etwas viel Subtileres als alles, was die Tränendrüsen reizt.
Emotionale innere Beteiligung ist eine Voraussetzung dafür, dass jemand einem beliebigen Objekt Interesse zuwendet. Es ist die angenehme Empfindung, die den Betrachter ergreift, wenn er etwas Erfreuliches sieht.
Emotion und Kognition sind so sehr miteinander verzahnt, dass sie nicht voneinander getrennt werden können. Die innere Erregung, die bei emotionalen Erlebnissen auftritt, aktiviert und stimuliert die gesamte Leistungsfähigkeit. Konsumenten, die gezielt durch emotionale Reize aktiviert werden, nehmen Informationen besser auf, verarbeiten sie schneller und speichern sie besser.
Selbst relativ schwache Emotionen sind ausreichend, um kognitive Prozesse und auch Verhalten zu verändern. Die Aktivierung mit Hilfe von Emotionen, hat auch einen Wert an und für sich, da jeder Mensch ein bestimmtes Maß an innerer Erregung braucht.
Der "Bauch" der Werber wohnt im Gehirn
Die Werbebranche hält derweil immer noch an dem einfachen, aber falschen Modell der Zweiteilung fest. Menschen werden als zu "rational" oder zu "emotional" bezeichnet. Wenn es um die Frage "Hirn" (kalt, rational) oder "Bauch" (warm, emotional) geht, schlägt das "Herz" der Werber für den Bauch.
Doch dieser Bauch wohnt ebenso wie das Herz im Hirn. Die Vorstellung, dass wir im Besitz einer rationalen und einer emotionalen Gehirnhälfte sind, ist längst widerlegt. Beide Hirnhälften haben emotionale und rationale Strukturen.
Ein Beispiel ist die Amygdala (der Mandelkern), eines der wichtigsten Emotionszentren in unserem Gehirn. Sie sitzt in beiden Hirnhälften und auch noch direkt neben einer rational kognitiven Zentrale, dem Hippocampus.
Auch die in der Werbebranche noch immer verbreitete und beliebte Annahme, es bestehe die Alternative zwischen dem sprachlich-rationalen und dem bildlich-emotionalen Zugang ins menschliche Gehirn ist widerlegt. Die Hirnforschung hat gezeigt, dass alle Informationen, die in unser Gehirn gelangen, ohne Ausnahme emotional bewertet werden und es gar keine rein rationalen Vorgänge gibt.
Heute hat vor allem die von M. B. Arnold sowie von Stanley Schachter und Jerome E. Singer formulierte kognitive Emotionstheorie Akzeptanz gefunden. Danach besteht Emotion aus einer statischen und einer dynamischen Komponente. Die kognitiven Aspekte einer Situation, die statisch positiv oder negativ bewertet wird, bestimmen den emotionalen Charakter eines als Annäherungstendenz in Richtung auf einen positiv bewerteten oder als Vermeidungstendenz eines negativ bewerteten Aktivierungszustands.
Emotion lässt sich als das Resultat eines Prozesses verstehen, in dem sowohl physiologische Erregung wie Kognitionen in unterschiedlichem Ausmaß vorhanden sind und einander wechselseitig beeinflussen (Zwei-Komponenten-Theorie).
Schachter geht davon aus, dass jede Emotion zunächst physiologisch bedingt sei und sich primär in einer unspezifischen Aktiviertheit äußere. Erst eine gedankliche Einordnung dieser Erregung, zum Beispiel als Ärger oder Freude, erlaubt das entsprechende Gefühlserlebnis.
Die Marketinglehre hat die Bedeutung der Emotionen lange vernachlässigt. Das Interesse von Markt-, Konsum- und Werbeforschung konzentriert sich auf die Produktdifferenzierung und die Werbung mit Hilfe von Emotion, also die Beeinflussung von Bedürfnissen vermittels emotionaler Stimuli.
Kann man Konsumenten ernsthaft konditionieren wie Pawlows Hunde?
Einer der innigsten Wunschträume aller Werber ist die Hoffnung, man könne die Leute mit Hilfe der Werbung wie einst Pawlows Hunde konditionieren: Klingelt das Glöckchen, fangen die Konsumenten - in unbändiger Gier - an, zu sabbern, rasen unter einem inneren Zwang ins nächste Geschäft und kaufen sich das Objekt ihrer Begierde: einen Schokoriegel, einen Gummistrop oder auch eine Klosettbürste.
Viele Werber glauben tatsächlich, so etwas sei möglich. Oder sie hoffen es wenigstens. Vielleicht nicht gerade bei Gummistrops, aber ganz bestimmt bei Schokoriegeln und anderen Erzeugnissen der Lebensmittelindustrie. Doch sie irren, wie so oft. Selbst die Konditionierung von Hunden hat so, wie wir alle zu wissen glauben, nie stattgefunden.
Nach der Theorie der klassischen Konditionierung des sowjetischen Physiologen Iwan P. Pawlow führt die wiederholte Darbietung eines neutralen Reizes gemeinsam mit einem Reiz, der bereits eine Reaktion hervorruft, dazu, dass der ursprünglich neutrale Reiz die gleiche Reaktion hervorruft. Das Individuum ist dadurch konditioniert, auf den neutralen Reiz zu reagieren.
Bei der von Pawlow entdeckten klassischen Konditionierung handelt es sich um eine Selektion von Reizen, deren Signalbedeutung erlernt wird. Dadurch wird das Verhalten konditioniert und führt zu Reaktionen, die ursprünglich nur durch natürliche Reize ausgelöst werden können. Voraussetzung für klassische Konditionierung sind drei Faktoren:
- Es muss ein natürlicher Reiz existieren, der zuverlässig eine Reaktion (einen Reflex) auslöst.
- Es muss ein neutraler Reiz existieren, der dieselbe Reaktion normalerweise nicht auslöst.
- Der natürliche und der neutrale Reiz werden zeitlich nacheinander dargeboten - wobei der natürliche dem neutralen Reiz zeitlich unmittelbar vorangeht -, bis der neutrale Reiz dieselbe Reaktion auslöst wie der natürliche Reiz.
Der Originalreiz heißt unkonditionierter Reiz, die durch ihn ausgelöste Reaktion unkonditionierte Reaktion. Der ursprünglich neutrale Reiz wird konditionierter Reiz genannt, die durch ihn ausgelöste Reaktion konditionierte Reaktion (bedingter Reflex). Die konditionierte Reaktion wird im Zeitverlauf wieder abgeschwächt oder ganz gelöscht, wenn keine Verstärkung erfolgt. Die durch einen bestimmten Reiz ausgelöste Reaktion kann später auch durch ähnliche Reize bewirkt werden (Reizgeneralisierung).
Das Prinzip der klassischen Konditionierung findet sich in der emotionalen Konditionierung wieder: Wenn Bilder oder Wörter emotionale Reaktionen hervorrufen und wiederholt zusammen mit einem neutralen Wort dargeboten werden, so ruft nach einiger Zeit dieses Wort die gleiche emotionale Reaktion hervor.
Dieses Lernprinzip hat für die Werbung Bedeutung. Man nimmt an, dass Emotionen sich vom Standpunkt des Lernens wie Reflexe verhalten. Daraus folgt: Wenn man in einer positiven Stimmung einen bis dahin neutralen Gegenstand kennenlernt, wird zu diesem Objekt eine positive affektive Einstellung bewirkt oder konditioniert.
In Werbebotschaften werden daher Stimuli eingebaut, die ein positives Reaktionspotenzial enthalten. Die darauf beruhenden Emotionen werden mit dem Produkt konditioniert.
In gesättigten Märkten sind die Produkte technisch meistens sehr ähnlich oder sogar nahezu identisch. Sie sind austauschbar. Folglich wird auch die Werbung austauschbar, wenn sie sich ausschließlich oder im Wesentlichen an objektiven Produktmerkmalen orientiert. Daher versucht die Werbung, Produkte an emotionalen Konsumerlebnissen zu orientieren.
Emotionale Erlebniswerte sind subjektiv wahrgenommene, gefühlsmäßige Produktbeurteilungen der Konsumenten und dienen dazu, Produkte zu differenzieren. In gesättigten Märkten mit technisch austauschbaren Produkten ist das meist die einzige Möglichkeit, sich vom Wettbewerber zu abzugrenzen.
Wirft man indes einen etwas genaueren Blick auf das berühmte Hunde-Experiment von Iwan Pawlow, dann hat da überhaupt gar keine Konditionierung stattgefunden; denn die Hunde haben ja gar nicht reflexartig agiert. Ein Reflex läuft automatisch ab, immer.
Der berühmte Hund von Pawlow, der angeblich durch den bedingten Reflex gelernt hat, war - wie alle Hunde - aktiv an seinem Fressen interessiert. Sonst hätte er nichts gelernt. Der Hund hat also die Theorie aufgestellt: Wenn die Glocke läutet, kommt das Fressen. Das ist kein bedingter Reflex, sondern eine Theorie.
Werbung versucht, die Konsumenten durch Präsentation von Produkten in Kombination mit Reizen emotional zu konditionieren. Man hofft, dass sich die positive emotionale Reaktion auf den Reiz auf das Produkt überträgt. In diesen Fällen geht es allerdings gar nicht um automatisch ablaufende Reflexe, sondern um affektiv-emotional bewertete Einstellungen. Die sind jedoch wesentlich komplexer als Reflexe. Einstellungen sind Wahrnehmungsurteile und haben eine erkennende (kognitive) Komponente. Eine affektiv-emotionale Bewertung ist nur ein Aspekt von Einstellungen.
Die wiederholte Darbietung eines Produkts, einer Marke zusammen mit emotionalen Reizen führt dazu, dass diese Produkte oder Marken einen emotionalen Erlebniswert erhalten. Wird dieser Erlebniswert eigenständig gestaltet, so ist damit eine eigenständige Art der Marktkommunikation vollzogen.
Das wohl prominenteste Beispiel dafür liefert der Markt für Zigaretten. Die Produkte sind objektiv in nur seltenen Fällen unterscheidbar - dafür liefern Blindtests massenhaft Belege. Erst emotionale Erlebniswerte (Cowboys, Dschungelabenteurer, Comic-Figuren) ermöglichen eine eigenständige Produkt-Marken-Profilierung.
Elemente, die starke Emotionen wecken, müssen einen Bezug zur Botschaft, zum Produkt selbst haben. Sonst ziehen sie alle Aufmerksamkeit auf sich und lenken von der eigentlichen Aussage ab. Werbebotschaft und emotionale Ansprache müssen eine Einheit bilden. Außerdem müssen die durch emotionale Ansprache bewirkten Einstellungsänderungen dem Kommunikationsziel entsprechen. Es ist nicht gesagt, dass diese bei allen Personen gleich ablaufen.
Wenn sich schon Pawlows Hunde in Wahrheit gar nicht konditionieren ließen, wie soll das dann bei Konsumenten funktionieren, die ja doch öfter als man denkt, über ein etwas komplexeres Gehirn verfügen als Hunde? Bei den Hunden in Pawlows Experiment wurde kein Reflex ausgelöst, weil die Hunde - längst vor dem Experiment - ein aktives Interesse am Futter hatten.
Ein Reflex setzt einen Automatismus voraus. Die Reaktion auf das Läuten des Glöckchens führte aber zu einer Verknüpfung des Läutens mit der Erwartung von Futter. Es war keine Konditionierung. Ein Konsument, dem die Werbung die hinreißendsten Erlebniswelten vorspielt, wird auch nicht konditioniert. Vielleicht verknüpft er die Erlebniserwartung mit dem beworbenen Produkt, vielleicht aber auch nicht. Und das ist keine Konditionierung. Das Gerede von der Konditionierung der Konsumenten ist nichts als ein großer Quatsch.
Wolfgang J. Koschnick gilt in Deutschland, Österreich und der Schweiz als einer der bestinformierten Kritiker der internationalen Werbeforschung und Werbung. Er hat über 50 anerkannte Nachschlagewerke aus dem weiten Feld von Marketing, Management, Marktkommunikation, Werbe- und Mediaplanung, Markt-, Media- und Sozialforschung geschrieben, mit denen mehrere Generationen von Nachwuchswerbern, Marketingexperten, Werbe- und Mediaforschern ausgebildet werden. Dabei bewahrte er stets seine Unabhängigkeit und eine gewisse Streitbarkeit. Bei Bedarf legt er sich mit Werbungtreibenden, Werbern, Werbeagenturen und sonstigen Interessenvertretern ohne Ansehen der Personen, Organisationen und Institutionen an.
Der 10. Teil der Serie "Wie Werbung wirklich wirkt" erscheint in etwa einer Woche:
Was den Leuten gefällt, wirkt auch
Oder etwa nicht?
