Gehirn: Es kommt doch auf die Größe an
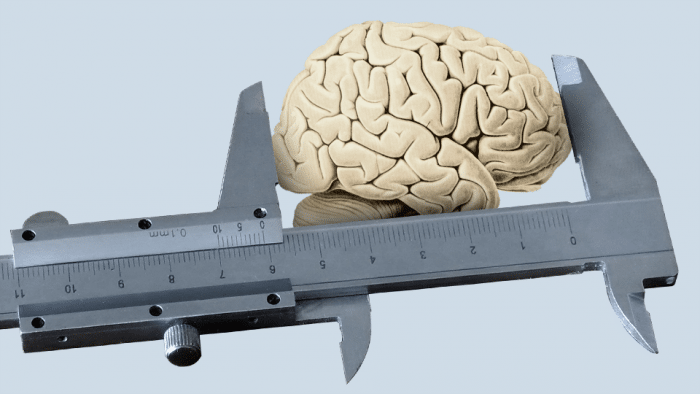
Beim Menschen korreliert die Hirngröße mit dem Intelligenzquotienten
Es gibt da diese Sherlock Holmes-Geschichte (". . . und der blaue Karfunkel"), in welcher der zukünftige Klient schon wieder gegangen ist, als Holmes und Watson nach Hause kommen, aber seinen Hut vergessen hat. Mit gewohnter Sicherheit deduziert Holmes alles Mögliche über den Mann, unter anderem auch, dass er nicht dumm sein könne. Wie er das erkannt habe, fragt Watson. Holmes verweist auf den riesigen Hutumfang: "It is a question of cubic capacity! A man with so large a head must have something in it!" So einfach ist es natürlich nicht. Oder doch?
Jedenfalls ist der Zusammenhang zwischen Hirngröße und Intelligenz, je nach Betrachtung, widersprüchlich. In einer phylogenetischen Betrachtungsweise, also im Vergleich verschiedener Arten, ist es üblich, die Gehirngröße auf die Körpergröße zu beziehen. Das Ergebnis ist der sogenannte Enzephalisationsquotient. Der wird allerdings nicht einfach als Gehirngewicht/Körpergewicht berechnet. Dann lägen nämlich die Singvögel an der Spitze, und der Mensch käme erst danach, gleichauf mit den Mäusen (denen er doch vielleicht gar nicht so ähnlich ist).
Man bezieht das Gehirngewicht auf einen Erwartungswert, der sich aus der Regressionskurve für die Bezugsgruppe (also hier z.B. Säugetiere) ergibt. An dieser Regressionskurve kann man ablesen, wie groß ein durchschnittliches Gehirn bei einer gegebenen Körpergröße wäre. Das tatsächliche Vielfache dieses Wertes ist dann der Enzephalisationsquotient. Das sicherlich nicht unerwünschte Ergebnis dieser Rechnerei ist, dass der Mensch an der Spitze aller Säugetiere liegt.
Ein großer Körper braucht kein großes Hirn
Tatsächlich erfüllt also der Enzephalisationsquotient die Erwartung, dass Hirngröße - wenn man sie nur richtig misst - irgendwie mit Intelligenz zusammenhängen sollte (wie auch immer man die misst). Es liegt ihm aber auch eine unvoreingenommene Überlegung zugrunde: Die Hirngröße unmittelbar auf die Körpergröße zu beziehen, ist unzureichend, weil es für die grundlegenden Funktionen unnötig ist, dass das Gehirn linear mit dem Körper wächst.
Um Atmung, Herzschlag, Hormone und Verdauung, ja sogar um Bewegungen zu steuern, braucht der Elefant nicht eine Million Mal mehr Neuronen als die Maus. Er hat ja auch nicht eine Million Mal mehr Muskeln, sondern bloß größere. Und den Atemrhythmus könnte theoretisch gerade dieselbe Anzahl von Zellen in beiden Tieren hervorbringen. Daher haben sehr kleine Tiere ein relativ größeres, und sehr große ein relativ kleines Gehirn, unmittelbar auf die Körpermasse bezogen. Diejenige Hirnmasse, die dann trotzdem noch größer ist als erwartet - die steht möglicherweise zum Denken zur Verfügung.
Wenn diejenige Hirnmasse, welche für die Grundfunktionen benötigt wird, theoretisch immer so groß sein kann wie bei einer Maus, oder praktisch jedenfalls weniger stark wächst als der Körper, dann folgt daraus zweierlei: Erstens kann man es sich noch einfacher machen und die Körpergröße ganz vernachlässigen. Je schwerer das Gehirn, desto schlauer: Das stimmt zumindest bei Primaten. Man könnte das allenfalls noch präzisieren, indem man die Zahl der Nervenzellen ermittelt. Denn die vielgeliebten Delphine haben zwar ein großes und feingefälteltes Gehirn, darin aber nur locker verteilte Neuronen. Vögel hingegen tragen in ihren kleinen Hirnen dichtgepackte Rechenpower (Von wegen: "Spatzenhirn").
Ungleiches Wachstum
Und zweitens ergibt sich die Vorhersage, dass verschiedene Gehirngebiete unterschiedlich stark wachsen, wenn das Gehirn größer wird. Das Atemzentrum, um bei diesem Beispiel zu bleiben, sollte nur wenig wachsen und relativ kleiner werden. Im Gegenzug könnten solche Gebiete, die mit kognitiven Funktionen betraut sind, die Oberhand gewinnen.
Genau das sieht man tatsächlich, wenn man Maus und Mensch vergleicht: Das Stirnhirn, also jener Teil der Hirnrinde, der komplexe kognitive Funktionen wie Strategiebildung, Selbstbeherrschung und -kritik oder das Arbeitsgedächtnis bereitstellt, findet sich bei der Maus nur bescheiden am Vorderzipfel der Großhirnhemisphären, die dominiert werden von den ausgedehnten primären Sinnesfeldern. Beim Menschen dagegen zählt der größte Teil des Stirnlappens zum Stirnhirn, geschätzt ein Viertel bis ein Drittel der gesamten Großhirnrinde.
Solcherlei ungleiche Größenverhältnisse finden sich aber nicht nur beim Vergleich zwischen Arten. Sondern sogar innerhalb einer Art, wie amerikanische Forscher in einer Science-Publikation festgestellt haben. Selbstverständlich nicht in irgendeiner Art. Sondern bei Menschen.
Das menschliche Hirngewicht wird zwar meist mit drei Pfund angegeben. Tatsächlich aber gibt es auch unter geistig gesunden Erwachsenen eine große Schwankungsbreite bis fast um den Faktor 2. Von kaum mehr als 1kg bis an die 2kg ist alles dabei. Ist so ein Vierpfünder einfach nur ein hochskalierter Zweipfünder? Oder wachsen einzelne Regionen bevorzugt?
Um das zu testen, griffen die Wissenschaftler auf Datenbanken zurück, in denen die per Bildgebung gewonnenen Daten von insgesamt 2900 Menschen liegen. Da sie drei getrennte Datenbanken zur Verfügung hatten, ihre Berechnungen für jede einzeln durchführten und nur solche Befunde gelten ließen, die in jeder Stichprobe gefunden wurden, erledigte die Forschergruppe sozusagen auch gleich die Replikation ihrer eigenen Studie.
Sie kartierten also in jedem einzelnen Fall die Hirnrinde und berechneten dann für jeden Fleck auf der Hirnrinde einen "Skalierungsindex", der 1 ist, wenn dieses Gebiet linear mit der Gesamthirngröße skaliert. Doch gleich 1 war der Index überraschend selten.
Stattdessen gab es Gebiete, die negativ skalieren, also relativ kleiner werden, wenn das Gehirn größer wird. Das betraf besonders die primären Sinnesfelder (Sehrinde, Hörrinde, weniger die Körperwahrnehmung) und das sogenannte "limbische Netzwerk", also mit Emotionen befasste Rindenfelder. Andere Gebiete dagegen skalierten positiv, wuchsen also überproportional. Das galt für assoziative Hirngebiete wie das seitliche und mittlere Stirnhirn und auch Assoziationsgebiete im Scheitellappen. Zusammengefasst fand sich positive Skalierung v.a. im sogenannten Ruhezustandsnetzwerk, das vermutlich unser Selbstbild, unsere Introspektion und den Zugang zu neuen Assoziationen trägt (Ideen aus dem neuronalen Untergrund).
Große Hirne denken besser
Interessanterweise findet man dieselbe Verteilung von negativer und positiver Skalierung auch, wenn man in stammesgeschichtlicher Hinsicht die Gehirne von Makaken und Menschen vergleicht, und auch, wenn man über das Kindheits- und Jugendwachstum hinweg Gehirne vergleicht: Stets vergrößern sich assoziative Gebiete stärker als primärsensorische.
Das legt zum einen nahe, dass dahinter gemeinsame Regelmechanismen stecken. Und zum anderen, dass größere Gehirne sich Gebiete leisten, die den Stoffwechsel teuer kommen. Indem die Autoren eine verstärkte Transkription von solchen Genen in den positiv skalierenden Gebieten fanden, die sich Stoffwechselfunktionen zuordnen ließen, bestätigten sie die letztere Annahme.
Wer ein großes Denkorgan hat, hat also auch mehr Hirnmasse für das Denken übrig. Das könnte die Ursache dafür sein, dass beim Menschen die Hirngröße tatsächlich mit dem Intelligenzquotienten korreliert. Ob und in welchem Bereich das auch im Vergleich zwischen Arten gilt, muss offen bleiben. Aber was seinen Besucher angeht, hatte Sherlock Holmes letztlich recht.
