Zur Zukunft des Lesens
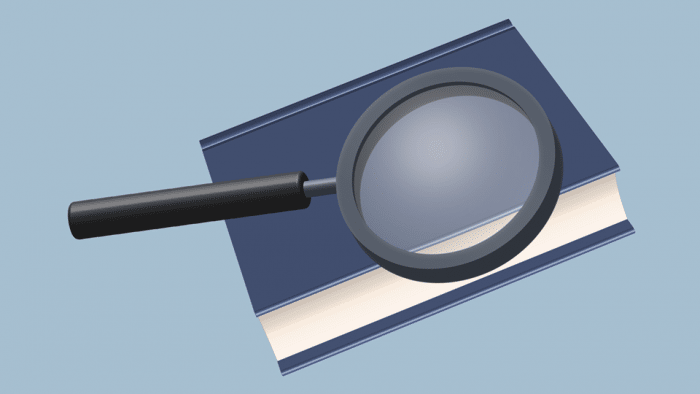
Literatur und Geisteswissenschaften im Zeitalter der digitalen Bilderflut
Innerhalb weniger Wochen fanden zunächst im Literaturhaus im München ("Wie wir Lesen: Zur Geschichte, Praxis und Zukunft einer Kulturtechnik") sowie danach in der evangelischen Akademie in Tutzing ("Lektüre: Bilder vom Lesen, vom Lesen der Bilder") zwei wissenschaftliche Tagungen statt, die sich der Rolle des Lesens und seiner Bedeutung für die Kultur annahmen. Von den zahlreichen mit dem Lesen befassten Teilnehmern aus Wissenschaft, Medien und Praxis wurde u.a. gefragt, was das Lesen als intellektuelle Anstrengung auszeichnet und warum bzw. inwiefern diese uralte Kulturtechnik von anderen Formen der Wissensaneignung zu unterscheiden sei.
Ich möchte im Folgenden einige der dort angestellten Überlegungen aufgreifen und mit einer Bestandsaufnahme des Lesens in den Wissenschaften, und hier vor allem den traditionell "lesenden" Geisteswissenschaften, verbinden. Denn es ist kaum zu bezweifeln, dass das Lesen auch und gerade in den Geisteswissenschaften in Bedrängnis, wenn nicht gar in Verruf geraten ist.
Die Gründe für den Prestigeverlust des Lesens sind vielfältig und haben sowohl strukturelle als auch "hausgemachte" Ursachen. Ganz allgemein kann man sagen, dass natürlich auch die Universitäten von der digitalen Wende hin zum Bild, zur piktoralen, visuellen Wahrnehmung erfasst wurden, und dass dieser buchstäbliche "Sinnes"-wandel nicht unerhebliche Auswirkungen auf unsere Lesepraxis mit sich bringt.
Doch bereits in dem 1934 erschienenen ABC des Lesens beklagt der nach Italien ausgewanderte amerikanische Dichter Ezra Pound den allmählichen Verlust unserer Wertschätzung für das Medium Buch. Wir leben in einem Zeitalter der Wissenschaft und des Überflusses, heißt es dort. Die Pflege und Ehrfurcht, die wir Büchern als solchen zukommen lassen, stammten jedoch aus einer Zeit, in der kein Buch vervielfältigt wurde — es sei denn, jemand machte sich die Mühe, es mit der Hand abzuschreiben. Bücher, so Pounds kulturpessimistisches Urteil, seien offensichtlich weder den Bedürfnissen der modernen Gesellschaft noch der Erhaltung des Wissens angemessen.
Derartige Unkenrufe auf einen gesellschaftlichen Wandel, in dessen Folge das Lesen überhaupt in Frage zu stehen scheint, sind seitdem — fast einhundert Jahre nach Pounds Text — immer wieder zu vernehmen. Zahlreiche Medien, Verlage, Bildungsforscher, Wissenschaftsmanager und Politiker beklagen den Verlust dieser so grundlegenden Fähigkeit des Lesens, und sie warnen vor einer Gesellschaft ohne Bücher und ohne die Muße, die es braucht, sich diesen angemessen zu nähern. Bücher sind immer auch Instrumente der Entschleunigung, sie halten uns auf, kommen uns buchstäblich in die Quere — ganz besonders dann, wenn sie die Fortführung der an verregneten Sonntagen oder auf langen Zugfahrten begonnenen Lektüre anmahnen — und sie erlauben damit, was Umberto Eco einmal den "Rastplatz der Sinne" in unserem hektischen, reizüberfluteten Alltag genannt hat.
Wie Phillip Keel, der Verleger des Schweizer Diogenes Verlages der Süddeutschen Zeitung anlässlich der Frankfurter Buchmesse im letzten Oktober mitteilte, ist die folgenreiche Krise des Buches für jeden mit der Branche Vertrauten evident, sie müsse nicht herbeigeredet werden, es gelte vielmehr, endlich "darüber" zu sprechen — öffentlich und ohne zahlendreherische Beschönigung. Auch den Grund für diese nicht mehr zu übersehende Krise des Buches hat Keel mitgeliefert; er reicht über Umsatzzahlen und Verkaufseinbrüche hinaus, und trifft ins Mark einer aufgeklärten, bildungsbeflissenen Gesellschaft: Die Krise des Buches, so Keel, sei in Wirklichkeit eine Krise des Lesens, das als eine der wichtigsten Kulturtechniken vom Aussterben bedroht sei.
Doch man kann es auch anders sehen. Folgt man den historischen Langzeitstudien des in den USA lehrenden italienischen Literaturwissenschaftlers Franco Moretti, dann ergibt sich ein signifikanter Zusammenhang zwischen der Anzahl der in einer Gesellschaft verfügbaren, regelmäßig produzierten Bücher und den verschiedenen Modi des Lesens, also der Art und Weise, "wie wir lesen". Es ist also nicht unbedingt so, dass wir trotz steigender Auflagen und kaum noch überschaubarer Titelvielfalt immer weniger lesen; es könnte eben auch sein, dass wir gerade deshalb, also aufgrund von Überforderung durch Überangebot, des Lesens irgendwie überdrüssig geworden sind.
Nah-lesen und Entfernungs-Lesen
Durch eine Technik, die als "distant reading" oder deutsch: "Entfernungs-Lesen", bekannt wurde und im wesentlichen ein Lesen von computergestützten, lange Zeiträume erfassenden Statistiken darstellt, fand Moretti heraus, dass sich etwa im 19. Jahrhundert mit der nunmehr steigenden Zahl wöchentlich publizierter Bücher signifikante Unterschiede im Leseverhalten der Menschen ergeben. Zum einen entwickelt man Vorlieben für bestimmte Genres, was eine Verschiebung vom Leser als "Generalisten" hin zum Leser als "Spezialisten" nach sich zog; und zum anderen liest man nunmehr schneller und oberflächlicher, man verzichtet auf historische ebenso wie auf Re-Lektüren, um mit der steigenden Zahl an Neuerscheinungen Schritt zu halten.
Morettis Argument basiert darauf, dass "distant reading" — im Gegensatz zum in den Literaturwissenschaften gerne praktizierten "close reading" (dem "Nahelesen") — Entwicklungen "sichtbar" machen kann, die weit über die Erfahrungswelt der wenigen intensiv gelesenen Bücher des literaturwissenschaftlichen Kanons hinausreichen. Während die quantifizierende Methode sich auf die Analyse hunderttausender Bücher stützen kann, bleibt dem "Nahelesen" nur die kleine Welt der "Bestenliste", die — wie man aus den Leselisten der Universitäten ersehen kann — oft nur wenige hundert Titel umfasst.
Unabhängig von der Frage nach den vielen, von Moretti vernachlässigten Faktoren, die im 19. Jahrhundert das Leseverhalten ebenfalls nachhaltig verändert haben, wie etwa die Erfindung erschwinglicher portabler Lesebrillen, ergibt sich aus der Gegenüberstellung von "distant" und "close reading" ein Skalierungsproblem, das unübersehbar auf den jeweiligen Abstand des Lesers zum Gegenstand des Gelesenen verweist. Es kommt beim Lesen nämlich wesentlich darauf an, wie nahe wir an das Gelesene "heranzoomen".
Hier ein historisches Beispiel: In einer der ersten Abhandlungen zum Einsatz des Mikroskops in der Biologie notiert der englische Forscher Robert Hooke, dass für die menschliche Wahrnehmung Skalierung und der Abstand zum beobachteten Objekt von entscheidender Bedeutung sind. In seinem Buch Micrographia von 1665, beschreibt Hooke detailliert seine bahnbrechenden physiologischen Untersuchungen kleinster Körper mit Hilfe des von ihm entwickelten Vergrößerungsglases, das er als quasi natürliche Ergänzung des auf die Ferne gerichteten Teleskops betrachtete. Beide Instrumente, so Hooke, erlaubten es, unsere begrenzte Sicht auf die Dinge zu erweitern und unsere menschliche Wahrnehmung zu perfektionieren.
Das Buch enthält atemberaubende, teilweise mehrseitige Kupferstiche kleinster Ausschnitte von Insekten und Säugetieren. Dabei mäandern Hookes Beschreibungen beständig zwischen der Welt der kleinsten Dinge und den symmetrischen Konstellationen der unendlich weit entfernten Himmelskörper, denn beide Welten entsprechen in idealer Weise der von Gott vorgesehenen Harmonie und Ordnung. Anders als von Menschenhand Gemachtes, etwa die Spitze einer Nadel oder die Klinge eines Rasiermessers, die unter dem Mikroskop stumpf und ausgefranst erscheinen, spiegelt sich in der mikroskopischen Betrachtung eines Flohauges die Harmonie des Universums als Ganzes wider.
Hookes mikroskopische Weltsicht ist ein gutes Beispiel für die Vorteile des "Nahesehens", die weit über das tatsächlich sichtbar Gemachte hinausreichen, aber auch für die Gefahren, die damit verbunden sind. Denn so aufschlussreich seine Beobachtungen im Mikroskopischen auch sind, sein unverrückbares christliches Weltbild scheint ihm den Blick für die damit verbundenen Ausdifferenzierungen und Besonderheiten zu verstellen: Auch im kleinsten Detail der Schöpfung vermag er immer nur das Große und Ganze der göttlichen Ordnung zu erkennen, wird ihm alles zum Beleg des bereits Gewussten. Das Nahesehen — wie auch das Nahelesen — erlauben also durchaus über die Miniatur des Gegenstandes hinausreichende Erkenntnisse, aber sie vermögen nicht, die für die Wahrnehmung des Unerwarteten, Neuen, und vielleicht gar Verstörenden notwendige Offenheit zu garantieren.
Dies lässt sich am Beispiel der in den Literaturwissenschaften lange Zeit dominanten Praxis des "close reading" gut ablesen. I. A. Richards, der die Methode 1929 in seinem Buch "Practical Criticism" erstmals beschrieb, hatte damit zunächst ein demokratisches Leseverfahren im Sinn, dass es auch den weniger vorgebildeten Studierenden erlauben sollte, nachvollziehbare und überprüfbare Aussagen über literarische Texte — bei Richards vornehmlich der Dichtung — zu machen. Dass dieses Verfahren dann im Zuge seiner amerikanischen Aneignung durch den sogenannten "New Criticism" unter dem ideologischen Generalverdacht stand, objektverliebt und bar jeden Realitätsbezugs zu sein, ändert nichts daran, dass das Nahelesen, wenn es mit der nötigen Offenheit und Neugierde für die im Text verborgenen, nur mühsam und immer nur zeitweise sich offenbarenden Tiefenschichten praktiziert wird, eine für alle mit Texten befassten Wissenschaften zentrale Leseform sein sollte.
Nach einigen Jahrzehnten der Abstinenz, in denen die Methode des "close reading" zunehmend durch unterschiedliche Formen von "distant reading" wie das Anthologisieren, Zusammenfassen, Verkürzen, Überfliegen und Anzitieren ersetzt wurde, ist an amerikanischen Universitäten (und darüber hinaus) erneut eine Debatte über den Sinn des Nahelesens entbrannt. In einer Zeit immer kürzer werdender Aufmerksamkeitsspannen, flächendeckender digitaler Bilderflut und einer disziplinär immer stärker ausdifferenzierten Universitätslandschaft scheint die Besinnung auf die Tugenden der intensiven Beschäftigung mit Texten irgendwie verlockend.
In ihrem viel beachteten Buch The social Imperative: Race, Close Reading, and Contemporary Literary Criticism hat die an der Stanford University lehrende Literaturwissenschaftlerin Paula Moya unlängst versucht, das Verfahren auch für das Studium von Minoritätsliteraturen wieder hoffähig zu machen.
Zur Besinnung kommen
Warum also brauchen wir oder, besser gesagt, warum sollten wir als Universitätslehrer aber auch wir als Gesellschaft insgesamt am intensiven Lesen als zentraler geisteswissenschaftlicher Methode und einer unserer wichtigsten Kulturtechniken festhalten? Am Anfang ihrer 1960 erschienenen Studie Vita Activa oder Vom tätigen Leben verweist Hanna Arendt auf den Satz eines amerikanischen Journalisten, der anlässlich der erfolgreichen ersten Sputnik-Mission 1957 gesagt haben soll: "Nunmehr sei der erste Schritt getan, um dem Gefängnis der Erde zu entrinnen." Für Arendt ist dieser Satz mehr als nur eine rhetorische Ungeschicklichkeit; vielmehr zeigt sich an ihm, dass das Denken der Menschen schon immer dem Vermögen der Wissenschaft und der Technik vorausgeeilt war.
Im weiteren diagnostiziert Arendt dann eine doppelte Form der "Weltentfremdung" in modernen Gesellschaften. Zum einen die Entfremdung von unserer unmittelbaren Umgebung, denn im selben Augenblick "da der ungeheure Raumvorrat der Erde entdeckt war, begann der gleiche Erdball zu schrumpfen, bis in der Welt, in der wir leben, jedermann fast im gleichen Maße ein Erdbewohner wie der Einwohner eines bestimmen Landes ist". Und zum anderen die Entfremdung des Menschen von sich selbst, ausgelöst durch die Verabsolutierung einer weiteren Triebkraft der Moderne, nämlich der Arbeit oder des Lebens als "tätigem" Leben.
Bereits im 17. Jahrhundert, so Arendt, habe die Neuzeit damit begonnen, die Arbeit zu verherrlichen und die Gesellschaft im Ganzen in eine Arbeitsgesellschaft zu verwandeln. Arendt warnt hier vor allem vor dem damit verbundenen Verlust eines Bewusstseins für nicht zweckgerichtete, nicht utilitaristische Tätigkeiten — und man könnte auch in diesem Sinn von einer Krise des Lesens sprechen. Was nämlich macht eine völlig auf Arbeit abgestellte Gesellschaft ohne Arbeit? Was arbeiten, wenn es nichts mehr herzustellen gibt, wenn Dienstleistungen zunehmend von Maschinen übernommen werden, und Arbeit daher sinnentleert und zwecklos erscheint?
Für Arendt erlaubt allein das nicht zweckgebundene Denken der Philosophie sich über diese grundsätzlichen Fragen modernen Lebens zu verständigen. Die Sprache aber, die für sie auch eine bestimmte Form des Denkens bezeichnet, sei gerade dabei sich zu verflüchtigen, sie wird von immer weniger Menschen wirklich beherrscht und benutzt, insbesondere in den Naturwissenschaften, wo Formeln und Zahlen sprachliche Komplexität reduzieren sollen.
Die Aktualität dieser düsteren Bestandsaufnahme, gut dreißig Jahre vor der flächendeckenden Einführung des Computers, ist bestechend. Arendt schreibt der Sprache das besondere Vermögen zu, uns zur "Besinnung" kommen zu lassen. Mit Besinnung ist dabei vor allem das Nachdenken über die Welt an sich und unser in der Welt-Sein gemeint. Diese nur im Raum der Sprache mögliche Form des Denkens führt mit großer Wahrscheinlichkeit, so Arendt weiter, zwar nicht zu Handlungen im Sinne praktischer Politik; sie führt aber im besten Fall zu weiterer "Besinnung", und erlaubt so einen anderen, neuen Blick auf die drängenden Probleme der Zeit, jenseits dominanter Diskurse und etablierter Lesarten gesellschaftlicher Erfahrung.
Vom nutzlosen Wissen und intellektuellem Nichtstun
Zur Besinnung-Kommen als eine Form kritischen Nachdenkens ist auch das Thema eines heute leider in Vergessenheit geratenen Essays des Philosophen und Nobelpreisträgers Bertrand Russel, In seinem 1932 verfassten "Lob des Müßiggangs" stellt Russel der Arbeitsverfallenheit moderner Gesellschaften das Ideal des kreativen "Nichtstun" entgegen.
Russel stellt fest, die Moderne habe sich ohne Not in eine verhängnisvolle Dynamik der Geschäftigkeit überantwortet, die gedanklicher Produktivität abträglich und im Übrigen allen historischen Erfahrungen gegenläufig ist. Diese neue Arbeitsmoral sieht Russel vor allem in den Vereinigten Staaten am Werk, wo selbst diejenigen Teile der Gesellschaft ihr verfallen sind, die dies ökonomisch nicht mehr nötig hätten, und die den Zwang zur Arbeit als säkularisierte Selbstautorisierung und symbolische Abgrenzung von den Verhaltensnormen einer degenerierten, prämodernen Aristokratie missverstehen.
Aus Sicht des aufgeklärten, humanistisch gebildeten Europäers, so Russell, ist dies im Kern ein Verrat an den Werten europäischer Zivilisation, für die das zweckentfremdete Denken und die Produktion von Kulturgütern, die eben gerade keine Konsum- und Gebrauchsgüter im kapitalistischen Sinn darstellen, eine Grundvoraussetzung ist. Russel identifiziert hier einen Grundwiderspruch zwischen der Geschäftigkeit des modernen Menschen und den Zwecken, für die wir vermeintlich all die Mühsal und Plackerei auf uns nehmen: Die ganze Welt ist in Bewegung geraten, aber Bewegung allein ist nicht die Bestimmung des Menschen, vielmehr verhindert sie, dass wir zur Besinnung kommen und unsere eigentliche Bestimmung erkennen können.
Um dies zu erreichen, skizziert Russel die nur scheinbare Utopie einer Gesellschaft ohne Arbeit, in der wir uns endlich völlig dem hingeben können, was er in einem anderen Essay einmal als "useless knowledge", nutzloses Wissen, bezeichnet hat. Das Adjektiv "nutzlos" ist dabei in beiden Sprachen — im Deutschen wie im Englischen — negativ besetzt. Dass dies so ist, hat für Russel damit zu tun, dass wir wesentliche Grundtugenden christlich-abendländischer Kultur schlicht verlernt bzw. in Folge der fortschreitenden Säkularisierung und Selbstbezüglichkeit der Moderne aus dem Arsenal unserer Kulturtechniken entsorgt haben.
Was aber ist das intellektuelle Nichtstun, dass beide — Russel wie Arendt — als Heilmittel gegen die sinnlose Beschleunigung einer fehlgeleiteten Moderne empfehlen, anderes als ein leidenschaftliches Plädoyer für die Lektüre von Büchern und das vermeintlich nutzlose Lesen als unserer wichtigsten Kulturtechnik? Wohlgemerkt, das Lesen von Büchern und nicht so sehr die Betrachtung von Bildern, sei es im Museum oder auf dem Bildschirm, deren Rezeption, wenngleich in seiner semantischen Vielschichtigkeit dem Lesen durchaus vergleichbar, eben doch etwas völlig anderes darstellt.
Lesen als subversive kulturelle Praxis
In seinen Noten zur Literatur bemerkt Adorno an einer Stelle, dass "die objektive Fülle von Bedeutungen, die in jedem geistigen Phänomen verkapselt sind, um sich zu enthüllen vom Empfangenden eben jene Spontaneität verlangten, die im Namen objektiver Disziplin geahndet wird". Diese Bemerkung zielt auf einen eklatanten Grundwiderspruch akademischer Lektüre, nämlich der fälschlichen Annahme, dass man, um einen Text "wirklich" zu verstehen, sich diesem nur im Rahmen eines mühsam erlernten methodologischen Regelwerks nähern könne; und dies wohlwissend, dass gerade die im Text verborgene Fülle an Bedeutungen, sich mit keiner Methode allumfänglich sichtbar machen lässt.
Was also bleibt vom Lesen, wenn es, egal ob als kritisch-literaturwissenschaftliche oder als laienhaft, auf Zeitvertreib und Ablenkung abgestellte Lektüre immer nur Teilaspekte, und überdies flüchtige Teilaspekte, eines verborgenen Ganzen des Textes zu erschließen vermag? Da wäre zum einen seine zeitliche Dimension, denn Lesen — zumindest das Lesen von Büchern, egal ob es sich um Sachbücher oder Fiktionen handelt — benötigt Zeit. Die durchschnittliche Verweildauer vor einem Bild im Museum beträgt nur wenige Minuten, doch für ein Buch bedarf es mehrere Stunden, wenn nicht gar Tage oder Wochen.
Lesen verlangsamt, und es gibt uns dadurch wertvolle Zeit zurück, die wir dringend brauchen, um im Arendtschen Sinn zur "Besinnung" zu kommen. Und zum anderen versagt sich jede, noch so methodisch ausgeklügelte Lektüre der Vereinnahmung des Textes als Widerspiegelung von Wahrheit. Jedes Lesen bleibt notwendig fragmentarisch und widersprüchlich, und lässt bestenfalls spontane, subjektive empfundene Einsichten zu.
Wie der amerikanische Literaturwissenschaftler Richard Poirier in einem Essay über den Einfluss der neuen Medien auf die Literatur gezeigt hat, ist es jedoch genau dieser brüchige, scheinbar nutzlose Dialog des Lesers mit dem sprachlichen Text, der Literatur so wertvoll macht: für das Verständnis der sprachlichen Bedeutungsambivalenzen außerhalb des Textes, für die Strategien der Entmächtigung und des Machterhalts in der nicht-fiktionalen Welt, für die Frage nach dem Mensch-Sein an sich.
Man kann darüber diskutieren, ob Bilder etwa im Film oder in der Videokunst nicht ähnlich komplexe Strukturen beherbergen, wie dies die besten literarischen Texte tun. Und man könnte anführen, dass es Zeit wird, die angestaubte Lektüre an den Universitäten durch neue, visuelle Formen der Repräsentation von Welt, wie etwa das Video- oder Computerspiel zu ersetzen. Oder auch, dass die Literatur niemals ein "unschuldiges" Medium war (jenseits von race, gender, and class), dass sie immer schon auf ein ganz bestimmtes, nämlich bürgerliches und gut ausgebildetes Publikum gezielt hat, und daher kaum in die Breite der Bevölkerung seine Wirksamkeit entfalten konnte.
Letztlich kann jedoch keines dieser bedenkenswerten Argumente den Mehrwert des Literarischen als Form schwer zugänglicher, zweckentfremdeter Auseinandersetzung mit den sprachlichen Gegebenheiten der Conditio Humana aufwiegen.
In einem akademischen Umfeld, in dem der Ruf nach Szientifizierung und messbaren, allgemein verbindlichen Standards auch in den Geisteswissenschaften immer lauter wird, scheint mir das Lesen von Büchern geradezu unverzichtbar. Was gestern noch als bürgerliche Form ideologiegeleiteter Erkenntnis (nicht ganz zu Unrecht) kritisiert wurde, ist im heutigen gesellschaftlichen Umfeld nichts weniger als eine in jeder Hinsicht subversive kulturelle Praxis. Sie lässt uns für die Dauer der Lektüre aus dem Kreislauf der Waren und Vermarktung heraustreten, führt uns die Widersprüchlich- und Vieldeutigkeit sprachlich formulierter Wahrheitsbehauptungen vor Augen und lässt uns dadurch weit über den Rand des Textes hinaus in doppelter Form zur "Be-sinnung" kommen: als gemeinsame Anstrengung aller Sinne wie als sinnlich erfahrbare Erkenntnis.
"One should start with an open mind", schreibt Pound am Anfang seines ABC des Lesens. Gutes Lesen, egal an welche Lektüre wir unsere Zeit "verschwenden", setzt notwendig die Bereitschaft voraus, sich verführen und vom einmal eingeschlagenen Weg ablenken zu lassen. In einem wunderbaren Buch über das, was wir beim Lesen "sehen", schreibt der beim New Yorker Alfred Knopf Verlag als Art Director arbeitende Peter Mendelsund: "A novel invites our interpretative skills but it also invites our minds to wander." Lesen und Verstehen sind anstrengend, aber gutes Lesen versetzt uns auch in Erstaunen, indem es unsere Gedanken auf Wanderschaft schickt.
