Spanien: Zaghafter Eingriff in Arbeitsmarktreform, Google- und Börsensteuer
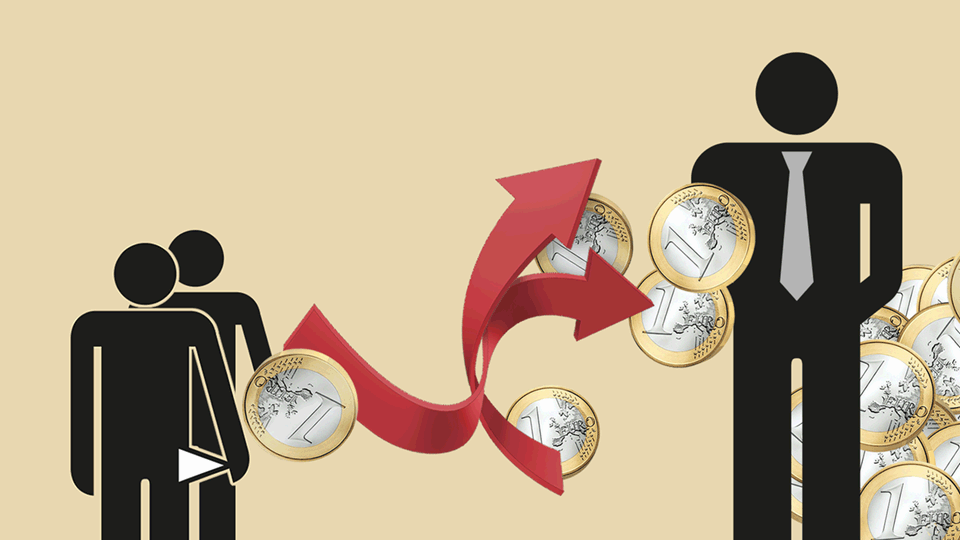
Aktienkäufe sollen mit 0,2% besteuert werden, Firmen wie Google mit ganzen 3% und die aggressive Arbeitsmarktreform wird nicht gestrichen, nur zaghaft reformiert
Eigentlich hatten die spanischen Sozialdemokraten (PSOE) in den verschiedenen Wahlkämpfen der vergangenen Jahre immer wieder versprochen, die "extrem aggressive Arbeitsmarktreform" der rechtskonservativen Vorgänger aus dem Jahr 2012 zu streichen, gegen die die Gewerkschaften sogar mit Generalstreiks Sturm gelaufen sind.
Der Koalitionspartner, die Linkskoalition "Unidas Podemos" (Gemeinsam können wir es/UP), hatte stets sogar gefordert, die PSOE-Arbeitsmarktreform zu streichen, mit der schon zu Beginn der Finanz- und Wirtschaftskrise der Kündigungsschutz und andere Rechte massiv beschnitten wurden, wogegen es auch zu Generalstreiks kam.
Vom Schleifen der PSOE-Reform spricht in dieser Regierungskoalition nun aber niemand mehr. Statt die extreme Reform der Vorgänger zu streichen, doktert die neue Regierung nun sehr zaghaft an Teilbereichen herum. Statt die "schädlichsten" Auswirkungen zu beseitigen, wurde am Dienstag nur ein Artikel gestrichen.
Menschen im Krankheitsfall kündigen
Per Dekret wurde der völlig absurde Artikel 52 d) geschleift. Zeitungen, die der Regierungskoalition nahestehen, sprechen wie Eldiario.es aber davon, dass mit der "Demontage der Arbeitsmarktreform" begonnen worden sei.
Eine reale Demontage würde sich wohl kaum auf die Streichung der besonders drastischen Spitze des Eisbergs beschränken. Der 52 d) hatte für Furore gesorgt, da er es bis heute ermöglichte, Beschäftigte zu kündigen, die innerhalb von zwei aufeinander folgenden Monaten an acht Tagen vom Arzt krankgeschrieben wurden.
Die Praxis, Menschen wegen Krankheiten kündigen zu können (sie also krank zum Arbeiten zu zwingen), hatte das Verfassungsgericht im vergangenen Oktober bestätigt. Das wurde mit der "Unternehmensfreiheit" und der "Verteidigung der Produktivität" begründet. Das ist seit gestern nicht mehr möglich, allerdings muss das Dekret noch im Parlament bestätigt werden und unklar ist, was mit anhängigen Verfahren ist.
Unsichere Mehrheiten und Menschenrechte
Angesichts der fragilen Mehrheit, ist nicht sicher, ob die Bestätigung kommt. Der Unsicherheit darüber ist auch die Frage geschuldet, ob man sich nur an die Spitze der Spitze herantraut und warum man nicht sofort tiefer in die Reform eingegriffen hat. Der Streichung des 52 d) dürfte auch die christdemokratische Baskisch-Nationalistische Partei (PNV) zustimmen. Welche weiteren Eingriffe die sehr unternehmerfreundliche PNV mitträgt, von deren Stimmen die Regierung unter Pedro Sánchez abhängt, ist allerdings fraglich.
"Über Menschenrechte wird nicht verhandelt", erklärte die linke Arbeitsministerin Yolanda Díaz dazu, dass nicht über die Frage im Sozialpakt mit Gewerkschaften und Unternehmerverbänden verhandelt wurde, wie kürzlich die beschlossene Anhebung des Mindestlohns um 50 Euro auf 950 Euro. Sie verwies darauf, dass besonders Frauen, behinderte Menschen und chronisch Kranke betroffen waren.
Damit sei gegen die "Angemessenheit und Verhältnismäßigkeit" verstoßen worden, die der Europäische Gerichtshof (EuGH) in Luxemburg fordert. Höchste spanische Gerichte winken immer wieder Maßnahmen durch, die offensichtlich gegen europäische Rechtsprechung verstoßen. Allerdings würde man sich auch freuen, wenn diese Regierung auch in anderen Fragen, wie zur Folter politischer Gefangener und dem katalanischen Selbstbestimmungsrecht, die Menschenrechte und EuGH-Urteile über alles stellen würde.
Gespannt darf man sein, welche Maßnahmen im Sozialpakt beschlossen werden, wohin alle weiteren Veränderungen delegiert werden. Klar ist damit, dass es tiefgreifende Eingriffe kaum geben wird. Die linke UP musste in der Frage des Mindestlohns schon eine dicke Kröte schlucken und von ihrer Forderung nach monatlich 1.200 Euro abrücken.
IMF: Ziele der früheren Arbeitsmarktreformen nicht erreicht
Allerdings kommt im Fall der Arbeitsmarktreformen sogar der Internationale Währungsfonds (IWF), der sie einst beklatscht hatte, nun zu dem Ergebnis, dass sie die angeblich angestrebten Ziele nicht erreicht haben. Dabei war das eigentlich allen klar. Verkauft wurden die praktische Abschaffung des Kündigungsschutzes, die massive Kürzung von Abfindungen und die Aushebelung von Flächentarifverträgen damit, dass damit unbefristete Beschäftigung gefördert werde.
Das Gegenteil war der Fall. Die Zahl derer, die trotz Arbeit als Arm gelten, hat auch nach IWF-Angaben zugenommen. Zwar seien Jobs geschaffen worden, nun werden aber 90% aller Verträge befristet geschlossen, ein Drittel der Verträge mit einer Dauer von nicht einmal einer Woche.
Warum ohne solche Reformen mehr und bessere Beschäftigung im Nachbarland Portugal geschaffen wurden, wo man den IWF-Austeritätskurs aufgekündigt hatte, erklärt der IWF natürlich nicht. In Spanien sind schon 22% aller Verträge befristet, die Quote ist schon doppelt so hoch wie im europäischen Durchschnitt. Die Quote hat sich durch die beiden Arbeitsmarktreformen seit Beginn der Krise praktisch verdoppelt.
Reaktionen der Unternehmer und der Gewerkschaften
Während die Gewerkschaften die Streichung des "perversen" Artikels begrüßen, hält sich die Begeisterung bei Unternehmerverbänden in Grenzen. Die hängen ihre Kritik aber niedrig, da sie den Sozialpakt nicht torpedieren wollen. Dort wollen sie weiter reale Veränderungen verhindern, wie im Fall des Mindestlohns.
Der Sprecher des großen CEOE erklärte, dass das Dekret nur eine "nebensächliche Frage" berührt habe. David García-Maroto kritisiert trotz allem fehlende Verhandlungen darüber im Sozialpakt. Die CEOE hofft, dass nun Lösungen für "Absentismus", der angeblich hoch sei, gefunden werden.
Minimalmaßnahmen bei den Großen: Tobin-Tax und Google-Tax
Dazu wurden zwei weitere zaghafte Vorgänge, mit denen vor allem nach links geblinkt wird, beschlossen: angeblich eine "Tobin-Tax" (also Finanztransaktionssteuer) und eine "Google-Tax". Tatsächlich hat die spanische Steuer nichts mit der Tobin-Tax zu tun. Denn besteuert werden sollen nur Aktienkäufe. Ausgenommen sind zudem Börsengänge.
Treffen soll die Steuer auch nur Firmen mit einem Gesellschafterkapital von mehr als einer Milliarde Euro, also nicht einmal alle im spanischen Leitindex Ibex35 gelisteten Unternehmen.
Und die Steuer soll zudem nur lächerliche 0,2% betragen. Man bedenke, dass sogar die Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel 10% beträgt. Mit der Tobin-Tax sollten eigentlich die besonders gefährlichen Spekulationsgeschäfte an den Börsen über Derivate als Lehre aus der Finanzkrise reguliert werden. Seit mehr als Jahren wird sie auch auf EU-Ebene immer wieder vertagt.
Und bei der beschlossenen "Google-Tax", mit der große global agierende Internetkonzernen endlich auch etwas zur Kasse gebeten werden sollen, fällt die Bilanz ebenso ernüchternd aus. Die Koalitionsregierung unter Sánchez will sie nur mit lächerlichen 3% besteuern. Und das gilt auch nur für Firmen, die weltweit einen Umsatz von 750 Millionen Euro und mindestens 3 Millionen in Spanien haben.
Die Vernebelung hier ist noch größer, denn real soll sie erst im letzten Quartal gelten und eingezogen werden, weshalb die angeblichen Pläne, über beide Steuern zusätzliche zwei Milliarden Euro in die Kassen zu spülen, schon wieder nach unten korrigiert wurden. Nun soll es etwa eine Milliarde werden. Die geplante Einnahmereduzierung passt kaum damit zusammen, dass die Wirtschaftsministerin Nadia María Calviño erklärt, dass nur der Einzug der Steuer auf das Jahresende vertagt worden sei.
Calviño bekräftigt, dass man auf europäischen und internationalen Niveau an einer Lösung arbeite, aber man derweil auf nationale Fortschritte nicht verzichten wolle. Kopiert wird allerdings in Spanien nur das schlechte französische Modell. Und das Vorgehen in Madrid zeigt, dass es sogar unklar ist, ob die Google-Steuer überhaupt kommt und im Dezember eingezogen wird. Denn im Raum stehen die Drohungen der US-Regierung unter Donald Trump, der Steuern für Internetgiganten verhindern will.
Zwar gibt sich Spanien gegenüber den Trump-Drohungen mit Importzöllen derzeit unnachgiebig, doch bleibt abzuwarten, ob Spanien nicht doch einknickt.
Welchen Sinn macht es sonst, den Einzug der Steuer auf das Jahresende zu verschieben. Trump hatte Frankreich schon mit Maßnahmen gedroht und droht nun auch Spanien. Die Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung fordert von seinen 35 Mitgliedsstaaten längst, zu denen auch die USA gehören, eine Steuer auf die Aktivitäten der großen Internetfirmen zu erheben, die sich über Tricks aus der lokalen Steuern in den Ländern herausstehlen, in denen sie Umsatz machen und Gewinne erzielen.
