Wissen, glauben, zweifeln, hoffen
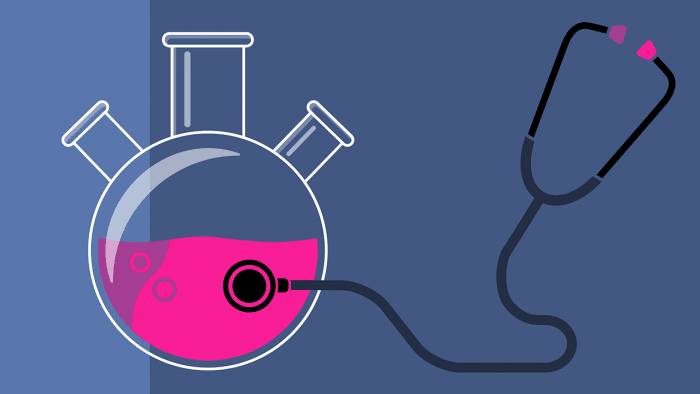
Neuerdings hört man wieder auf die Wissenschaft. Ist das eine gute Entwicklung?
Zu den zahlreichen zumindest vordergründig positiven Aspekten der Coronakrise gehört - neben sauberer Luft, billigem Sprit und der Freiheit, beliebig viel Knoblauch zu essen -, dass die Politik angeblich auf die Wissenschaft hört. Nun stimmt letzteres schon nur mit Einschränkungen. Die Politiker an der Macht hören bevorzugt auf diejenigen Wissenschaftler, die das sagen, was sie hören wollen, und die ihrerseits eben deswegen im Rampenlicht stehen. Die im Dunkeln sieht man nicht.
Und jedenfalls habe ich in den letzten Wochen den Eindruck, dass die Politiker vielleicht noch auf die Wissenschaft gehört haben, als es darum ging, Freiheitsentzug zu rechtfertigen, dann aber ziemlich schwerhörig geworden sind, als es darum geht, die Freiheit wieder zurückzugeben.
Das ist jedoch alles nicht sehr überraschend und verdient keine langen Überlegungen. Was mich viel mehr beschäftigt, ist die Frage, ob und wann ich mir überhaupt wünschen soll, dass Politiker oder andere Menschen sich nach "der Wissenschaft" richten.
Gerne würde ich rausblaffen: "Immer!" Schließlich bin ich Naturwissenschaftler, und bin es gerne. Aber kürzlich bin ich bei der Recherche zu einem ganz anderen Thema auf die Sache mit den weinenden Kindern gestoßen.
Schlechte Ratgeber
In den Fünfzigern bis Siebzigern begründeten John Bowlby und seine Schülerin Mary Ainsworth die Bindungsforschung. Bowlby stellte fest, dass Kleinkinder in den ersten beiden Lebensjahren eine feste Bindungsperson brauchen, die emotional als sicherer Hafen dient, um von dieser Geborgenheit aus die stürmischen Meere der Welt zu erkunden. Ainsworth etablierte später den "Fremde Situation"-Test, der die Bindungsqualität eines Kleinkindes operationalisiert. So konnte sie experimentell beweisen, dass Bowlby rechthatte und dass sicher gebundene Kinder - und das heißt konkret: Kinder, deren Bezugsperson üblicherweise auf ihre Bedürfnisse eingegangen ist - zu sozial kompetenten, resilienten Persönlichkeiten heranwachsen, unsicher gebundene eher nicht.
Als Bowlby diese Theorie zu etablieren versuchte, musste er gegen zwei denkbar verschiedene Strömungen ankämpfen, die damals die Kinderpsychologie beherrschten: Die Psychoanalytiker (zu denen Bowlby ursprünglich zählte) weigerten sich, Beziehungen zu realen Personen zu betrachten; für sie spielte sich alles Relevante in der Vorstellungswelt des Kindes ab. Die Behavioristen auf der anderen Seite glaubten nicht an innere Zustände und Weltmodelle des Kindes; für sie war alles Reiz, Reaktion und Konditionierung.
Es war daher folgerichtig, dass John B. Watson, der Begründer des Behaviorismus, in seinen Erziehungsratschlägen dekretierte, Mütter sollten ihre Kinder nicht auf den Schoß nehmen. Denn das Hochnehmen ist eine Belohnung; wer ein weinendes Kind auf den Arm nimmt, verstärkt damit - so die Theorie - das Weinen.
Mary Ainsworth wies nach, dass das Gegenteil stimmt: Kinder, die sogleich getröstet werden, wenn sie weinen, weinen nach einiger Zeit weniger als solche, die ignoriert werden. Aber das war über vierzig Jahre, nachdem Watson seinen Ratgeber "Psychological Care of Infant and Child" veröffentlich hatte. Er hatte seine drei Kinder selbst nach seinen Prinzipien erzogen; alle drei unternahmen später Selbstmordversuche, ein Sohn erfolgreich. Wie viele weitere Kinder mögen in diesen Jahrzehnten um seinetwillen traumatisiert worden sein?
Und: In welchem Bewusstsein? Doch wohl in der Gewissheit, auf die Wissenschaft zu hören. Jeder, der in den Vierzigern sein Kind weinen ließ (und was heißt, "in den Vierzigern"? - Wir haben noch bei der Erziehung unserer Kinder solche Sprüche gehört.), konnte das als wissenschaftlich und damit vernünftig verteidigen. Mütter, die ihrem Gefühl folgten, durften wohl als irrational, romantisch, nostalgisch und regelrecht kindswohlgefährdend abgestempelt werden.
Nicht glauben, nicht wissen
Ganz sicher ist es falsch, blind wissenschaftlichen Erklärungen zu glauben. Auch die Wissenschaft ist wechselnden Moden unterworfen. In den psychologischen Wissenschaften ist das besonders augenfällig: Psychoanalyse -> Behaviourismus -> Kognitivismus -> Verkörperte Kognition. Aber auch die Biologie muss gerade lernen, dass Lamarcksche Vererbung doch funktioniert. Und sogar die "harte" Physik ringt gerade um ein neues Weltmodell.
Wissenschaftler haben sich in der Vergangenheit immer wieder geirrt: Nein, die Sonne dreht sich nicht um die Erde. Nein, es gibt kein Phlogiston. Nein, es gibt keinen Äther. Nein, es gibt keine Urzeugung. Nein, Arten ändern sich nicht durch erworbene Vervollkommnung. Doch, Arten ändern sich durch erworbene Eigenschaften. Nein, die Hygiene im Kreissaal können wir nicht vernachlässigen. Nein, Geld ist kein neutrales Tauschmittel. Nein, subjektives Empfinden entsteht nicht im Gehirn. Doch, die Abbe-Grenze kann man unterschreiten...
Auch Mehrheiten helfen hier nicht weiter. Fast alle oben genannten Irrtümer wurden einst von der Mehrheit der Fachwissenschaftler geglaubt. Es waren immer wieder Außenseiter und Einzelkämpfer, die gegen alle Widerstände eine andere Sichtweise durchsetzten. Als im Jahr 1931 sich hundert Autoren gegen die allgemeine Relativitätstheorie aussprachen, brachte Einstein es auf den Punkt: "Hätte ich unrecht, würde ein einziger Autor genügen, um mich zu widerlegen."
Grundsätzlich ist es ein Kategorienfehler, Mehrheit zum Maßstab für Wahrheit zu machen. Dass 97% der Klimaforscher überzeugt sind, dass der Klimawandel menschgemacht ist, bedeutet schlicht: nichts. Es bedeutet nicht, dass es tatsächlich so sei. Es bedeutet ebensowenig, dass das Gegenteil der Fall sei. Diese vielzitierten 97% sind vermutlich die bedeutungsloseste Ziffernkombination der Geschichte; selbst die 42 hat mehr zu besagen.
Was folgt daraus jedoch? Sollen wir überhaupt nicht mehr auf Wissenschaftler hören, weil ihre Wahrheiten doch nur bis zum Kollektionswechsel gelten? Aber auf wen dann? Unser "Herz"? Mit Verlaub, sofern es nicht nur "bumm-bumm" sagt, redet es doch allzu oft der Gewohnheit nach dem Maul.
Keine Wissenschaft ist auch keine Lösung
Es ist ebenso naheliegend wie falsch, in diesem Dilemma auf das gegenteilige Extrem zu verfallen. Zwar ist wahrscheinlich die weit überwiegende Mehrheit dessen, was Wissenschaftler in der Vergangenheit für richtig gehalten haben, falsch. Trotzdem kann man das nicht abkürzen und sagen: Was Wissenschaftler für richtig halten, ist falsch.
"99% aller Arten sind ausgestorben. In erster Näherung kann man sagen, dass alle Arten ausgestorben sind" - so geht ein alter Statistikerwitz. Verallgemeinerungen übersehen das Besondere. Induktion ist nun einmal eine Methode, die außerhalb der Mathematik nicht funktioniert. (Die Auflösung dieses Irrtums verdanken wir übrigens David Hume; bis dahin hatte vermutlich die Mehrheit der Wissenschaftler Bacons Induktivismus vertreten.) Kurz: Es gibt keine allgemeine Regel. Weder haben Wissenschaftler immer recht, noch haben sie immer Unrecht.
Ich halte es z.B. für erwiesen, dass die Evolution stattgefunden hat. Über das "Wie?" ließe sich debattieren, aber eine bessere Idee als Mutation und Selektion ist mir leider noch nicht untergekommen. Und ich vermute, dass der Mensch am aktuellen Klimawandel schuld ist. Nicht, weil ich irgendetwas davon verstünde. Auch nicht wegen oder trotz irgendwelcher Mehrheiten. Sondern weil ich, wann immer ich mich mit "Klimaskeptikern" befasst habe, nur Argumente gesehen habe, die von der Gegenseite längst widerlegt waren. Ich habe offensichtlichen Unsinn vorgesetzt bekommen, der als Offenbarung gehandelt wurde. Habe bösartige Unterstellungen und persönliche Angriffe beobachtet. Und auf der anderen Seite Wissenschaftler, die geduldig und transparent Fakten dagegenhalten.
Argumentationsweisen können eine gewisse Orientierung bieten. Selbst da, wo man vom Thema keinerlei Ahnung hat, ist es meist möglich zu erkennen, welcher der Kontrahenten sachlich argumentiert. Und wer sich in Häme, Sarkasmus, Ad-hominem-Argumente und Ausweichmanöver rettet.
Auch diese Herangehensweise sichert keine Erkenntnis der Wahrheit. Genau genommen kann man dadurch nur herausfinden, welche Seite die klügeren Diskutanten aufbietet und die aktuell verfügbaren Daten besser kennt. Dass sie diese Daten auch "richtig" interpretieren, folgt nicht daraus. Aber sie verschiebt den Blickwinkel auf hilfreiche Weise: Fort von den Akteuren, fort auch von den Inhalten - und hin zu den Methoden.
Und wenn ich Unrecht hätte?
Denn: Wir können und sollten auch nicht auf "die Wissenschaft" hören, wenn wir damit Wissenschaftler oder ihre Strukturen meinen. Wir können und sollten auch nicht auf "die Wissenschaft" hören, wenn wir damit Theorien und Lehrbücher meinen. Aber: Wir können und sollten wie "Wissenschaft" reden, indem wir ihre Methoden der Erkenntnisgewinnung anwenden.
Allzu viele Leute - auch allzu viele Journalisten, wie die letzten Monate einmal mehr gezeigt haben - verwechseln das. Wissenschaftlich denken heißt nicht, Wissenschaft nachplappern. Es heißt nicht, den aktuellen Erkenntnisstand der Forschung als Glaubensbekenntnis aufzusaugen und nachzubeten. Es heißt nicht, Ungläubigen mit Exkommunikation und der "zweiten Welle" zu drohen. Sondern es heißt, im Gegenteil, zweierlei zu tun:
Erstens: Argumentieren. Nur das, was man argumentativ verteidigen kann, hat man auch verstanden. Nur das, was man durch Daten und Quellen stützen kann, ist wert, vertreten zu werden. Dabei verlangt gutes Argumentieren auch die Fähigkeit zum Zuhören und Verstehen. Denn ein passender und überzeugender Einwand muss auf den Standpunkt des Gegners eingehen. Wissenschaftlich zu denken bedeutet somit auch, alle Gegenargumente ernst zu nehmen und zu durchdenken - ironischerweise ein Anspruch, der in der viel geschmähten Scholastik vorbildlich umgesetzt wurde.
Womit wir beim zweiten Merkmal wissenschaftlichen Denkens sind: Gewissheiten vermeiden, Meinungen entlarven, Behauptungen hinterfragen. Mit einem Wort: zweifeln. Und zwar - und das unterscheidet den echten Skeptiker vom Pseudoskeptiker á là GWUP und Richard Dawkins -: Zweifeln an dem, was man selbst glaubt. Nicht an dem, was andere glauben. (Inwiefern wäre das eine Leistung?)
Die Welt ist nicht geheuer
Zweifeln bedeutet, sich von der Illusion einer sicheren Welt zu verabschieden. Ignoramus et ignorabimus. Wir werden die Wahrheit nicht erkennen. Die Welt bleibt immer unbegreiflich. So wird jede Debatte zum Fechtkampf auf dem Drahtseil. Und darunter der Abgrund. Da überlegt man besser dreimal, ob der Kampf sich lohnt. Ändert er etwas? Zum Besseren?
Am Badesee wurde ich im letzten Sommer unfreiwilliger Ohrenzeuge eines mitteilsamen Reichsbürgers, der erzählte, dass er in den Knast gewandert sei, weil er vor der Reichsflagge auf seinem Balkon salutiert hatte und ein Nachbar ihn angezeigt hatte. Ganz unabhängig vom Wahrheitsgehalt der Reichsbürgerideologie: Was für ein Idiot! War es das wert? Hat es was gebracht? Hätte es überhaupt etwas Positives bringen können?
Und der Klimawandel: Ob er menschgemacht ist, ist doch völlig irrelevant und akademisch. Erstens wird die Menschheit nicht aufhören, mehr und mehr CO2 auszustoßen, solange sie an einem Wirtschaftssystem festhält, das zwingend quantitatives Wachstum braucht - egal, was Wissenschaftler und Politiker beschließen. Und zweitens ist es so oder so keine sonderlich pfiffige Idee, den Fortbestand eines Gesellschaftssystems vom Verbrauch einer endlichen Ressource abhängig zu machen. Also: Nicht streiten. Fahrrad fahren.
Es ergibt selten Sinn, über die Weltsysteme und die Gestirne zu streiten (es sei denn natürlich, es macht beiden Seiten Spaß). Mit einer gewissen Erfolgsaussicht können wir nur für die Probleme, die vor uns liegen, anhand von Zweifel und Argumenten die nach aktuellem Wissensstand beste Lösung finden. Das wäre eine wissenschaftliche Vorgehensweise. Und das ist alles.
Als ich vor vielen Jahren anfing, mich mit Wissenschafts- und Erkenntnistheorie zu befassen, fragte ich einen reiferen Philosophiestudenten ratlos: "Wenn ich weiß, dass ich nichts wissen kann, dann kann ich auch nichts glauben, denn Glauben heißt ja, zu wissen glauben. Was bleibt mir dann?" Und er antwortete - und ich weiß bis heute nicht, ob das eine spontane Sottise war oder lang gereifte Weisheit, aber für mich ist es heute letzteres: "Wir können nichts wissen, wir können auch nichts mehr glauben. Wir können nur noch hoffen."
Doch um das zu ertragen, muss man vermutlich sicher gebunden sein.
