Stabilitätsfixierung führt in die Zombiewirtschaft
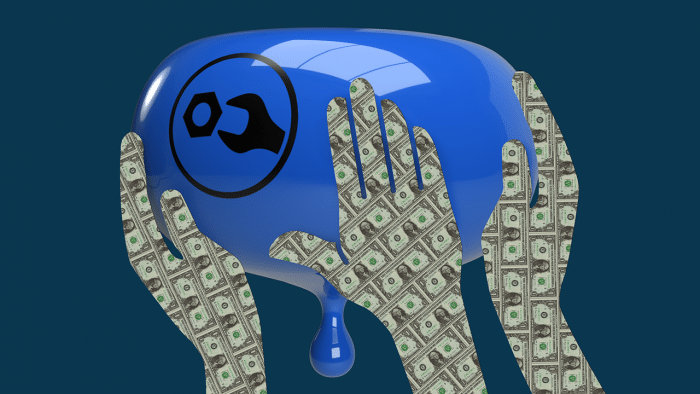
In der Corona-Krise soll Deutschland Stabilitätsanker sein. Dabei braucht Europa nichts dringender als einen von neuen Technologien getriebenen Wandel, um die Zombiewirtschaft zu überwinden. Gastbeitrag
Bundeskanzlerin Angela Merkels Kernbotschaften zur deutschen EU-Ratspräsidentschaft, die am 1. Juli begann, lautet: Deutschland soll sich nicht etwa als Vorreiter des technologischen Wandels beweisen, sondern die politische und wirtschaftliche Stabilisierung des Bestehenden sicherstellen. Es gelte, Europa "als Stabilitätsanker in der Welt zu stärken".1
Damit die Corona Pandemie soziale und wirtschaftliche Spaltungen nicht vertiefe, soll die akute wirtschaftliche Krise unterdrückt werden. In ihrer Regierungserklärung am 18. Juni begründete Merkel die billionenschwere Anti-Krisenpolitik:
"Wir dürfen nicht naiv sein, die antidemokratischen Kräfte, die radikalen, autoritären Bewegungen warten ja nur auf ökonomische Krisen, um sie dann politisch zu missbrauchen."
Veränderungsskepsis
Mit dieser Agenda bedient Merkel das in der Bevölkerung sehr ausgeprägte Bedürfnis nach wirtschaftlicher und politischer Stabilität und Sicherheit. Diese Orientierung speist sich aus einer soziokulturell bedingten Befürchtung, dass wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Wandel nicht in erster Linie neue Chancen und Möglichkeiten eröffnet, sondern vor allem Risiken birgt, die es zu vermeiden gilt.
Die wirtschaftliche Entwicklung der letzten Jahrzehnte hat dazu beigetragen, dass sich diese Einstellung verfestigen konnte. Viele glauben heute, der scheinbar beschleunigte technologische Wandel und die vermeintlich rapide voranschreitende Globalisierung seien verantwortlich für stagnierenden Wohlstand.
Und die Stagnation ist unübersehbar: Trotz des konjunkturellen Aufschwungs seit der Finanzkrise 2008 hat die große Masse der Erwerbstätigen nur noch geringe oder keine Wohlstandszuwächse erreicht, denn die Reallöhne sind seit Mitte der 1990er Jahre nur noch gut 0,5 Prozent jährlich gestiegen.
In Anbetracht limitierter Reallohngewinne und der generellen Skepsis gegenüber Veränderung erscheint die von der Corona-Pandemie ausgehende wirtschaftliche Krise als fundamentale Bedrohung. Bei zuletzt mehr als 7,3 Millionen Kurzarbeitern in Deutschland befürchten viele Erwerbstätige völlig zurecht, dass das dicke Ende in Gestalt einer dramatischen Entlassungswelle nicht mehr lange auf sich warten lassen wird.
Diese Gefahr ist umso realer, weil die Corona-Krise von einer konjunkturellen Rezession überlagert wird, die sich bereits im letzten Jahr manifestierte. In der Industrie, war die Wirtschaftsleistung im Vergleich zum Anfang des Jahres 2018 bereits um 6 Prozent zurückgegangen.2
Derzeit sind 31 Prozent der Beschäftigten in der Industrie in Kurzarbeit und auch in der Automobilindustrie, seit Jahrzehnten das stabile Rückgrat einer immer weniger wachsenden Wirtschaft, zeichnet sich eine Entlassungswelle schon sehr deutlich ab.
Staatliche Institutionen einschließlich der Zentralbanken tendierten wirtschaftspolitisch bereits seit den 1970er Jahren dazu, den nach dem Wirtschaftswunder wiedereinsetzenden Konjunkturzyklus zu zähmen. Sie agieren nicht nur in Krisenzeiten, sondern auch während konjunktureller Aufschwünge stabilisierend.
Ihr Ziel ist es, bestehende Unternehmen und deren Geschäftsmodelle möglichst zu erhalten. Notfalls geschieht dies mit Subventionen oder Regulierungen zu Lasten neuer Wettbewerber. Diese Herangehensweise zeigt sich seit den 1980er Jahren in aller Deutlichkeit an einer asymmetrischen Geldpolitik.3
In jedem Konjunkturzyklus reagierten die Zentralbanken mit Zinssenkungen, um die Krise abzumildern. Im darauffolgenden Aufschwung hoben sie die Zinsen nicht mehr auf das Vorkrisenniveau an. Die Wirtschaftspolitik hat sich so in zunehmendem Maß an den schwächsten und unprofitabelsten Unternehmen orientiert und versucht, diese zu erhalten.
Entschleunigter technologischer Wandel
Diese jahrzehntelange Stabilitätsorientierung hat immer höhere Hürden für technologischen Wandel aufgebaut. Die große Masse der Unternehmen erreicht nicht mehr die erforderliche Profitabilität, um die hohen Risiken eingehen zu können, die mit der Einführung technologischer Innovationen verbunden sind. Entgegen der verbreiteten Einschätzung eines rapiden technologischen Wandels, lässt sich an der Entwicklung der Arbeitsproduktivität erkennen, dass dieser faktisch immer schwächer geworden ist.
Da es den Unternehmen in Deutschland kaum mehr gelingt, technologische Neuerungen einzuführen, stagniert die Arbeitsproduktivität inzwischen. Und die Arbeitsproduktivität ist definitiv der aussagekräftigste Indikator für technologischen Wandel.
Seit vielen Jahren weist die wirtschaftswissenschaftliche Forschung darauf hin, dass die Staaten der entwickelten Volkswirtschaften mit ihrer einseitigen Stabilitätsorientierung Rahmenbedingungen für die Herausbildung einer Zombiewirtschaft geschaffen haben. Einer zunehmenden Anzahl Unternehmen gelingt es wirtschaftlich zu überleben, obwohl sie nicht profitabel sind.
In Deutschland war bereits 2013 mehr als zwölf Prozent des Kapitalstocks in solchen Zombieunternehmen gebunden.4 Die Wirtschaftsauskunftei Creditreform geht von einem Zombieanteil von 15,4 Prozent der Unternehmen aus.5
Bei diesen Unternehmen reichte bereits der in den letzten Jahren vor der Corona-Krise erzielte operative Gewinn nicht mehr aus, um die anfallenden Kreditzinsen zu bedienen.
Das gegenwärtige Niedrigzinsumfeld und der Druck auf die Banken, auch weniger kreditwürdige Unternehmen mit billigem Geld über die Runden zu helfen, sorgt für wirtschaftliche Stabilität. Sie basiert letztlich darauf, dass solche Zombieunternehmen nicht aufgeben müssen.
Da jedoch nicht nur diese untoten Unternehmen, sondern auch die große Masse der Unternehmen eine zu geringe Profitabilität aufweisen, investieren die meisten Firmen nur noch wenig. Die Folge ist das rückläufige Wachstum der Arbeitsproduktivität. Langfristig unterhöhlt dies die Wettbewerbsfähigkeit und blockiert Reallohnsteigerungen in der gesamten Wirtschaft.
Durch die schleichende Aushöhlung der produktiven Basis ist mittlerweile eine finanzialisierte Wirtschaft entstanden. Die zeichnet sich dadurch aus, dass die Vermögenspreise und die ihnen zugrundeliegenden realen wertschöpfenden Kapazitäten immer stärker divergieren. Vereinfacht gesagt: Viele Firmen sind auf dem Papier mehr wert als in Wirklichkeit. So wird das Gesamtgefüge immer instabiler und anfälliger für Krisen, und diese Krisen werden aufgrund der aufgestauten Probleme immer schwerer zu beherrschen.
In der Finanzkrise 2008 war die Rettung der Banken notwendig, um die befürchtete Kernschmelze des Finanzsystems zu verhindern. Im Anschluss an die Rettung ging es staatlichen Institutionen und den Zentralbanken darum, die finanzialisierte Wirtschaft möglichst nicht zu destabilisieren. Daher wurden genau die Verhältnisse, die die Finanzkrise ausgelöst hatten, wiederhergestellt und sogar ausgebaut, in der Hoffnung, das fragile Gebilde zu stabilisieren.
Gleiches gilt für die ungelöste Staatschuldenkrise der Eurozone. Deren Eskalation im Jahr 2012 und der unkontrollierte Zusammenbruch des Euro konnten zwar verhindert werden, die Verschuldungsproblematik ließ sich jedoch nicht lösen. Um diese Verhältnisse auch weiterhin zu stabilisieren, sind die nun auf EU-Ebene mobilisierten Rettungsbillionen geradezu eine unabdingbare Notwendigkeit. Man kommt nicht mehr raus aus dem System.
Abwärtsspirale
Die staatliche Stabilitätsorientierung hat eine Abwärtsspirale in Gang gesetzt, in der eine durch niedrige Profitabilität und stagnierende Arbeitsproduktivität fundamental geschwächte Wirtschaft immer neue Stützen benötigt. Doch weil die Ursachen der Malaise bestehen bleiben, machen die Stützmaßnahmen das Gefüge immer fragiler und lassen weitere Stabilisierungsschritte notwendig erscheinen.
Für die Erwerbstätigen sind das keine guten Aussichten: Zu ausbleibenden Wohlstandseffekten wegen stagnierender oder zukünftig vermutlich sogar fallender Reallöhne - wie bereits heute in Japan - kommen nun noch krisenbedingte Arbeitsplatzverluste hinzu. Da die Rettungsbillionen der Staaten und Zentralbanken darauf abzielen, das Massensterben der Zombieunternehmen zu verhindern, bleibt die erforderliche Entwertung privaten Kapitalvermögens aus und die Rückführung der Vermögenspreise auf die ihnen zugrundeliegenden realen Werte wird verhindert.
Die Stabilitätspolitik basiert demnach nicht nur auf der gesellschaftlich tief verankerten Veränderungsskepsis, sondern auch auf dem Schutz mächtiger Partikularinteressen von begüterten Menschen, die sich einer Entwertung ihrer Vermögen entgegenstemmen.
Um die von der Zombiewirtschaft schleichende Wohlstandaushöhlung zu beenden, muss der Teufelskreis der Rettungspolitik durchbrochen werden. Die Grundlage hierfür läge im Eingeständnis, dass es den vermeintlich beschleunigten technologischen Wandel, der für Wohlstandsverluste verantwortlich gemacht wird, nicht gibt.
Die wahren Ursachen heutiger sozialer Probleme liegen in der extrem limitierten Innovationskraft der Wirtschaft, die wirtschaftspolitisch gehemmt oder sogar blockiert wird. Gerade in der Corona-Krise und der sie begleitenden konjunkturellen Rezession bräuchte es staatliche Institutionen, die auf Veränderung und nicht auf Bewahrung setzen.
Der Staat müsste die Rahmenbedingungen schaffen, in denen die Zombieunternehmen sich restrukturieren oder ableben. Durch langfristig angelegte "Apollo-Programme" müsste zudem der technologischen Wandel angeschoben werden, der dringend benötigt wird, um neue und besser bezahlte Jobs zu schaffen.
Von Alexander Horn ist im Novo Argumente Verlag aktuell das Buch erschienen: "Die Zombiewirtschaft - Warum die Politik Innovation behindert und die Unternehmen in Deutschland zu Wohlstandsbremsen geworden sind". Mit Beiträgen von Michael von Prollius und Phil Mullan.
