Die elende Sehnsucht nach "Normalität"
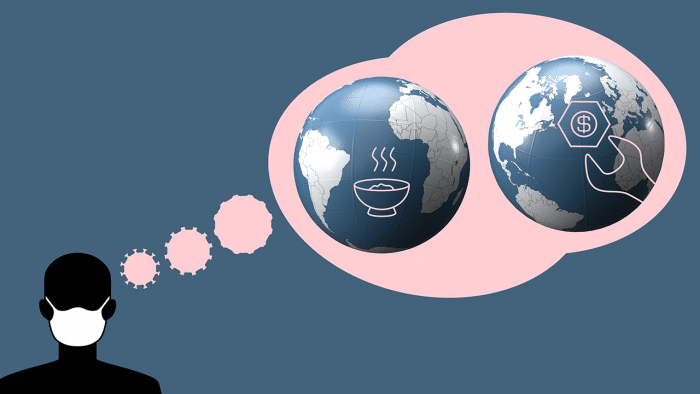
Der Ausnahmefall des erschwerten Lebensunterhalts wirft ein Licht auf die Existenz- und Überlebensbedingung, die den erwerbsbürgerlichen Alltag beherrscht
Da gibt es Zeitgenossen, die sich über staatliche Freiheitsberaubung beklagen, weil sie gelegentlich einen Mund-Nasen-Schutz tragen sollen, um die Ausbreitung des Coronavirus zu hemmen. Die merken offenbar gar nicht, was sie damit über ihre bürgerliche Freiheit zu Protokoll geben. Aber was soll man sich auch von Leuten erwarten, die "quer" für eine löbliche Eigenschaft des "Denkens" halten oder die allen Ernstes gebieterisch fordern, der Staat - die "Merkel-Diktatur" - solle ihnen gefälligst sofort erlauben, wieder frei zu sein, damit sie barrierefrei husten können.
Zahlreicher, das muss zur Ehre auch des deutschen Volkes gesagt sein, sind Mitbürger, die mehr oder weniger öffentlich darunter leiden bzw. öffentlich dafür bemitleidet werden, dass sie durch die staatliche Seuchenpolitik arbeitslos oder auf Kurzarbeit gesetzt werden und folglich mit ihrem Einkommen noch viel schlechter auskommen als sonst schon. Denen ist aber wenigstens so viel Unterscheidungsvermögen zuzumuten, dass sie aus dem ärgerlichen Sonderfall des Lockdowns nicht gleich den Trugschluss ziehen, der Normalfall des alltäglichen Arbeitslebens wäre an und für sich ein Inbegriff erstrebenswerter Verhältnisse.
Das ganze Leben hängt vom Geld ab
Immerhin wirft der Ausnahmefall des erschwerten Lebensunterhalts ein Licht auf die Existenz- und Überlebensbedingung, die den erwerbsbürgerlichen Alltag so unbedingt beherrscht, dass man ihre Gemeinheit aus lauter Gewohnheit schon gar nicht mehr bemerkt: Das ganze Leben hängt vom Geld ab, das Geld von der Chance, es zu verdienen, und diese Chance von Voraussetzungen, die eines auf jeden Fall nicht sind, nämlich im Griff derer, deren Existenz davon abhängt.
Auf der Grundlage und vergleichsweise ist es natürlich schön, wenn der Staat in vielen Fällen mit einem Geld einspringt, das er wohlweislich vorher von der Masse der womöglich von plötzlicher Einkommenslosigkeit Betroffenen eingesammelt hat: Der Sozialstaat mit seiner Arbeitslosenkasse und seinen Pflichtversicherungen macht sich jedenfalls nichts darüber vor, in welche Abhängigkeit er die Masse seiner Bürger stürzt und welche Drangsale denen daraus jederzeit erwachsen können. Wenn er im Notfall so segensreich aktiv wird, dann rückt das die Qualität des Normalfalls eines abhängigen Erwerbslebens in ein ziemlich grelles Licht: Wie wenig dazu gehört, damit aus dem gewohnten "von der Hand in den Mund"-Leben die Katastrophe bürgerlicher Existenzunfähigkeit wird. Innerhalb von Tagen - ohne Staatshilfe - oder Wochen - mit Sozialstaat - gerät vom Wohnen bis zum Essen alles in Gefahr. Grund genug, dem Wunsch nach "Rückkehr zum Alltag" mit ein bisschen Skepsis, auf alle Fälle dem ersehnten Alltag lieber mit ein bisschen kritischer Aufmerksamkeit zu begegnen.
Wo Hunger schlimmer als die Seuche wütet
Schließlich gibt es einen Haufen Leute, die einiges von den zahlreichen Berichten darüber zur Kenntnis nehmen, wie elend es den Massen in den sogenannten armen Ländern geht, wenn die zwecks Seuchenbekämpfung um ihre Subsistenz gebracht, womöglich vollends in ihren Hütten eingesperrt werden: Dass da der Hunger schlimmer wütet als die Seuche.
Wen das gleichgültig lässt, dem kann man nur dazu gratulieren, wie bequem er sich in seiner Weltfremdheit eingerichtet hat. Wen die Brutalität der Lockdown-Folgen in entfernten Ländern wenigstens irritiert, der sollte sich trotzdem davor hüten, dem derzeit außer Kraft gesetzten Normalfall, der sonst dort herrscht, mit einem wie groß oder klein auch immer geschriebenen "immerhin" eine gewisse Resttauglichkeit für menschliches Überleben zu bescheinigen - was übrigens, nur das als Lesetipp, die implizite Botschaft all der teils besorgten, teils empörten, teils betont sachlichen Berichte über schwere Einzelschicksale ist, über entwurzelte indische Saisonarbeiter oder noch irgendwie vergnügte Favela-Bewohner, mit denen seriöse Medien ihr Publikum unterhaltsam aufklären.
Auch da wirft die Brutalität der Ausnahme in Wahrheit nur ein Licht auf den unrettbar brutalen Normalfall, der sich von den Unerfreulichkeiten einer abhängigen Existenz in marktwirtschaftlich bessergestellten Klimazonen hauptsächlich in dem einen Punkt unterscheidet: Die dauernd wackligen bis prekären Existenzen im "wohlhabenden" Norden und Westen der Welt kommen überhaupt - irgendwie, mit Hilfe sozialstaatlicher Umverteilung - über die Runden, weil sie fürs globalisierte kapitalistische Geschäftsleben den Tatbestand der nützlichen Armut erfüllen, zu deutsch: der durch entsprechend bemessene Löhne ständig reproduzierten Not, sich für fremden geschäftlichen Nutzen dienstbar zur Verfügung zu stellen.
Andernorts ist nicht einmal diese Sorte Dienstbarkeit gefragt, oder nur zu Bedingungen, die dem existenzvernichtenden Verdikt der kompletten Unbrauchbarkeit ganzer Bevölkerungsteile fürs Weltgeschäft mit dem Kapitalwachstum verdammt nahe kommen. Vom Lockdown dahin wieder zurück: Das kann im Ernst niemand gut finden.
Auf jeden Fall hätte, wer über heimische wie exotische Verhältnisse so denkt, wieder einmal eine Gelegenheit verpasst, aus einer Krise einen richtigen Schluss auf die Welt vor, nach oder ohne Krise zu ziehen.
Peter Decker ist Redakteur der politischen Vierteljahreszeitschrift GEGENSTANDPUNKT. Dort erscheint dieser Artikel im Rahmen einer Artikelreihe zur Corona-Pandemie. Weitere Kapitel sind auf GegenStandpunkt nachzulesen.
