Was wir vom Rätsel Bewusstsein lernen können
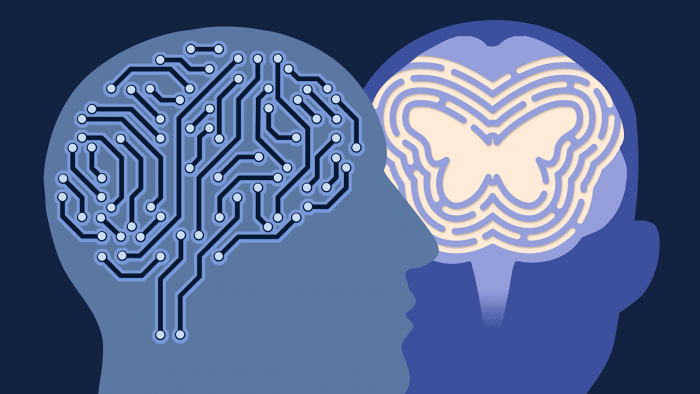
- Was wir vom Rätsel Bewusstsein lernen können
- Das verschwundene Subjekt
- Zusammenfassung und Ausblick
- Auf einer Seite lesen
Serie über Wissenschaft und Religion (Teil 6 und Schluss)
Am Anfang dieser Serie haben wir das erkennende Subjekt in den Mittelpunkt gerückt: Was sind überhaupt die Voraussetzungen unseres Wissens? Auch jede wissenschaftliche Tätigkeit enthält bestimmte Annahmen darüber, wie die Welt erkannt werden kann. Danach haben wir in einem Exkurs gesehen, dass wissenschaftliche Erklärungen von Alltagsphänomenen oft nur vorläufig sind.
Unser Zwischenfazit zum Thema Wissenschaft und Religion war, dass sich diese Sphären nicht zwingend widersprechen. Das passt zum empirischen Beleg, dass auch die überwältigende Mehrheit der Naturwissenschaftler keinen Konflikt zwischen Religion und Wissenschaft sieht. Nicht wenige sehen sogar die Möglichkeit einer Kooperation.
Damit haben wir den Rahmen für den Schlussteil abgesteckt: Die Welt ist nicht so schwarzweiß, wie sie sich viele Naturalisten und Materialisten vorstellen. Wilhelm von Ockham (ca. 1285-1347; übrigens ein Theologe) hat bekanntlich dafür plädiert, metaphysisch sparsam zu sein (Ockhams "Rasiermesser"). Später formulierte man das so, ohne Notwendigkeit keine Entitäten anzunehmen. Umgekehrt sollte man sich die Welt aber auch nicht weniger komplex vorstellen, als sie ist.
Rätselhaftes Bewusstsein
Am Rätsel Bewusstsein werden wir jetzt nachvollziehen, was uns eine vollständige wissenschaftliche Erklärung des Phänomens nutzen würde - und was nicht. Die großen Fragen und Herausforderungen der Menschheit würden wohl bleiben. In der westlichen Wissenschaft hat sich leider ein Spezialistentum verbreitet, das zu oft an den Problemen der Lebenswelt vorbeigeht. Und sind das nicht die wirklich relevanten Probleme?
Die westliche Zivilisation hat zwar Menschen auf den Mond gebracht, kann aber noch nicht einmal eine einzige anerkannte psychische Störung im Gehirn identifizieren (Was heißt es, dass psychische Störungen Gehirnstörungen sind?). Dabei sucht man danach seit über 170 Jahren und hat man seit der "Dekade des Gehirns", den 1990ern, unzählige Milliarden in diesen Bereich investiert.
Das ist eine Anomalie für den biomedizinischen Ansatz zum Verständnis des Menschen - und sollte uns kritisch stimmen. Sind die führenden Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler mit ihrem materialistisch-reduktionistischen Ansatz vielleicht auf der falschen Fährte?
Natürlich gab es große Durchbrüche in der Biomedizin: Denken wir an das Humangenomprojekt im Jahr 2000, neue bildgebende sowie intervenierende Verfahren für die Erforschung des Gehirns und die heutige Bündlung der Kräfte im europäischen Humangehirnprojekt. Erinnern wir uns noch einmal an das, was elf führende Hirnforscher anno 2004 in ihrem berühmten Manifest der Öffentlichkeit versprachen:
Geist und Bewusstsein - wie einzigartig sie von uns auch empfunden werden - fügen sich also in das Naturgeschehen ein und übersteigen es nicht. Und: Geist und Bewusstsein sind nicht vom Himmel gefallen, sondern haben sich in der Evolution der Nervensysteme allmählich herausgebildet. Das ist vielleicht die wichtigste Erkenntnis der modernen Neurowissenschaften.
Das Manifest führender Hirnforscher, 2004
Stand der Bewusstseinsforschung
Erst vor wenigen Jahren diskutierten dann andere Experten auf diesem Gebiet (einschließlich Christof Kochs, Unterzeichner des Manifests von 2004), ob Bewusstsein eher in der vorderen oder hinteren Großhirnrinde lokalisiert werden könne (Spoiler-Alarm: eher hinten; Boly et al., 2017). In einer ähnlichen Überblicksarbeit zogen Koch und Kollegen ein Zwischenfazit zum Stand der Forschung (Koch et al., 2016). Darin erklärten die Fachleute, man habe sich in der experimentellen Forschung lange Zeit über das untersuchte Phänomen geirrt:
Anstatt Bewusstsein, habe man oft Aufmerksamkeit untersucht. Die frontalen Bereiche der Großhirnrinde, auf die viele Menschen so stolz sind, scheinen demnach fürs Bewusstsein gar nicht relevant zu sein, sondern mehr fürs Ausführen von Anweisungen. Das nennen wir in der Psychologie beispielsweise "exekutive Funktionen". Spezifische Vorgänge fürs Bewusstsein verortet man jetzt in einer "hinteren heißen Zone" (engl. "posterior hot zone"), einem unscharf definierten Netzwerk in den Parietal-, Temporal- und Okzipitallappen.
Vielversprechende Kandidaten aus der Neurophysiologie, gewonnen mit der zeitlich sehr viel genaueren und seit den 1930ern entwickelten Elektroenzephalographie (EEG), hätten auch keinen Durchbruch gebracht: Selbst die Gamma-Synchronizität, die von Wolf Singer, einem anderen Autor des Manifests, mitentdeckt wurde, signalisiere eher Aufmerksamkeit. Und das P3b-Signal, das ca. 300ms nach einer Stimuluspräsentation gemessen werden kann, fehle zu oft, wenn Menschen etwas zweifellos bewusst wahrnehmen. Ähnlich verhalte es sich mit dem für Neurologen wichtigen Aktivitäts-EEG.
In meinem Blog hatte ich bereits 2012 erklärt, warum der von der Mehrheit verfolgte reduktionistische Ansatz zu kurz greift. Dummerweise hat die einseitige Ausrichtung der Forschung aber auch einen Preis. Schließlich treten Wissenschaftler ja im Wettbewerb gegeneinander an: einem Wettbewerb um Aufmerksamkeit, Forschungsmittel und Stellen. Der Zuschlag an A bedeutet einen Rückschlag für B. So ist das in der "Winner-takes-it-all"-Welt.
Der Preis des Neuro-Reduktionismus
Auf der (jedenfalls bisher) vergeblichen Suche nach einem "neuronalen Korrelat des Bewusstseins" hat man nämlich in alternative Ansätze - man denke nur an die Phänomenologie - kaum mehr investiert. Diese Alternative sieht Bewusstsein als ein subjektives Phänomen an, das primär von innen heraus verstanden werden muss.
Als sich in der Psychologie vor rund hundert Jahren der alles objektivieren wollende Behaviorismus durchsetzte, kanzelte man die Phänomenologie und mit ihr die Introspektion (wörtlich: Innenschau) als zu ungenau ab. Ich wage zu bezweifeln, dass die heutigen Hirnscans im Bereich der Psychologie so viel genauer sind - und vor allem: uns mehr übers Bewusstsein verraten.
Besonders bitter ist das für Psychiatriepatienten: Denn mit der Suche nach den neuronalen Mechanismen ("Schaltkreisen") für psychische Störungen geht die Hoffnung nach neuen Therapien einher. Von den im Manifest 2004 versprochenen neuen Medikamenten ist aber nach wie vor wenig zu sehen. Vielmehr scheinen mit zunehmender Medikalisierung der Probleme von Menschen deren Probleme eher zuzunehmen. (Und damit bestreite ich nicht, dass pharmakologische Entdeckungen der 1950er/1960er Jahre z.B. zur Behandlung von Psychosen einen Durchbruch darstellten.)
Das Hohelied der Evidenz
Der hier in den Niederlanden bedeutende Psychiater Damiaan Denys hat das Dilemma in seinem neuen Buch ("Het tekort van het teveel", 2020) schmerzlich auf den Punkt gebracht: So, wie man das System nun eingerichtet habe, sorge es für alle Beteiligten vor allem für Nachteile. Und wie oft hat man dabei nicht das Hohelied von der Evidenzbasiertheit gesungen? Also das Hohelied der Wissenschaft?
Laut Denys, der übrigens selbst Pionierarbeit auf dem Gebiet der Tiefenhirnstimulation geleistet hat, müssten die meisten Patienten aufhören, sich als Patienten zu begreifen. Nachdem man ihnen jahrzehntelang eingebläut hat, die Biomedizin würde ihre Probleme lösen, dürfte das allerdings schwer werden.
Um sie jetzt in die Lage zu versetzen, ihre Probleme erst anders zu deuten und sie dann entweder zu lösen oder damit zu leben, gibt es in den Human- und Sozialwissenschaften bewährte und neue Ansätze (bsp. Coping, Empowerment und Sinngebung - und, ja, auch Spiritualität).
