Bestenlisten > Testsieger > Top 10: Der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Kamera, GPS oder Lidar
Top 10: Der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Kamera, GPS oder Lidar
Mähroboter-Teaser
Stefan Schomberg
Stefan schrieb schon während seines Studiums für ein kleines Printmagazin im Ruhrpott Spieletests und kam durch glückliche Fügung nach Berlin. Dort arbeitete er anfangs als Redakteur, später als leitender Testredakteur fast 15 Jahre bei Areamobile. Für Heise Bestenlisten testete er bis 2025 auch Saug- und Mähroboter, Lautsprecher, Modellflugzeuge sowie allerhand andere technische Spielereien.
AnfangWelcher ist der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel?Wie funktioniert ein Rasenroboter ohne Begrenzungskabel?Warum benötigt ein Mähroboter Kameras?Wofür benötigt ein Rasenmähroboter künstliche Intelligenz?Kein Begrenzungskabel, keine Arbeit bei der Installation?Welche Vorteile bieten Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht?Gibt es Nachteile von Mährobotern ohne Begrenzungskabel?Was sind gute Alternativen?Fazit
BESTENLISTEN
1. Ecovacs Goat A1600 RTK2. Mammotion Luba 2 AWD3. Segway Navimow i-Serie4. Stiga A-Serie5. Dreame A16. Segway Navimow H-Serie 7. Roboup T1200 Pro8. Ecovacs Goat G1 20009. Husqvarna Automower 410XE Nera Epos10. Ecovacs Goat GX-600ZUSÄTZLICH GETESTET
Mammotion Luba AWDEcovacs Goat G1 800Einhell Freelexo Cam 500Worx Landroid VisionEcoflow BladeMammotion Yuka 1500 / 2000Ecovacs Goat G1Kabellose Mähroboter erleichtern den Umgang enorm, da kein aufwendiges Verlegen von Draht im Garten nötig ist. Wir haben den Großteil der erhältlichen Modelle getestet und zeigen, welcher der Beste ist.
Die Vorteile von Rasenmährobotern, für die kein Begrenzungskabel verlegt werden muss, haben wir bereits ausführlich im Ratgeber zu Rasenrobotern ohne Begrenzungskabel ausgeführt. Kurz: In der Theorie spart das Zeit und Nerven. Denn wenn bei einem Perimeter-Draht-Mäher das Kupferkabel falsch positioniert wird, muss man es so lange neu verlegen, bis der Mäher alles richtig macht. Bei der Ersteinrichtung kann das wie beim Lidl-Mähroboter Parkside PMRA 20-Li B2 (Testbericht) insgesamt ziemlich lange dauern – von einer Fehlersuche im Falle einer unterbrochenen Mähschleife ganz zu schweigen. Auch wer in seinem Garten häufiger mal Blumentöpfe neu anordnet, wird die Nachteile von Mährobotern mit Begrenzungsdraht schnell kennenlernen. Dann muss das Kabel nämlich neu verlegt werden.
Die neueste Generation von Mährobotern verzichtet daher auf den nervigen Draht und verspricht damit nicht nur weniger Arbeit, sondern insgesamt auch deutlich mehr Komfort. Möglich machen das die App und eine genaue Ortung des Mähers. Damit sieht der Nutzer zu jedem Zeitpunkt, wo sein Roboschaf gerade grast.
Leider stellte sich in unseren Tests schnell heraus, dass bei Weitem nicht alles so läuft, wie es die Hersteller versprechen. Zwar hat keiner der Anbieter unserer Testgeräte mutwillig gelogen, doch Übertreibung und Auslassung von Fakten gehören hier offenbar zum Handwerk. So zeigte sich im Jahr 2023 keines der getesteten Modelle komplett fehlerfrei und bei einigen fehlten einfach noch einige wichtige Funktionen, die nachgereicht werden sollten – sofern man den Herstellern glauben möchte. Im Jahr 2024 sieht es insgesamt aber schon besser aus – und die ersten Modelle aus 2025 bringen weitere Verbesserungen.
Dem Eindruck, dass die Produkte eigentlich zu früh auf den Markt gekommen sind und erst beim Kunden reifen, kann man sich aber auch heute nicht immer ganz entziehen. Hinzu kommen grundsätzliche Probleme mit der RTK-Technik (Real Time Kinematics – präzise Positionsbestimmung durch Satellitennavigation), die je nach Mäher zu mehr oder weniger Komplikationen führen. Problematisch sind hier Flächen, die von hohen Gebäuden umgeben sind. Dann werden die für die Navigation nötigen Satelliten nicht empfangen.
Seit einiger Zeit kommen daher teils weitere Sensoren wie Ultraschall, Lidar (Light Detection and Ranging) und Kameras hinzu, um die Navigation zu verbessern. Vor allem chinesische Anbieter wie Ecovacs oder Dreame, die häufig zuvor Saugroboter (Bestenliste) produziert haben, setzen auf (zusätzliche) Kamera und/oder Lidar. Zwar ist „mehr“ nicht zwangsläufig „besser“, allerdings zeigen die jüngsten Modelle, dass es so bei Mährobotern ohne Begrenzungskabel tatsächlich besser funktioniert – auch und besonders wichtig in Gebieten mit schlechter GPS-Abdeckung.
KURZÜBERSICHT 


Testsieger
Ecovacs Goat A1600 RTK
ab 1499 EUR
Der Mähroboter Goat A1600 RTK von Ecovacs navigiert dank RTK-Technik ohne Kabel. Zudem bietet er eine hohe Mähleistung von bis zu 400 m²/h sowie eine Kamera- und Lidar-gestützte Hinderniserkennung. Wie gut der Goat A1600 RTK in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.
VORTEILE
- Für Rasenfläche bis 1600 m² geeignet, Mähleistung bis 400 m²/h
- Schnellladung mit 45 Minuten
- Genaue Navigation dank RTK und Lidar
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration dank toller App
NACHTEILE
- SAT-Empfang in bebauten Gebieten problematisch
- App-Fehlermeldung teilweise auf Englisch oder Chinesisch
- App nicht für Tablets optimiert
Der Ecovacs A1600 RTK navigiert dank Satellitennavigation zentimetergenau und schneidet den Rasen dank des spaltfreien Doppelklingensystems gleichmäßig und effizient. Die Rasenhalme werden dank der 3000 Umdrehungen pro Minute schnellen Messer sauber abgeschnitten und nicht ausgerissen, was der Gesundheit des Rasens zugutekommt. Und an den Kanten mit Begrenzungssteinen bleibt nur ein Bereich von 5 cm stehen, sodass ein nachträgliches Trimmen schnell erledigt ist. Im ebenen Gelände überfährt er optional den Rand, sodass dort ein zusätzliches Nachschneiden nicht nötig ist.
Wer einen mittelgroßen bis großen Rasen zu mähen hat, erhält mit dem Ecovacs A1600 RTK für knapp 1500 Euro einen der besten Rasenmähroboter ohne Begrenzungsdraht, der auch in komplexen Umgebungen klarkommt.
Bester Bergsteiger
Mammotion Luba 2 AWD
2023 überraschte das Erstlingswerk Luba von Start-up Mammotion durch starke Leistung und gute Navigation. Der Nachfolger hat sich äußerlich kaum geändert – dennoch wird der Luba 2 AWD im Test noch einmal deutlich besser.
VORTEILE
- Vierradantrieb für extreme Steigung und gegen Festfahren
- mäht dank 2 Mähtellern breit und somit schnell
- hohe Geschwindigkeit
- superstabile Navigation dank RTK und Kamera
- tolle App mit vielen Funktionen
- je nach Version für große Rasenflächen
NACHTEILE
- App im Detail noch mit kleineren Unstimmigkeiten
- Beleuchtung von Station und RTK-Antenne nicht abschaltbar
- wegen hohem Gewicht und Drehung auf der Hochachse ggf. Rasenkiller
- Igel-Attrappe nicht erkannt
Der Luba 2 AWD mäht genauso kraftvoll wie der Vorgänger, wühlt sich dank Vierradantrieb genauso überall durch und schafft sogar noch etwas mehr Steigung. Absolutes Highlight ist aber die deutlich stabilere Navigation, die sich durch die Kombination von verbessertem RTK und Kamera nun selbst unter Extrembedingungen nahezu fehlerfrei schlägt.
Mammotion hat inzwischen bereits die Modelle für 2025 vorgestellt, die man an einem "X" in der Produktbezeichnung erkennt. Tests der neuen Reihe folgen in Kürze. Das von uns getestete 2024er-Modell Luba AWD 3000 gibt es jetzt reduziert zum Preis von 2209 Euro. Der Testsieger aus dem letzten Jahr kostet damit fast 400 Euro weniger – ein echtes Schnäppchen.
Preis-Leistungs-Sieger
Segway Navimow i-Serie
ab 989 EUR
Im vergangenen Jahr brachte Segway mit der Navimow-H-Serie richtig gute Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt, jetzt folgt die günstigere i-Serie. Wir haben im Test überprüft, was die kann.
VORTEILE
- sehr stabile Ortung dank zusätzlicher Kamera
- mähen selbst bei schlechtem GPS-Empfang gut weiter
- tolle App mit vielen Features
- gute Objekterkennung dank Kamera
- vergleichsweise niedriger Preis
NACHTEILE
- keine elektronische Verstellung der Mähhöhe
- kein Frontbumper mehr
- wg. Kamera kein „ins Gebüsch schlagen“ mehr
Die neuen Navimow-i-Modelle von Segway sind eine gelungene Weiterentwicklung der älteren H-Serie. Da sie auf Preis-Leistung getrimmt sind, verzichten sie zwar auf ein paar Features wie die elektronische Mähhöhenverstellung, den Blade-Halt-Sensor, 4G oder den Frontbumper, punkten aber mit Neuen.
Da wäre etwa Auto Assist, mit dessen Hilfe die Roboter selbstständig ihre Mähkarten erstellen, außerdem die deutlich stabilere Navigation, mit der die i-Serie auch dort mähen kann, wie die H-Serie im vergangenen Jahr aufgegeben oder zumindest minutenlang ausgesetzt hat.
Welcher ist der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel?
Wir zeigen in Form dieser Bestenliste, welche Mähroboter ohne Begrenzungsdraht wir für die besten aus unseren Tests halten und erklären beim jeweiligen Gerät, wie wir zu dieser Einschätzung kommen. Weitere Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht sowie Zubehör für Rasenroboter gibt es unter anderem bei Amazon.
Nur weil Roboter A bei uns auf dem ersten und Roboter B auf dem letzten Platz steht, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Reihenfolge auf jeden Anwendungsfall zutrifft. Wer etwa möglichst wenig Geld ausgeben möchte, greift vielleicht lieber zur Nummer 10, wer keine Kamera haben will, zu einem reinen RTK-Modell. Wir versuchen, in unserer Liste möglichst allumfassend einzuordnen. Daher werden normalerweise die Mäher mit dem größten Funktionsumfang, die noch dazu möglichst einwandfrei funktionieren, vor sehr günstige Geräte ohne besondere Qualitäten platziert. Grundsätzlich gilt zudem: Gerade mit Blick auf den Preis handelt es sich bei jeder Aktualisierung dieser Bestenliste um Momentaufnahmen.
BESTENLISTEN 




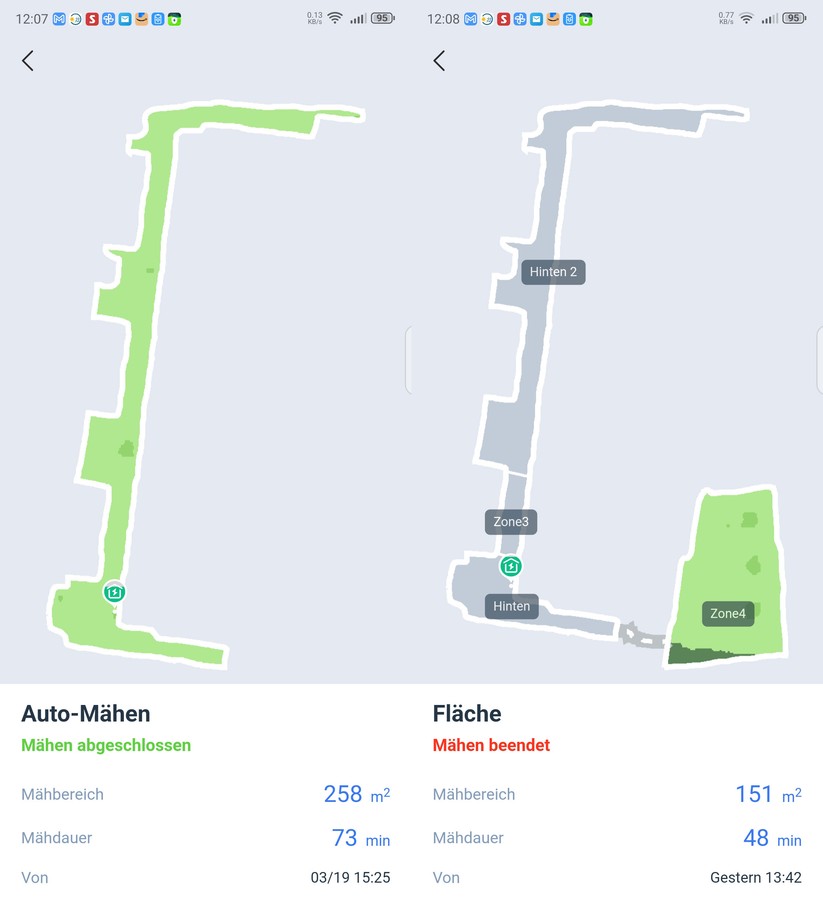



















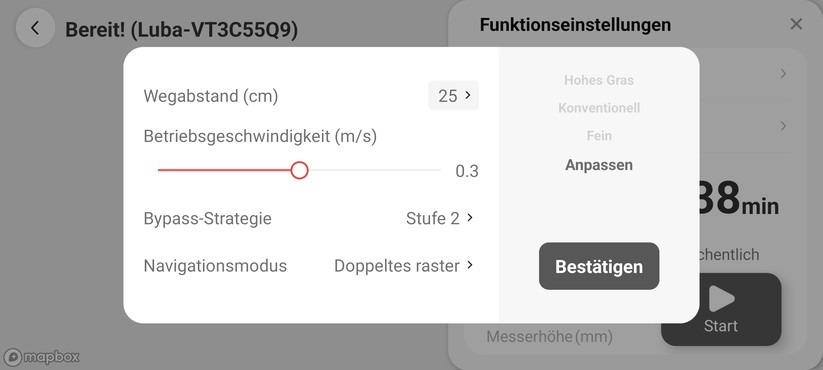









Testsieger
Ecovacs Goat A1600 RTK
ab 1499 EUR
Der Mähroboter Goat A1600 RTK von Ecovacs navigiert dank RTK-Technik ohne Kabel. Zudem bietet er eine hohe Mähleistung von bis zu 400 m²/h sowie eine Kamera- und Lidar-gestützte Hinderniserkennung. Wie gut der Goat A1600 RTK in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.
VORTEILE
- Für Rasenfläche bis 1600 m² geeignet, Mähleistung bis 400 m²/h
- Schnellladung mit 45 Minuten
- Genaue Navigation dank RTK und Lidar
- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration dank toller App
NACHTEILE
- SAT-Empfang in bebauten Gebieten problematisch
- App-Fehlermeldung teilweise auf Englisch oder Chinesisch
- App nicht für Tablets optimiert
Ecovacs Goat A1600 RTK im Test
Der Mähroboter Goat A1600 RTK von Ecovacs navigiert dank RTK-Technik ohne Kabel. Zudem bietet er eine hohe Mähleistung von bis zu 400 m²/h sowie eine Kamera- und Lidar-gestützte Hinderniserkennung. Wie gut der Goat A1600 RTK in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.
Der neue Ecovacs Goat A1600 RTK benötigt für die Navigation kein Kabel. Das macht Mähroboter ohne Begrenzungsdraht (Bestenliste) so beliebt, aber auch teuer. Für die Navigation mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern nutzt das Modell eine RTK-Antenne (Real Time Kinematics) sowie Lidar-Sensoren. Ergänzt wird das System durch eine KI-Kamera mit 3D-ToF-Sensoren, mit der der Ecovacs-Rasenroboter Hindernisse erkennt. Mit den zwei 3000 Umdrehungen/m schnellen Messerscheiben bietet er eine Schnittbreite von 33 cm, und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,7 m/s soll der Goat A1600 RTK eine Rasenfläche von bis zu 400 m² pro Stunde mähen. Dafür können Anwender die Schnitthöhe von 3 cm bis 9 cm bequem per App einstellen. Der 97,2 Wh starke Akku (32,4 Volt x 3 Ah) des A1600 RTK soll für eine Betriebszeit von 165 Minuten sorgen. Und wenn er leer ist, müssen Anwender dank Schnellladung nur 45 Minuten warten, bis er wieder aufgeladen ist. Wie gut der für eine Rasenfläche von bis zu 1600 m² vorgesehene und knapp 1500 Euro teure Ecovacs Goat A1600 RTK die gebotenen Leistungsmerkmale in der Praxis umsetzen kann, zeigt der Test.
Bilder Ecovacs Goat A1600 RTK
Ecovacs Goat A1600 RTK: Dank des sich überlappenden Doppelklingensystems bietet der Mähroboter eine Schnittbreite von 33 cm und mäht bis auf 5 cm zur Kante, wenn diese durch Steinplatten begrenzt ist. Ist der Rand nicht begrenzt, mäht der Roboter den Rasen vollständig. Hierfür muss man die Option „Grenzübergreifendes Mähen“ in der App aktivieren.
TechStage.de
Wie ist die Verarbeitung des Ecovacs Goat A1600 RTK?
Das Design des A1600 RTK erinnert an den Vorgänger Ecovacs Goat G1. Nur dass die Antenne für die Navigationsbaken fehlt, da der A1600 RTK auf Satellitennavigation und Lidar setzt. Wie beim Goat G1 verwendet der Hersteller für den A1600 RTK ein geschlossenes Chassis, bei dem die Hauptantriebsräder, nicht aber die beiden vorderen Stützräder, zu sehen sind und nichts hervorsteht. Die Lackierung in Schwarz und Weiß verstärkt die Formgebung und sorgt für einen modernen Look. Von hinten schaut der A1600 RTK aus wie ein Sportwagen, bei dem der Kofferraum als Spoiler fungiert. Nach der schwarz lackierten unteren Abdeckung folgt die mittlere Gehäuseabdeckung in Weiß, während oben ein kantiger Aufsatz die typische Technik wie Kameras beinhaltet, die die Navigation per GPS unterstützt. Im Vergleich zum G1 sind die Radläufe nun in Schwarz und die Felgen in Schwarz-Weiß lackiert. Das futuristische, technische Äußere beim G1 hat Ecovacs beim A1600 RTK insgesamt nochmals verbessert. Der Kunststoff des Mähers macht einen ordentlichen Eindruck, das gilt für die Ladestation und auch für den Mäher selbst. Insgesamt sieht der Ecovacs also nicht nur gut aus, sondern ist auch hervorragend verarbeitet.
Wie einfach ist die Einrichtung des Ecovacs Goat A1600 RTK?
Bei der App handelt es sich um dieselbe, die der Hersteller auch für Sauger wie den Ecovacs X1e Omni (Testbericht) verwendet. Unterschiede wie komplett andere Menüpunkte durch den unterschiedlichen Einsatzbereich als bei einem Saugroboter werden erst nach dem Einbinden sichtbar. Die App führt den Anwender Schritt für Schritt in Text und Bild durch den Installations- und Verbindungsprozess mit dem Smartphone, Ecovacs bietet hier das Beste, was wir derzeit von GPS-Mähern kennen. Hier wird die langjährige Erfahrung mit Saugrobotern offensichtlich.
Nach der Wahl der Sicherheits-PIN über die Folientasten oben auf dem Roboter erfolgen die weiteren Schritte in der für iOS und Android erhältlichen App auf dem Smartphone. Mittels Telefon und App lässt sich ganz einfach der QR-Code des Bots abscannen, der sich etwas versteckt unterhalb der hinteren Abdeckung befindet. Wichtig für die Verbindung mit der App ist laut Hersteller aktiviertes Bluetooth und die Nutzung eines auf 2,4 GHz beschränkten WLANs. Im Test funktionierte das aber auch mit einem Netzwerk, das unter einer SSID ein 2,4- und ein 5-GHz-Netz bereitstellt. Die Beschränkung auf 2,4 GHz wird oft kritisiert, allerdings bietet die ältere Funktechnik eine größere Reichweite und ist somit sinnvoll für den Einsatz bei Rasenmährobotern.
Der Ecovacs Goat A1600 RTK mäht die Ränder sehr genau. Bauartbedingt bleiben jedoch 5 cm vom Rand stehen, wenn dieser durch Rasenkantsteine begrenzt ist. TechStage.de
RTK-Empfang zwischen hohen Gebäuden problematisch
Die Einrichtung des Mähers und die Koppelung mit dem heimischen WLAN verläuft problemlos. Allerdings findet die RTK-Antenne, die auf den mitgelieferten etwa 1,2 Meter langen Empfangsmast montiert, per Erdspieß im Boden verankert und per Kabel mit der Ladestation des Mähers verbunden wird, die für den Betrieb nötigen 20 Satelliten aber nicht.
Unser Test-Grundstück ist eingebettet zwischen einem dreistöckigen Gebäude und einem zweistöckigen Eigenheim. Zudem wird die Rasenfläche von einem Hang mit mehreren großen Bäumen begrenzt. Auch andere Aufstellorte unter Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Kabellänge der RTK-Antenne von 10 Metern brachten keine Besserung. Dementsprechend leuchtet die Signal-LED an der RTK-Referenzstation auch nicht dauerhaft, sondern blinkt, weil die Antenne nur 19 Satelliten empfängt.
Leuchtet die LED dauerhaft, hat die RTK-Antenne genügend Satelliten gefunden. Ist das nicht der Fall, blinkt die LED. Ist letzteres der Fall, muss man einen anderen Standort suchen. TechStage.de
An einem anderen Standort, der ebenfalls von einem dreistöckigen Gebäude begrenzt ist, nach Süden allerdings freie Sicht auf Umgebung und Himmel bietet, hat die RTK-Antenne sofort die für den Betrieb nötigen Satelliten gefunden – insgesamt sogar 28. Und auch bei Regen ist der Satellitenempfang mit 22 über der erforderlichen Anzahl von 20.
Der Aufstellort von Ladestation und Satelliten-Antenne wird durch die Kabellänge von etwa 7 Meter des nach IPX6 wassergeschützten Netzteils sowie der RTK-Antenne mit ihrem 10 Meter langen Kabel limitiert. Ist eine Platzierung für einen besseren Empfang innerhalb der Rasenfläche nötig, muss man sicherstellen, dass man mit den beiliegenden Pfropfen das Kabel so im Erdboden befestigt, dass es vom Mäher nicht beschädigt wird. Sollte der Empfang aber an der Rasengrenze möglich sein, ist dieser Aufstellort für die RTK-Antenne zu bevorzugen, da er kein unnötiges Hindernis, etwa für auf dem Rasen spielende Kinder darstellt. Daher dürfte die Antenne in den meisten Fällen parallel von der Ladestation, am Rand der Mähzone, platziert werden. In unserem Fall haben wir sie direkt neben der Ladestation positioniert. Mehr Informationen zur Positionierung und Inbetriebnahme bietet Ecovacs in seinem Support-Bereich.
Ecovacs A1600 RTK: Wie funktioniert die Kartenerstellung?
Neben der manuellen Kartenerstellung gibt es auch einen Automatikmodus. Doch diesen sollte man nur nutzen, wenn die Rasenfläche homogen und wenig komplex ist. In den meisten Fällen dürften Anwender aus Präzisionsgründen daher manuell die Karte erstellen. Hierfür läuft man in Bluetooth-Entfernung von wenigen Metern hinter dem Ecovacs A1600 RTK und steuert ihn manuell entlang der Rasengrenze. Die Ecovacs-App assistiert dabei, sodass die Kartenerstellung relativ einfach vonstattengeht. Es schadet aber nicht, wenn man zuvor die manuelle Steuerung ein paar Minuten trainiert, sodass man den Roboter während der Kartenerstellung fehlerfrei steuert und die Karte dadurch möglichst exakt wird.
Gibt es im Garten mehrere Mähzonen, erleichtert die Ecovacs-App beim Anlegen von Zugängen, die der A1600 RTK abfährt, um eine andere Zone zu erreichen. Sollte das nicht möglich sein, muss man ihn in die neue Zone tragen.
Im Test hat der Goat A1600 RTK die enge Verbindung unserer zwei Rasenzonen aber erst fehlerfrei absolviert, nachdem wir den Zugang ein zweites Mal kartiert haben. Beim ersten Mal führte der erstellte Verbindungsweg nah an einem Absatz von etwa 10 cm vorbei, sodass der Ecovacs schon beim Anfahren auf die steile Engstelle hängen blieb. Laut Handbuch soll der Zugang mindestens ein Meter breit sein, damit der Roboter diesen problemlos passieren kann.
Erst nach einer erneuten Kartierung meistert der Ecovacs Goat A1600 RTK die enge Verbindung zwischen unseren Mähzonen. TechStage.de
Wie gut mäht der Ecovacs Goat A1600 RTK und welche Einstellungsmöglichkeiten bietet er für das Mähen?
Grundsätzlich sorgt das Doppelklingensystems für einen gleichmäßigen Rasenschnitt. Praktisch ist auch, dass die App die Konfiguration von Mähgeschwindigkeit (0,4 m/s oder 0,7 m/s), Mähhöhe (3 cm bis 9 cm) und Hindernisvermeidungshöhe (>10 cm, 15 cm oder 20 cm) pro Zone erlaubt. Im Automatikmodus stehen diese Optionen allerdings nur für die gesamte Rasenfläche aller Mähzonen zur Verfügung. In schwierigen Situationen kann die Anpassung des Kantenmodus nötig sein. Mit der Option „Kantenmähen“ mäht der Mähroboter entlang der Grenze der erstellten Karte und passt seinen Randabstand automatisch anhand der von seinen Sensoren erkannten Rasengrenze an. Beim „Grenzübergreifenden Mähen“ fährt er bis zu 20 cm über die erstellte Kartengrenze hinaus, aber nur, wenn beim Mähen eine klare, nicht grasbewachsene Grenze erkannt wird und der nicht grasbewachsene Bereich auf gleicher Ebene wie der Rasen liegt. Beim „Mähen entlang der Kartengrenze“ folgt der Rasenroboter strikt den erstellten Kartengrenzen.
Praktisch ist auch, dass der Roboter mithilfe eines Regensensors Niederschlag erkennt und zurück zur Ladestation fährt und standardmäßig drei Stunden (maximal erlaubt die App fünf Stunden) nach Ende des Regens seine Arbeit fortsetzt. Allerdings könnte der Boden je nach Niederschlagsintensität zu feucht sein, sodass sich der A1600 RTK beim Manövrieren an steilen Stellen die Rasenfläche beschädigen kann und die Räder viel Erde aufsammeln.
Last but not least kann man zum Schutz für nachtaktive Tiere über die Option „Tierschutz“ eine Zeit definieren, in der der Ecovacs nicht aktiv wird.
Im Test hat der A100 RTK auch steile Flächen mit Bravour gemeistert. Laut Ecovacs schafft er Anstiege von bis zu 50 Prozent (27°). Hier sollte man allerdings auf die Mährichtung achten. Mäht der Roboter quer zur Hangneigung, aktiviert sich an ganz steilen Stellen der Kippsensor des Geräts. Dann ist ein manuelles Eingreifen nötig. Bei steilen Rasenzonen sollte man den Mäher als nicht quer, sondern hoch/runter mähen lassen. Dann gelingt ihm die Arbeit problemlos. Leider lässt sich die Mährichtung nicht je nach Zone, sondern lediglich für die gesamte Rasenfläche festlegen.
Ecovacs Goat A1600 RTK: Ist der Boden zu nass, sammeln die Räder beim Manövrieren an steilen Stellen viel Erde auf. Zudem beschädigt der Rasenroboter dadurch den Rasen. Das Problem betrifft allerdings alle Rasenroboter. TechStage.de
Wie schnell mäht der Ecovacs A1600 RTK?
Laut Ecovacs bietet der A1600 RTK eine maximale Mähgeschwindigkeit von 400 m²/h. Im Test hat er eine größtenteils ebene Fläche von 258 m² in 73 Minuten geschafft. Etwas Zeit haben die engeren Teilstücke gekostet, die der Roboter quer abgemäht hat, obwohl ein Mähen in Längsrichtung sinnvoller gewesen wäre. Außerdem haben herumlaufende Hunde und spielende Kinder dafür gesorgt, dass sich der A1600 RTK häufig umorientieren musste.
Die steilere Rasenzone (siehe Bildergalerie: Zone 4) mit 151 m² hat er in 48 Minuten geschafft. Da wir den Test des A1600 RTK an einem neuen Standort durchführen, liegen uns noch keine Vergleichsdaten von anderen Geräten vor.
Laut Ecovacs bietet der A1600 RTK eine maximale Mähgeschwindigkeit von 400 m²/h. Im Test hat er eine größtenteils ebene Fläche von 258 m² in 73 Minuten geschafft. Für die steile Zone mit 151 m² hat er 49 Minuten benötigt. TechStage.de
Wie gut ist die Objekterkennung des Ecovacs A1600 RTK?
Im Test hat die Objekterkennung des Ecovacs A1600 RTK einwandfrei funktioniert. Interessanterweise hat er sogar eine Pflanze mit einer Höhe von etwa 10 cm mitten auf der Rasenfläche umfahren, während er etwa gleich hochgewachsene Unkrauthalme gemäht hat. Auch andere Gegenstände wie einen herumliegenden Gartenschlauch hat der Roboter erkannt. Auf herumlaufende Hunde hat er ebenfalls vorausschauend reagiert und seine Richtung geändert.
Wie schnell lädt der Ecovacs Goat A1600 RTK seinen Akku?
Ein echtes Highlight ist die Schnellladefunktion. Nach nur 45 Minuten ist der Akku des Goat A1600 RTK wieder geladen, sodass der Mähroboter seine Arbeit fortsetzen kann, sollte er sie mit einer Akkuladung nicht schaffen. Im Test wies der Akku nach dem Mähen einer größtenteils ebenen Fläche mit 258 m² noch eine Restkapazität von 17 Prozent auf.
Ist der Ecovacs Goat A1600 wasserfest?
Der Ecovacs Goat A1600 RTK ist wasserfest nach IPX6. Einen Schutz vor dem Eindringen von Wasser bietet auch die Ladestation und das Netzteil (IP67).
Preis: Was kostet der Ecovacs A1600 RTK?
Der Ecovacs A1600 RTK kostet regulär knapp 1500 Euro. Optional ist für 150 Euro ein Mobilfunkmodul erhältlich, das per SIM-Karte, die extra erworben werden muss, eine vom heimischen WLAN unabhängige Kommunikation mit der A1600 RTK bereitstellt.
Sollte der RTK-Empfang aufgrund hoher Gebäude problematisch sein, empfehlen sich Mähroboter, die wie der knapp 800 Euro teure Ecovacs Goat O500 Panorama, der für kleine Gärten gedacht ist und über eine integrierte Kamera kartiert oder das Spitzenmodell für Mähflächen von bis zu 3000 m² mit Doppel-Laser Goat A3000 Lidar für knapp 3000 Euro. Die Tests der beiden folgen zeitnah.
Fazit
Der Ecovacs A1600 RTK navigiert dank Satellitennavigation zentimetergenau und schneidet den Rasen dank des spaltfreien Doppelklingensystems gleichmäßig und effizient. Die Rasenhalme werden dank der 3000 Umdrehungen pro Minute schnellen Messer sauber abgeschnitten und nicht ausgerissen, was der Gesundheit des Rasens zugutekommt. Und an den Kanten mit Begrenzungssteinen bleibt nur ein Bereich von 5 cm stehen, sodass ein nachträgliches Trimmen schnell erledigt ist. Im ebenen Gelände überfährt er optional den Rand, sodass dort ein zusätzliches Nachschneiden nicht nötig ist.
Die App gehört zum Besten, was aktuelle GPS-Mäher derzeit bieten. Auch wenn die ein oder andere Übersetzung fehlerhaft ist und ihr auch eine Optimierung für Tablets gut zu Gesicht stehen würde. Mit ihr können Anwender eine Anpassung der verschiedenen Rasenzonen in puncto Mähgeschwindigkeit, Mähhöhe und Hindernisvermeidungshöhe vornehmen. Und dank Schnellladetechnik ist der Mäher nach nur 45 Minuten wieder einsatzbereit.
Als einziges nennenswertes Problem haben wir im Test den Empfang der RTK-Antenne ausgemacht, die an unserem Teststandort, der von zwei hohen Gebäuden und Bäumen umgeben ist, nicht genügend Satelliten empfangen hat. Am anderen Standort war der Empfang problemlos.
Wer einen mittelgroßen bis großen Rasen zu mähen hat, erhält mit dem Ecovacs A1600 RTK für knapp 1500 Euro einen der besten Rasenmähroboter ohne Begrenzungsdraht, der auch in komplexen Umgebungen klarkommt.
Bester Bergsteiger
Mammotion Luba 2 AWD
2023 überraschte das Erstlingswerk Luba von Start-up Mammotion durch starke Leistung und gute Navigation. Der Nachfolger hat sich äußerlich kaum geändert – dennoch wird der Luba 2 AWD im Test noch einmal deutlich besser.
VORTEILE
- Vierradantrieb für extreme Steigung und gegen Festfahren
- mäht dank 2 Mähtellern breit und somit schnell
- hohe Geschwindigkeit
- superstabile Navigation dank RTK und Kamera
- tolle App mit vielen Funktionen
- je nach Version für große Rasenflächen
NACHTEILE
- App im Detail noch mit kleineren Unstimmigkeiten
- Beleuchtung von Station und RTK-Antenne nicht abschaltbar
- wegen hohem Gewicht und Drehung auf der Hochachse ggf. Rasenkiller
- Igel-Attrappe nicht erkannt
Mähroboter Mammotion Luba 2 AWD im Test
2023 überraschte das Erstlingswerk Luba von Start-up Mammotion durch starke Leistung und gute Navigation. Der Nachfolger hat sich äußerlich kaum geändert – dennoch wird der Luba 2 AWD im Test noch einmal deutlich besser.
Mähroboter ohne Begrenzungsdraht zeigten sich im Jahr 2023, in dem die Technik im größeren Stil auch für Privatanwender verfüg- und halbwegs bezahlbar wurde, als durchaus brauchbar, allerdings nicht frei von Fehlern. Der Mammotion Luba AWD (Testbericht) schlug sich hier überraschen gut. Überraschend deshalb, weil Mammotion ein junges Start-up ist, das zumindest hierzulande zuvor nicht in Erscheinung getreten war. Dennoch überzeugte uns der Luba der ersten Generation durch starken Vierradantrieb, viel Kraft bei Vorwärtsdrang und Mähleistung sowie eine App, die vielleicht nicht makellos, aber dennoch in Bezug auf die Features weitgehend vollumfänglich war. Das Gesamtpaket war so gut, dass es das Jahr auf dem ersten Platz unserer Bestenliste zu Mährobotern ohne Begrenzungsdraht abschloss.
Der Nachfolger sieht da auf den ersten Blick beinahe enttäuschend aus, schließlich hat sich bis auf eine Kamera vorn oben auf dem gleichen Chassis wie im vergangenen Jahr scheinbar nichts verändert. Aber genau diese eine Änderung macht aus dem neuen Mammotion Luba 2 einen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht, der mit dem Vorgänger bis auf die Optik kaum noch etwas gemein zu haben scheint. Und es gibt im Detail doch noch mehr.
Was sind die Highlights des Luba 2 AWD?
- Design im Rennwagen-Look
- Vierradantrieb
- GPS, Ultraschall und Kamera
- Umfangreiche App
Wie sieht der Mammotion Luba 2 AWD aus?
Wie angedeutet unterscheidet sich der neue Mammotion Luba 2 vom ersten Luba (Testbericht) vornehmlich durch ein Kameramodul vorn oben auf dem Chassis des Mähroboters. Je nach Fantasie befeuert das den Rennwagen-Look noch mehr, sofern man dieses Modul als Helm bei einem klassischen Formel-Fahrzeug interpretiert. Der Rest scheint wie gehabt. Auch der Luba 2 ist komplett in Weiß gehalten und setzt auf schwarze Akzente und einen roten Notstopp-Knopf oben auf dem Gerät. Erneut verwendet der Hersteller vorn einen Bumper in Stoßstangen-Optik und breite Hinterräder aus Gummi mit eher dezentem, neuem Profil. Vorn installiert er wieder die omnidirektionalen Räder, die bei Seitwärtsbewegung den Rasen weniger in Mitleidenschaft ziehen sollen. Denn nach wie vor ist die Vorderachse zwar gefedert, aber nicht gelenkt. Für Drehungen agiert der Roboter also ähnlich wie ein Panzer und setzt wahlweise auf gegenläufig drehende Räder pro Seite oder wendet um die Hinterachse. Auch das Gewicht passt nach wie vor zu einem Panzer: Mit rund 18 kg gehört der Luba 2 wieder zu den schwersten Rasenrobotern in ihrer Klasse.
Im Detail haben sich schon noch einige Kleinigkeiten geändert. So gibt es jetzt nur noch einen Ultraschallsensor nach vorn, die beiden nach schräg vorn sind hingegen gleich. Dann ist noch das Profil der Hinterräder leicht unterschiedlich zum Vorgänger und die seitlichen Kontaktpölsterchen (als Kontaktsensoren haben sie beim Luba 1 nie funktioniert) sind verschwunden – geschenkt. An ihre Stelle sind nun zwei Griffmulden getreten, mit deren Hilfe man den Luba 2 trotz seines hohen Gewichts besser als den Vorgänger tragen kann. Wichtiger ist das, was (hoffentlich) intern geschehen ist. Denn nachdem es beim Vorjahresmodell in Foren Hinweise auf mangelnde Abdichtung einzelner Komponenten gab, soll das am Luba 2 verbessert worden sein. So werden etwa die Bedienknöpfe oben auf dem Mäher nun von einer durchgehenden Folie bedeckt und die Radaufnahmen sind offenbar besser gegen Eindringen von Wasser geschützt. Auch die RTK-Antenne sieht nun anders aus, denn die alte Version wurde bei einigen Besitzern des Vorgängermodells zur Vogeltränke. Die neue Antenne reicht jetzt nach Herstellerangabe bis zu 5 km weit.
Wir hatten mit der ersten Luba-Generation übrigens keine Probleme, sie fuhr bis zum Spätherbst problemlos. Lediglich eine Abdeckung der seitlichen Leuchten verabschiedete sich durch zu harten Vegetationskontakt, ebenfalls eine der beiden vorderen Zierringe um die Vorderräder. Vereinzelt löste sich am Luba 1 außerdem der Frontbumper. Anstecken des Bumpers reichte jedes Mal, Zierring und LED-Abdeckung gibt es als Ersatzteile. Beim Luba 2 wird der Frontbumper bei der Installation nun mit zwei Schrauben fixiert – ausgezeichnet!
Apropos RTK-Antenne: Wer den Luba 2 kauft, sollte vor Inbetriebnahme einen Blick auf die aufgeprägten Frequenzbänder werfen. In Foren berichten vereinzelt Besitzer, dass Mammotion fälschlicherweise in Österreich und Deutschland Antennen ausgeliefert hätte, die im 915-MHz-Band funken. Diese Frequenz ist hierzulande dem Militär vorbehalten und dessen unautorisierte Nutzung kann offenbar einen teuren Besuch von Fernmeldetechnikern des Bundes nach sich ziehen. Die richtige und erlaubte Frequenz der Antenne liegt bei 868 MHz.
Alle Bilder zum Mammotion Luba 2 im Test
Wie gut ist die App des Mammotion Luba 2 AWD?
Wie im Vorjahr dient zur Kommunikation mit dem Luba 2 die Mammotion-App. Ohne die ist kein Anlernen von Mährzonen möglich, wenngleich theoretisch nach diesem Schritt eine rudimentäre Steuerung (Start und Rückkehr zur Ladestation) über die Bedientasten oben auf dem Mäher möglich wäre. Alternativ gilt das auch für Sprache, der Luba 2 lässt sich jetzt mit Amazon Alexa und Google Assistant verbal steuern. Die Anbindung mit App, WLAN und Bluetooth klappt wie im Vorjahr einfach und schnell, indem man den guten Anweisungen auf dem Smartphone folgt. Sollte es doch einmal Probleme geben, helfen entweder ein Kundenberater per Chat (direkt in der App) oder der Supportbereich des Herstellers weiter.
Anschließend landet man in der App, die im Wesentlichen wie im Vorjahr aussieht, aber doch Unterschiede aufweist. Das betrifft in erster Linie die Anordnung der einzelnen Elemente, die Funktionsvielfalt ist hingegen gleichgeblieben. Nutzer dürfen erneut nicht nur Mähzonen anlegen (10 bei AWD 1000, 20 bei AWD 3000 und 30 bei AWD 5000), sondern sie auch anschließend noch einmal bearbeiten. Besonders hilfreich ist dabei die Radiergummi-Funktion: Hat sich der Nutzer beim Anlernen der Grenzen verfahren, sorgt Gedrückthalten des virtuellen Radiergummis dafür, dass der Luba 2 rückwärts auf der Grenze zurückfährt und die Grenze vor sich löscht. Möchte man weiterfahren, lässt man den Radiergummi los und lern die Grenze weiter an. Modelle wie der aktuelle Ecovacs Goat G1 800 (Testbericht) oder der ansonsten sehr gute Dreame A1 (Testbericht) mit Lidar können das bis jetzt nicht.
Neue Funktionen gibt es außerdem. So dürfen Nutzer jetzt manuell mähen, also den Roboter steuern, während seine Schneidwerke arbeiten. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, live durch die 3D-Kamera des Luba 2 zu schauen – allerdings nur per Bluetooth-Verbindung. Die Qualität ist dabei besser als bei dem zuvor genannten Ecovacs-Modell und liegt in etwa auf dem Niveau einer mäßigen HD-Überwachungskamera. Eine Überwachungsfunktion wie beim ursprünglichen Ecovacs Goat G1 (Testbericht) gibt es hingegen (noch) nicht.
Das gilt auch für die versprochene Möglichkeit, Muster wie einfache Bilder oder Schrift in den Rasen zu mähen. Eigentlich hätte diese Funktion schon Ende April verfügbar sein sollen, allerdings hatten wir zum Testzeitpunkt noch kein entsprechendes Update.
Update: Das angesprochene Update ist da und erlaubt es, eine Handvoll vorgefertigter Symbole oder die Buchstaben des Alphabets in den Rasen zu mähen. Dabei ist zu bedenken, dass jedes Zeichen mindestens 5 x 5 Meter groß ist!
Neu sind zudem die Abstufungen der Hinderniserkennung und -vermeidung. Sie reicht nun in vier Stufen von „Direkte Berührung“, also Ausweichen erst nach Kontakt per Frontbumper, bis „Keine Berührung“, bei der der Roboter mittels Ultraschall- und Kamera jegliche Berührung zu vermeiden sucht. Auch nur Randmähen mit bis zu vier Umrundungen der Zonen und drei Umrundungen von Nogo-Zonen ist jetzt möglich. Dabei hat es Mammotion endlich geschafft, dass auch bei Nogo-Zonen eine einzelne Randschnittrunde tatsächlich die Grenze mäht – und nicht rund einen Dreiviertelmeter davon entfernt.
An den Veränderungen in der App sieht man übrigens schön die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lubas. Allein im Testzeitraum kamen zwei Updates mit Fehlerkorrekturen. Ebenfalls neu: Nutzer dürfen jetzt zwischen der bekannten schematischen Mähkarte und einer Kombination aus Satellitenansicht und darüber gelegter Mähkarte wählen.
Wie gut mäht der Mammotion Luba 2 AWD im Alltag?
Die Vorzüge des Mammotion-Modells haben wir bereits beim ersten Luba (Testbericht) ausführlich beleuchtet. Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. So sind die beiden Schneidteller des weitgehend baugleichen Luba 2 nach wie vor enorm kräftig und sorgen zusammen nicht nur für eine große Schnittbreite von 40 cm, sondern auch dafür, dass der Luba 2 sogar hohes Gras mähen kann. Dafür ist er natürlich nicht gedacht und entsprechend braucht der Roboter dann mehrere Durchgänge, um wieder ein ordentliches Schnittbild herzustellen. Aber es klappt. Die Schnitthöhe darf dabei jetzt zwischen 25 und 70 mm variiert werden und reicht nun also 5 mm tiefer. Ein weiterer Vorzug ist der Vierradantrieb, der den Mäher trotz des hohen Gewichts zu enormer Steigfähigkeit von 80 Prozent (38 Grad) verhilft und auch dafür sorgt, dass sich der Mammotion-Mäher praktisch nie festfährt. Der Vorgänger schaffte „nur“ 65 Prozent (33 Grad) bei den Modellen 1000 und 3000, das 500er schaffte 75 Prozent (37 Grad). Der kräftige Antrieb sorgt im Gegenzug aber auch für einen Nachteil und der ist beim Luba 2 verstärkt worden: Der Luba 2 wird schneller zum Rasenkiller.
Denn zwar dürfen Nutzer in der App bestimmen, ob der Roboter nach jeder Bahn wie ein Panzer auf der Hochachse wendet oder wie ein Auto mit einer Mehrpunktwendung dreht. Das hält den neuen Luba 2 aber nicht davon ab, vor jedem Start eines Mähvorgangs kurz vor der Ladestation einige Drehbewegungen zu machen, um sich per Kamera zu orientieren. Dabei dreht sich der Bot allerdings im Gegensatz zum späteren Mähverlauf immer auf der Hochachse – und das ist zumindest bei aufgeweichtem Boden durch häufige Regenfälle im Zusammenspiel mit dem hohen Gewicht des Mähers Folter für den Rasen. Bei leichten Modellen wie dem Stiga A1500 (Testbericht) ist das komplett anders und der Grund, warum der Luba 2 auf unserem norddeutschen Testrasen erst jetzt seine Tests abschließen konnte.
Dank Allradantrieb mit kräftigem Antrieb und Stollen wühlt sich der Mammotion Luba 2 AWD überall durch – das ist nicht immer gut | TechStage.de
Aber auch bei trockenem Rasen zeigt sich der Luba 2 wie schon der Vorgänger wenig feinfühlig. Er sieht zwar aus wie ein schnittiger Sportwagen, ist aber eher HUMVEE als Renner. Denn er fährt sich zwar wie bereits geschrieben selten fest, allerdings wühlt er sich unter Umständen eher durch, als einfach nur zu fahren. Andere Mäher mit Zweiradantrieb geben da allerdings schon lange auf. Und wie ein HUMVEE ein Militär-Jeep fürs Grobe ist, sind auch die Lubas nichts für kleine „Schöner-Wohnen-Gärten“ mit filigranen Grasflächen. Er fühlt er sich auf weiter Wiese wohler als auf verwinkeltem Wimbledon-Rasen. Dabei liegt das nicht an der Genauigkeit, die er bei der Navigation an den Tag legt und auch nicht daran, dass er aufgrund seines Gewichts und den vergleichsweise ausladenden Maßen zu unbeweglich wäre. Durch die Wendemöglichkeit auf der Stelle ist er sogar außergewöhnlich manövrierfähig und seine starken Motoren beschleunigen ihn auf Geschwindigkeiten, von denen die meisten anderen Rasenroboter nur träumen können.
Dank 3D-Vision-Kamera behält der Luba 2 immer den Überblick – auch bei schlechtem GPS | TechStage.de
Die sichtbarste und größte Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger betrifft die Kamera. Sie verleiht dem Luba 2 nicht nur ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Luba 1, sondern sorgt auch für wesentlich bessere Navigation. Denn während der Vorgänger auf freier Fläche und auch bei etwas schwierigerer Umgebung verlässlich seine Bahnen zog, darüber hinaus aber zumindest ins Stocken kam, setzt das neue Mähroboter-Modell neben RTK mit GPS zusätzlich auch auf KI-gesteuerte Wegfindung mittels dreidimensionaler Sicht. Mammotion verspricht dabei vollmundig: „Durch die komplementäre Kombination von 3D Vision und RTK ist ein unterbrechungsfreier Arbeitsablauf unabhängig von Signalschwankungen gewährleistet. Der stabile Betrieb bleibt auch in unzugänglichen Bereichen wie unter Baumkronen oder Dächern erhalten.“
Und was davon ist Wirklichkeit, was Marketing? Zur Abwechslung sind wir begeistert: Das, was das Marketing für die Homepage des Herstellers ersonnen hat, stimmt – und zwar zu 100 Prozent! Der neue Luba 2 ist auf dem gleichen Gelände wie sein Vorgänger im vergangenen Jahr angetreten. Und überall dort, wo der Vorgänger kurze Pausen einlegte, um das GPS-Signal wiederzufinden, fährt der neue Mäher stur und zentimetergenau weiter. Das betraf im Vorjahr vor allem Bereiche unter oder direkt neben meterhohen Büschen oder Bäumen. Mehr noch: 2023 waren zwei schmale, langgezogene Grasbereiche, die zwischen Haus, Garage und hohen Büschen eingezwängt und teilweise sogar durch Dachüberstand komplett verdeckt sind, der Endgegner für RTK-Mäher. Hier überzeugten uns bereits Dreame A1 (Testbericht) ohne GPS, dafür aber mit Lidar sowie Segway Navimow i1508E/i108E (Testbericht), der auf die gleiche Kombination aus GPS und Kamera wie der Luba 2 setzt. Und der Mammotion-Mäher steht den genannten Modellen in dieser schwierigen Umgebung in nichts nach – außer dass der kleine, im Vergleich zu den Luba-Modellen beinahe filigrane Segway-Bot besser für das enge Gelände geeignet ist. Denn auch hier gräbt der Luba 2 immer mal wieder Teile der Ränder des holprigen Grüns, das mal höher, mal tiefer als etwa angrenzende Wege oder Beete ist, um. Mit Randsteinen entfällt aber zumindest diese Problematik weitestgehend.
Die neue RTK-Antenne scheint übrigens ihren Anteil zur verbesserten Navigationsleistung beizutragen. Denn laut App kam es selbst in den schwierigen Teilen nicht zu einem Verlust der GPS-Signale. Zwar sank die Anzahl der gefundenen Satelliten bei uns auf rund 20 (unter freiem Himmel über 30), aber das Signal wurde unverändert als „fix“ angezeigt. Dank der Kombination aus GPS und Kamera schlägt sich der Luba 2 zudem bei entsprechender Einstellung in der App wie der Vorgänger auch unter Büsche – andere Kamera-Mäher verweigern das.
Der Rest ist weitestgehend gleich (gut): Wird der Frontbumper ausgelöst, piept der Luba 2 wie der Vorgänger einmal und anschließend dreimal, wenn er seine Fahrweise anpasst und das Mähen wieder aufnimmt. Das kann nervig sein, aber bei dauerndem Gepiepe sollten Nutzer lieber die angelernten Grenzen überprüfen, statt sich gestört zu fühlen. Bei anderen Dingen spricht der neue Mammotion-Mäher jetzt, etwa, wenn eine Aufgabe abgeschlossen wurde oder er zum Zwischenladen zurückfährt. Das geschieht derzeit ausschließlich auf Englisch und lässt sich auf Wunsch in der App abschalten. Was sich nach wie vor nicht abschalten lässt, ist die grüne Beleuchtung von RTK-Antenne und Ladestation. Nachts ist das einfach viel zu hell. Aktuell hilft da nur Abkleben. Diebstahlschutz gibt es übrigens per 4G-Funk. Verlässt der Mäher den Mähbereich, bekommt der Nutzer eine Push-Nachricht. Entfernt sich der Luba 2 darüber hinaus aus seinem Geofencing-Bereich, geht ein Alarm los. Bei uns war 4G aber nicht aktiviert.
Eine kleine Rüge müssen wir dem Luba 2 allerdings verpassen: Obwohl Mammotion davon spricht, dass der Bot über die 3D-Vision-Kamera Hindernisse erkennen und identifizieren kann, gilt das zumindest nicht für unsere Igel-Attrappe. Die hat er bei 5 Versuchen jedes Mal übersehen und angefahren. Entsprechend gilt auch hier: Der Luba 2 sollte am besten immer unter Aufsicht und keinesfalls in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden mähen, in der Nacht schon gar nicht. Die Modelle Segway Navimow i150E (Testbericht) und der baugleiche i108E haben die Attrappe übrigens erkannt.
Update: Inzwischen klappt das nach einigen Updates bei uns tadellos – sowohl mit der Igel-Attrappe als auch mit Spielzeug oder einem Gartenschlauch.
Preis: Was kostet der Luba 2 AWD?
Die UVP des Herstellers liegt für die Modelle Luba 2 AWD 1000, 3000 und 5000 bei 2199, 2599 und 2999 Euro. Das Modell AWD 10.000 wird in Deutschland offiziell nicht vom Hersteller angeboten.
Demnächst wird es neben einem Dach für die Ladestation und einem Arm zur Befestigung der RTK-Antenne auch ein Solarpanel mit Akku für die Antenne des Luba 2 geben, das die Antenne autark betreiben können wird. Die Antenne selbst muss ansonsten nicht an der Ladestation installiert werden, sondern wie schon beim Vorgänger mittels eigenem Stromanschluss grob in der Nähe des Mähers und einer Steckdose.
Mammotion hat inzwischen bereits die Modelle für 2025 vorgestellt, die man an einem x in der Produktbezeichnung erkennt. Tests der neuen Reihe folgen in Kürze. Das von uns getestete 2024er-Modell Luba AWD 3000 gibt es nun reduziert zum Preis von 2209 Euro.
Fazit
Der Luba 2 AWD mäht genauso kraftvoll wie der Vorgänger, wühlt sich dank Vierradantrieb genauso überall durch und schafft sogar noch etwas mehr Steigung. Absolutes Highlight ist aber die deutlich stabilere Navigation, die sich durch die Kombination von verbessertem RTK und Kamera nun selbst unter Extrembedingungen nahezu fehlerfrei schlägt. Büsche, Bäume oder Hauswände, die den Luba 1 in Bezug auf den Empfang noch teilweise vor Probleme stellten, lassen den Luba 2 kalt – er mäht einfach stoisch und genau weiter. Sogar der WLAN-Empfang scheint sich verbessert zu haben, neue Funktionen in der App gibt es ebenfalls. Schade, dass wir die Muster, die der Luba 2 eigentlich schon in den Rasen mähen können sollte, bislang nicht ausprobieren konnten – aber das ist wohl für Viele ohnehin nur Spielerei.
Nachteilig wirken sich hingegen Gewicht und Kamera auf den Rasen aus. Gerade in Frühjahr und Herbst, wo schon oder noch gemäht werden sollte, aber Regen ein häufiger Begleiter ist, beschädigt der Luba 2 noch schneller als der Vorgänger die Grasnarbe. Das geschieht besonders bei der Ausfahrt aus der Ladestation, da sich der Roboter zur Orientierung mit der Kamera mehrfach auf der Hochachse dreht. Das hält kein aufgeweichter Durchschnittsrasen aus. Hier sollte Mammotion dringend per Update für Abhilfe sorgen. Der ebenfalls sehr gute, aber deutlich leichtere und Zweirad-angetriebene Stiga A1500 (Testbericht) konnte unter diesen schlechten Bedingungen schon Wochen vor dem Luba 2 getestet werden, ohne den Rasen zu schädigen.
Preis-Leistungs-Sieger
Segway Navimow i-Serie
ab 989 EUR
Im vergangenen Jahr brachte Segway mit der Navimow-H-Serie richtig gute Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt, jetzt folgt die günstigere i-Serie. Wir haben im Test überprüft, was die kann.
VORTEILE
- sehr stabile Ortung dank zusätzlicher Kamera
- mähen selbst bei schlechtem GPS-Empfang gut weiter
- tolle App mit vielen Features
- gute Objekterkennung dank Kamera
- vergleichsweise niedriger Preis
NACHTEILE
- keine elektronische Verstellung der Mähhöhe
- kein Frontbumper mehr
- wg. Kamera kein „ins Gebüsch schlagen“ mehr
Segway Navimow i105E & i108E im Test
Im vergangenen Jahr brachte Segway mit der Navimow-H-Serie richtig gute Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt, jetzt folgt die günstigere i-Serie. Wir haben im Test überprüft, was die kann.
Der Segway Navimow (Testbericht) der H-Serie aus dem Jahr 2023 war und ist richtig gut, die 2024er-Modelle sind sogar noch weiter verbessert worden. Im vergangenen Jahr reichte das zwischenzeitlich sogar für den ersten Platz in unserer Bestenliste zu Mährobotern ohne Begrenzungsdraht. Für damalige Verhältnisse waren die H-Modelle in Relation zur Leistung ziemlich günstig.
2024 legt der Hersteller mit noch preiswerteren Modellen nach. Die neue i-Serie verzichtet dabei zwar auf eine elektronisch verstellbare Schnitthöhe, kommt dafür im Gegenzug aber serienmäßig mit dem beim Vorgänger noch optionalen Kamera-Zubehör namens Vision Fence. Das soll die Navigation weiter verbessern und dafür sorgen, dass selbst bei zwischenzeitlichem Verlust des GPS-Signals effektiv weitergemäht werden kann. Außerdem kommt die i-Serie mit einer automatischen Kartierungsfunktion namens Auto Assist.
Dafür fehlt nun 4G-Funk, der bei der H-Serie ab dem H800E serienmäßig enthalten ist. Auf Wunsch kann das 4G-Modul (Access+) allerdings für rund 100 Euro dazugekauft werden. Da die neuen i-Modelle aber für Rasenflächen von nur 500 und 800 m² (i105E und i108E) ausgelegt sind, ist der Verzicht auf 4G nachvollziehbar – schließlich sollte WLAN für kleine Gärten ausreichen. Allerdings gibt es so auch weniger Diebstahlschutz. Wer zum Thema WLAN im Garten mehr Informationen sucht, empfehlen wir den Ratgeber Wi-Fi im Garten: WLAN-Verstärker, Outdoor Access Point oder Mesh? Was sich bei der i-Serie noch geändert hat, klären wir im Test.
Anmerkung: Da die beiden neuen Modelle bis auf die Akkugröße und die damit verbundenen maximale Rasengröße baugleich sind, gelten die im Test getätigten Aussagen für Segway Navimow i105E und Navimow i108E gleichermaßen.
Was sind die Highlights von Segway Navimow i105E und i108E?
- Navigation per GPS und Kamera und ohne Begrenzungsdraht
- App mit vielen Optionen
- niedriger Preis für einen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht
- Objekterkennung dank Kamera
Der Segway Navimow i105E ist ab 999 Euro bei Obi zu bekommen. Der i108E kostet 1299 Euro (Preisvergleich).
Wie sehen die beiden neuen Modelle des Segway Navimow aus?
Segway hat die Modelle i105E und i108E umgedreht. Hatte die H-Serie die Antriebsachse mit den großen, orangefarbenen Stollenrädern noch hinten und Stützräder vorn, ist das jetzt genau andersherum. Dadurch ist die manuelle Steuerung nun etwas gewöhnungsbedürftig, denn die Roboter fahren sich nicht mehr wie ein Auto, sondern eher wie ein Gabelstapler mit ausschwenkendem Heck.
Davon abgesehen sind die Antriebsräder jetzt noch etwas größer geworden, was für mehr Grip bei normalen Fahrmanövern sorgen soll. Für bessere Steigfähigkeit reicht das aber nicht – im Gegenteil. Die neuen Modelle schaffen nach Herstellerangaben nur noch 30 Prozent Steigung, bei der H-Serie sind es offiziell 45 Prozent. Allerdings hat uns der Grip der H-Serie schon damals nicht überzeugt, zusammen mit ruppiger Fahrweise drehten die Räder immer wieder kurz durch, vorwiegend bei feuchtem Rasen. Bei der i-Serie ist das jetzt tatsächlich etwas besser.
Auffällig: Die neue i-Serie ist kürzer und schmaler als die H-Serie und kommt daher mit einer Schnittbreite von 18 statt 21 cm. Dafür sind die i-Modelle etwas höher. Im Gegensatz zu Saugrobotern dürfte die gewachsene Höhe aber nicht negativ ins Gewicht fallen. Apropos Gewicht: Das neue Modell i105E wiegt nur noch knapp 11 kg, der H500E liegt bei etwas über 16 kg. Die Ersparnis von rund 5 kg dürfte dem Rasen zugutekommen.
Insgesamt sehen die neuen Modelle in unseren Augen etwas moderner als der Vorgänger aus. Dort hatten wir das doch etwas knubbelige, altbackene Design kritisiert, das zwar durch Orange als Kontrastfarbe aufgewertet werden sollte, zusammen mit dem mittelhellen Grau aber nicht recht zur Geltung kommt. Die i-Serie setzt auf dunklere Farbtöne in Kombination mit Silbergrau und etwas Orange – das wirkt frischer. Allerdings fehlt bei den neuen Modellen auch der bei der H-Serie orangene Frontbumper sowie der Blade-Halt-Sensor, der bei der H-Serie die Klingen zum Stoppen bringt, wenn jemand seitlich an den Mäher herantritt. Damit verzichtet die i-Serie gleich auf zwei zusätzliche Sicherheitsmechanismen.
Wie gut ist die App des Segway Navimow i150E und i108E?
Die App ist die gleiche wie im Vorjahr – und das ist auch gut so. Denn sie bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und ist weitestgehend übersichtlich. Einrichtung und erste Schritte werden wie zuvor ausführlich in Bild und Text beschrieben, hier bleiben keine Fragen offen. Etwas nervig ist (ebenfalls wie im Vorjahr), dass bei der ersten Inbetriebnahme oder beim ersten Anlernen der Mähkarte die Einführungen nicht abgebrochen werden dürfen – das ist uns etwas zu viel Bevormundung. Ansonsten gibt es kaum etwas zu meckern, schließlich gab es die Möglichkeit zum nachträglichen Anpassen einer angelernten Zone bereits im Vorjahr.
Neu ist hingegen die Auto-Assist-Funktion. Sie erlaubt es, eine neue Zone nicht manuell wie gehabt mit dem Roboter als „RC-Car“ und dem Smartphone als Fernsteuerung umrunden zu müssen, sondern ihn das selbst vornehmen zu lassen. Dafür taucht an Rändern der neu anzulernenden Zone oben rechts das entsprechende Symbol auf, nachdem der Nutzer mit dem Anlernen begonnen hat. Anschließend fahren i105E oder i108E selbstständig an den Rändern des Rasens entlang und bringt sich die neue Zone selbst bei. Das klappt sogar außerhalb der Bluetooth-Reichweite, die sonst zum manuellen Anlernen zwingend vorausgesetzt wird.
Fährt sich der Bot doch mal fest, wird der Auto-Assist-Modus beendet und der Nutzer muss wieder das Steuer übernehmen. Hilfreich ist dabei die Funktion des automatischen Zurückfahrens entlang der zuvor gelernten Grenze. Dazu muss der Nutzer lediglich das Radiergummi-Symbol gedrückt halten, bis der Roboter wieder eine Position erreicht hat, ab der er manuell weitermachen möchte.
Zum Randmähen gibt es zudem die neue Ride-on-Funktion, bei der der Nutzer dem Roboter bestimmte Grenzbereiche angeben darf, die der hälftig überfahren darf. Das ist etwa bei Terrassen oder Wegen sinnvoll, die gleichauf mit dem Rasen sind. So werden die Kanten besser gemäht. Bei uns im Test wollte das aber nicht funktionieren. Etwas irreführend sind die Funktionen für den Regenschutz. Denn in der App sieht es so aus, als hätten i105E und 108E einen Regensensor, dem ist aber nicht so. Stattdessen verlassen sich beide Modelle auf den Wetterdienst Openweather, anhand dessen Daten die Roboter das Mähen ggf. unterbrechen. Bewegt ein Bot sich hingegen für einen längeren Zeitraum außerhalb des WLAN-Signals oder ist der Wetterdienst mal wieder nicht sehr akkurat, mähen die Navimows auch im stärksten Regenschauer munter weiter.
Wie gut mähen Navimow i105E und i108E?
Der Alltag gestaltet sich wie bei der H-Serie insgesamt sehr zufriedenstellend. Im Vergleich zu den älteren, aber besser ausgestatteten Modellen gibt es ein paar Unterschiede. So ist die Schnitthöhenverstellung nun manuell am Robot durchzuführen, dafür reicht sie jetzt von 20 bis 60 mm. Zuvor klappte das elektronisch über die App, dafür mähte die H-Serie nur 30 bis 60 mm. Wir finden das nicht schlimm – die Höhe verstellen vermutlich die meisten Nutzer nicht regelmäßig und auch unterschiedliche Zonen dürften in den meisten Fällen einheitlich hoch geschnitten werden. Außerdem sind wir kein Fan von Wimbledon-Rasen und niedrigen Schnitthöhen von 20 oder 30 mm, da das Grün gerade in der Sommerzeit schneller als bei Höhen von 50 oder 60 mm gelb oder braun wird.
Ansonsten sind wir von der neuen i-Serie sehr angetan. Die Navigation der neuen Modelle kommt indessen mit EFLS (Exact Fusion Locating System) in Generation 2.0 und zeigte sich im Test tatsächlich verbessert. Dabei sei angemerkt, dass Segway bei der H-Serie kontinuierlich Updates ausgeliefert hat, wodurch die Übergänge bei der Navigation von ELFS 1.0 zu 2.0 eher fließend statt sprunghaft verbessert sind. Insgesamt funktioniert die Mischung aus RTK-System (Real Time Kinematics mit GPS) und Kamera, die inzwischen 22 Gegenstände erkennen können soll, sehr gut. Gerade in schwierigen Ecken des Gartens, an denen der Vorgänger der H-Serie gern mal kurze Verschnaufpausen einlegte, um das GPS-Signal wiederzufinden (oder wie die Konkurrenz ganz aufgab), findet sich die i-Serie deutlich besser zurecht.
Dadurch mäht der Roboter nun auch unter Pflanzenüberhängen oder Bäumen konstant und genau weiter und selbst in Bereichen, wo zuvor nicht an Mähen zu denken war, macht das neue Modell nicht mehr schlapp. Der Rest ist weitestgehend identisch. Die Modelle i105E und i108E ziehen stur ihre gleichmäßigen Bahnen und weichen Hindernissen zum Großteil berührungslos aus. Das gilt für (künstliche) Igel, aber auch testweise verstreutes Gartenwerkzeug oder Kisten. Ein Stromkabel wurde im Test hingegen überfahren, wegen der geringen Höhe nahm es aber keinen Schaden. Wie immer gilt aber: Bei Dämmerung oder Nacht sollten Mähroboter zum Schutz von Tieren nicht fahren. Dafür gibt es auch wieder eine Option in der App, die den Roboter bei schwindendem Tageslicht zur Rückkehr zur Ladestation zwingt. Dank der kleinen LED-Lampe über der Vision-Fence-Kamera dockt der Roboter anschließend auch bei längerer Heimfahrt sicher an.
Der blaue Ring gibt wieder gute Signalstärke an - und die ist bei Segway Navimow i105E und i108E deutlich besser als in 2023 bei der H-Serie TechStage.de
Der Randschnitt klappt bei der i-Serie gefühlt etwas besser als bei der älteren H-Serie, durch die Antriebsräder vorn sind die neuen Modelle wendiger. Wer einen ordentlichen Randschnitt will, sollte aber Zonen manuell anlernen. Die Auto-Assist-Funktion funktioniert zwar prächtig, allerdings hält sie immer einen Abstand zwischen 5 und 15 cm zum Rand ein, sodass hier von „Randschnitt“ nicht die Rede sein kann. Durch die nun insgesamt stabilere Navigation dank EFLS 2.0 hat die i-Serie im Test in puncto Genauigkeit Vorteile.
An Stellen, an denen der Vorgänger starke Probleme mit zwischenzeitlich minutenlangen Pausen zum Wiederfinden des GPS-Signals hatte, mähen die Modelle der i-Serie jetzt durchgehend weiter. Dabei kann es lediglich passieren, dass einige Zusatzdrehungen eingebaut werden, damit die Roboter mit der Kamera die Lage sondieren können. Das führt im Umkehrschluss allerdings auch dazu, dass sich die beiden Roboter weniger gern „ins Gebüsch schlagen“.
Wer eine Grenze anlernt, die die Bots durch Blattwerk oder Ähnliches führt, wird im späteren Betrieb feststellen, dass sie davon abweichen und sich von Ästen, Zweigen oder Blättern vor der Linse zum Ausweichen verführen lassen. Das ist weit weniger als bei den Ecovacs-Modellen (Ecovacs Goat G1 800 Testbericht) der Fall, passiert aber dennoch regelmäßig. Was die Mähfähigkeit in Gebieten mit schlechter GPS-Abdeckung angeht, schlägt die günstige i-Serie von Segway sogar absolute Spitzenmodelle wie den Stiga A1500 (Testbericht).
Außerdem gibt es eine andere Hürde für die Segway-Modelle der neuen i-Serie. Während die meisten Mähroboter auch mit größeren Rasenflächen als den vom Hersteller angedachten klarkommen, ist die Obergrenze von 500 oder 800 m² bei i150E und i108E starr. Wer Zonen mit mehr Rasen anlernen möchte, schaut in die Röhre.
Bei der reinen Mähzeit hat der kleinere Segway Navimow i150E das Nachsehen. Während er rund 60 Minuten am Stück mäht und dann etwa 90 Minuten lang lädt, schafft der i108E etwa 120 Minuten Mähzeit bei 180 Minuten Ladung.
Preis
Der neue Segway Navimow i105E kostet in der UVP des Herstellers 999 Euro, der i108E 1299 Euro. Viel teurer sind H500E und H800E aus dem Vorjahr aber auch nicht mehr, die wir ebenfalls unten zeigen. Der Segway Navimow i105E kostet bei Obi rund 999 Euro, der i108E liegt bei 1299 Euro (Preisvergleich).
Fazit
Die neuen Navimow-i-Modelle von Segway sind eine gelungene Weiterentwicklung der älteren H-Serie. Da sie auf Preis-Leistung getrimmt sind, verzichten sie zwar auf ein paar Features wie die elektronische Mähhöhenverstellung, den Blade-Halt-Sensor, 4G oder den Frontbumper, punkten aber mit Neuen.
Da wäre etwa Auto Assist, mit dessen Hilfe die Roboter selbstständig ihre Mähkarten erstellen, außerdem die deutlich stabilere Navigation, mit der die i-Serie auch dort mähen kann, wie die H-Serie im vergangenen Jahr aufgegeben oder zumindest minutenlang ausgesetzt hat. Auch das Mähen der Ränder gelingt dem i150E und i108E etwas besser. Und dann ist da noch der günstigere Preis, der die Modelle sicherlich für weitere Interessenten spannend machen dürfte, obwohl die H-Modelle nicht mehr deutlich teurer sind. Wer Rasengrößen bis 500 oder bis 800 m² sein Eigen nennt, erhält mit den neuen i-Modellen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.
Stiga A-Serie
ab 2279.99 EUR
Traditionshersteller Stiga baut nicht nur Aufsitzmäher und anderes Gartenwerkzeug, sondern auch Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht. Der Stiga A1500 will ohne Draht mit besonders genauer Ortung, perfektem Schnitt und geringem Gewicht punkten.
VORTEILE
- tolles, rasenschonendes Chassis
- gute Steigfähigkeit
- hervorragendes Schnittbild
- grandioser Empfang
- gute Navigation
- lange Garantie und kostenfreie Kommunikation via 4G
NACHTEILE
- Preis etwas höher
- App hat Luft nach oben
Mähroboter Stiga A1500 im Test
Traditionshersteller Stiga baut nicht nur Aufsitzmäher und anderes Gartenwerkzeug, sondern auch Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht. Der Stiga A1500 will ohne Draht mit besonders genauer Ortung, perfektem Schnitt und geringem Gewicht punkten.
Seit 2018 liegt das Hauptquartier von Stiga im neu erbauten Firmensitz in Castelfranco Veneto in der Nähe von Venedig und produziert dort zahlreiche motorisierte Gartengeräte mit und ohne Akku. Seit 2023 fallen darunter auch Mähroboter ohne Begrenzungsdraht. Im Gegensatz zu den meisten bisher von uns getesteten Geräten kommen viele Stiga-Geräte direkt aus dem Werk in Italien und nicht aus China. Das bezieht sich auf Hardware wie Motor, Chassis und Akku, aber auch auf die Software, etwa die App. Außerdem sind die Rasenmäher-Roboter zwar inzwischen auch in Baumärkten wie Globus oder Bauhaus zu finden, allerdings gibt es zudem ein ausgeprägtes regionales Händlernetzwerk ähnlich wie bei Honda oder Kress.
Das kostet natürlich, ein Schnäppchen sind die Stiga-Mähroboter der A-Serie nicht. Das macht den Kampf gegen die chinesischen Neuankömmlinge wie den Dreame A1, den neuen Segway-Modelle oder auch aktualisierte Ecovacs-Geräten nicht gerade einfacher. Statt mit dem Preis will Stiga stattdessen mit Qualität und „Made in Europe“ überzeugen. Wir wollten ganz genau wissen, ob dieser Schlachtplan aufgeht, und haben uns nicht nur im Werk bei Venedig umgeschaut, sondern auch den kabellosen Stiga A1500 ganz genau unter die Lupe genommen.
Highlights
- super leichtes und gut ausgewogenes Chassis
- dadurch erstaunliche Steigfähigkeit
- schont den Rasen
- sehr guter GPS-Empfang
- tolle Navigation
- super Schnittbild
- lange Garantie
- Fachhändler für Service in der Nähe
Die verschiedenen Modelle gibt es hier am günstigsten:
Wie sieht der Stiga A1500 aus?
Im Gegensatz zum Mammotion Luba AWD im Rennwagendesign oder dem Ecoflow Blade, der wie ein Mondbuggy aus einem Sci-Fi-Film aussieht, kommt der Stiga A1500 recht konservativ daher. Am auffälligsten ist hier die gelb-schwarze Farbgebung des Roboters im Corporate Design, der Rest unterscheidet sich kaum von den kabelgebundenen G-Modellen des Herstellers oder anderen Schleifenmähern auf dem Markt. Kameras, Lidar („Laser/Radar“) oder andere Sensoren sucht man vergeblich, wie die meisten nicht chinesischen Hersteller verzichtet auch Stiga auf derartige Unterstützung. Zumindest aus Datenschutz-Sicht ist das ein großes Plus.
Konventionell ist auch der restliche Aufbau des Mähers. Die hinteren beiden Antriebsräder mit Stollenprofil werden vom gelben Gehäuse nicht verdeckt, die beiden antriebslosen Stützräder sind hingegen nur zu sehen, wenn der Roboter umgedreht wird. Einen gesonderten Bumper hat der A1500 nicht, stattdessen dient das ganze Chassis als Kontaktsensor. Das elektronisch verstellbare Mähwerk mit Mähteller und vier Klingen ist mittig statt nach rechts versetzt platziert, entsprechend ist der Stiga A1500 zumindest auf dem Papier kein ausgemachter Kantenkobold.
Oben befindet sich die typische große, rote Stopp-Taste, mit der der Bot nicht nur im Notfall angehalten, sondern auch die Abdeckung entriegelt wird, unter der sich ein kleines Folien-Bedienfeld mit LEDs befindet. Der Großteil der Bedienung dürfte aber ohnehin von den meisten Nutzern über die Smartphone-App abgewickelt werden. Einer der größten Vorteile des Stiga A1500 wird offensichtlich, wenn man ihn anhebt. Gerade einmal 8,5 Kg bringt er auf die Waage, das Mammotion-Modell wiegt mehr als doppelt so viel. Wie sich das genau auswirkt, klären wir im weiteren Verlauf des Tests.
Die Ladestation fällt vor allem durch ihre Unauffälligkeit auf – hier gibt es nicht einmal das hervorstechende Gelb des Roboters und auch keine LED-Beleuchtung. Oder zumindest ist die nur zu sehen, wenn der Roboter nicht in der Station steht – im Vergleich zur chinesischen Disco-Konkurrenz, die nachts ein wahres Farbfeuerwerk abstrahlt, ist das eine Wohltat.
Wie einfach klappen Einrichtung und Installation?
Je nach Kaufort müssen Nutzer den Roboter selbst mit der Stiga-GO-App verbinden (Baumarkt- oder Online-Kauf), alternativ macht das der Stiga-Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde. Die Verbindung mit dem Roboter ist denkbar einfach, auch hier gilt: einfach den Anweisungen auf dem Smartphone-Display folgen. Wichtig ist dabei nur, den kleinen gelben Notschlüssel in die kleine Öffnung unter der oberen Abdeckung einzustecken – sonst passiert schlicht gar nichts. Außerdem möchte die App schon bei der Einrichtung wissen, wo das Modell gekauft wurde. Als Beleg dient dann Rechnung oder Kassenzettel. Wer diesen Schritt nicht überspringt und später einmal jährlich einen „Service“ bei einem der Vertragshändler durchführen lässt, bekommt eine verlängerte Garantie auf bis zu 5 Jahre. Spart sich der Kunde den Service etwa im zweiten Jahr, endet die Garantie nach drei Jahren – mehr dazu später.
Wichtig ist eine gute Positionierung der Basis- und Ladestation, hier helfen App oder Handbuch. Zu nah an Hauswand oder unter Bäumen sollte die Station nicht stehen. Bei uns steht sie wie bei den anderen Tests im vergangenen Jahr rund 2 bis 3 Meter von einer Hauswand entfernt und somit nicht optimal, hier gilt: gleiches Recht (oder gleiche Pflicht) für alle. Bei der Installation positiv: eine gesonderte Antenne gibt es grundsätzlich nicht, unter Zuhilfenahme einer 15-Meter-Verlängerung lässt sich aber das GNSS-Modul aus der Station ausbauen und an einem separaten Ort betreiben. Auch ganz woanders ist eine Installation möglich, dafür wird dann aber ein separates Netzteil benötigt. Die Befestigung für die Antenne ist hingegen bereits im Lieferkarton enthalten. Eine genaue Reichweitenangabe gibt es dabei nicht, Gerüchten nach sollen aber sogar etliche Kilometer Entfernung möglich sein. Damit könnte man theoretisch ganze Ortschaften mit einem Gerät abdecken, sofern Zufahrten zu den verschiedenen Rasenflächen vorhanden sind.
Wie gut ist die App?
Nach diesen Schritten geht es los. Der Nutzer landet wie bei der Konkurrenz auf einer Übersichtsseite, auf der alle mit der App verbundenen Geräte dargestellt werden. Hier gibt es eine kurze Information zu Verbindungsstatus, Akkuladestand und Status – also was der Mäher gerade tut. Auf der Geräteseite selbst wechselt vor allem der Hintergrund in ein schönes Rasenbild, es gibt die gleichen Angaben noch einmal (wenn auch in anderer Darstellung). Außerdem darf der Nutzer hier in seine Gartenverwaltung gehen oder den Mäher direkt zum Mähen schicken, im Betrieb anhalten sowie zurück zur Station schicken.
Spannend ist die Gartenverwaltung. Hier zeigt die App oben den Grundriss der bereits angelernten Zonen samt per Google Maps ausgelesener, angedeuteter Bebauung. Über einen Button ist der Wechsel in die Satellitenansicht möglich. Bei uns passte die Ansicht nicht, alle Gebäude waren mehrere Meter verschoben und blockierten (virtuell) teils die Mähzonen. Auswirkung auf die Navigation hatte das aber nicht. Unter der Karte, die zwar die Ladestation, nicht aber die Live-Position des Mähers zeigt, führt ein weiterer Button in die tiefere Gartenverwaltung. Darunter gibt es Einblick in Sperrzonen, die temporär oder dauerhaft nicht gemäht werden sollen. Zudem findet man auf dieser Seite noch den Übungsmodus, mit der man die Steuerung des Roboters per Handy probieren kann.
Wer erneut den Gartenbereich anwählt, landet endlich auf einer Karte, die auch den Live-Aufenthaltsort des A1500 anzeigt. Die Karte ist außerdem etwas größer und erlaubt über einen Button direkt zum Roboter zu springen – praktisch, wenn die Mähkarte größer ist. Was fehlt, ist eine Fortschrittsanzeige des Mähvorgangs, die haben wir schmerzlich vermisst. Unter der Karte werden die bereits angelegten Mähzonen samt deren Quadratmeterzahlen aufgelistet. Ein Fingertipp auf den Namen der Zone führt die sogenannten Verknüpfungen auf. Gemeint sind vom Nutzer festgelegte Pfade, die entweder die jeweilige Zone mit anderen oder der Ladestation verbinden – auch der muss (oder darf) händisch angelegt werden. Das ist vor allem dann praktisch, wenn die Basisstation nicht in oder an einer der Zonen liegen soll. Hier lassen sich weiterhin Pfade oder No-Mow-Zonen hinzufügen, außerdem eines von vier Schnittmustern auswählen („systematischer Nord-Süd-Schnitt“, „Systematischer Ost-West-Schnitt“, „Schachbrett“ oder „parallel in vier Richtungen“) oder gleich ein benutzerdefinierter Schnittwinkel. Abschließend darf der Besitzer hier die „Kantenbegradigung“ anwählen, die den Stiga-Mäher dazu bringt, nach geschnittener Fläche die Ränder der Mähfläche dreimal abzufahren – ein Übersetzungsfehler, von denen es noch ein paar weitere gibt.
Zu guter Letzt kann man die Schnitthöhe pro Zone in 5-Millimeter-Schritten von 20 bis 60 Millimeter variieren. Ganz unten geht es in die „Bereichsaktionen“, die der Nutzer ebenfalls erreicht, wenn er zuvor in der Zonenauflistung auf die drei Punkte am rechten Rand klickt – etwas doppelt gemoppelt. Hier lässt sich der A1500 zum Mähen der ausgewählten Zone bewegen (mehrere lassen sich so nicht auswählen), fährt den Bereich ab oder erlaubt das Anpassen der Umgrenzung. Übrigens: Wer die einzelnen Zonen statt Zone 1, Zone 2 usw. selbst benennen will, klickt oben rechts auf die drei Punkte. Dort steht derzeit zwar noch „Gerät umbenennen“, gemeint ist aber nicht der Roboter, sondern die Mähzone. Ganz unten im Bereich „Garten“ dürfen Nutzer Zonen einrichten, die der Roboter nur per menschlicher Muskelkraft erreicht, da es keine direkte Zufahrt für den Bot gibt – mähen kann der Roboter dort trotzdem. Außerdem gibt es hier den großen Button „Neue Zone Hinzufügen +“, der für jeden Technikfan eine ganz besondere Anziehung ausübt.
Wie erstellt der Stiga A1500 neue Mähzonen?
Das Einrichten neuer Mähzonen erfolgt bei Stiga wie bei der kabellosen Konkurrenz: Durch Abfahren der Ränder. Händler bieten dafür ein Wägelchen, auf das der Mäher gesetzt und dann vor sich hergeschoben werden kann. Alle anderen müssen den Roboter mit dem Smartphone wie ein ferngesteuertes RC-Auto einmal um die neu zu schaffende Mähzone fahren. Dabei erreicht der A1500 eher gemächliche Geschwindigkeit, was während des Erstellvorgangs völlig in Ordnung ist, auf dem Weg dorthin aber etwas ermüdend wirkt. Im Vergleich dazu müssen Nutzer dem Luba der ersten Generation auf höchster Fahrgeschwindigkeit regelrecht hinterher joggen.
Gestört hat uns beim Stiga-Modell aber nicht die niedrige Geschwindigkeit, sondern die etwas schwammige Steuerung. Der Roboter ließ sich im Test nur schwer geradeaus fahren, nach der ersten Lenkung kam es trotz großer Bemühungen schnell zu leichten Pendelbewegungen, um Überkorrekturen auszugleichen. Das machen Wettbewerber wie Mammotion oder Segway besser. Ansonsten klappte das Erstellen neuer Zonen problemlos, allerdings will der A1500 nach erfolgreich erstellter Zone diese im Anschluss testweise noch einmal komplett abfahren. Das kostet zwar Zeit und nervt gerade bei größeren, verwinkelten Zonen. Wer will, kann das aber mit Trick 17 abkürzen – einfach schnell die Stopp-Taste drücken, nachdem der Mäher die ersten Meter gefahren ist. Dann meldet die App zwar einen Fehler, die Zone ist trotzdem eingerichtet. Einen Unterschied zu tatsächlich noch einmal umrundeten Zonen konnten wir nicht ausmachen. Stiga spricht davon, dass der Bot ohnehin in den ersten 14 Tagen seine Mähflächen besser kennenlernt und so allmählich besser wird. Tatsächlich konnten wir anfangs Abweichungen von mehreren Zentimetern zur tatsächlich gefahrenen Spur erkennen, nach innen wohlgemerkt. Entsprechend gab es keine gravierenden Zwischenfälle wie Blumenmassaker oder Ähnliches. Scheinbar rechnet der Roboter immer noch ein paar Extra-Sicherheits-Zentimeter ein und tastet sich erst Tag für Tag näher an die geplante Begrenzung.
Inzwischen klappt übrigens auch eine nachträgliche Anpassung von Zonengrenzen, auch hier wird der zu ändernde Teil einfach neu abgefahren. Der Roboter fährt dabei sogar eigenständig an den frei wählbaren Startpunkt der zu ändernden Zone. Zum Marktstart fehlten solche Funktionen noch und generell ist die App umfangreicher, schöner und responsiver geworden. Ganz zufrieden sind wir damit aber bisher nicht. Bei uns dauert es immer 6 bis 8 Sekunden, ehe die App – etwa aus dem Hintergrund aufgerufen – wieder aktuelle Angaben macht.
Auch sind wir mit der zu tief versteckten Live-Karte nicht zufrieden, uns gefällt das so wie bei der chinesischen Konkurrenz besser. Dort ist die Karte fast immer der zentrale Dreh- und Angelpunkt und zeigt auch den Mähfortschritt an. Hinzu kommen Kleinigkeiten wie Übersetzungsfehler oder der Umstand, dass etwa der kleine Infobutton neben Status und Mähmodus auf der Hauptseite nur in eine ellenlange Liste mit Erklärungen zu allen Anzeigemöglichkeiten führt, statt direkt und ausschließlich Hilfe zum angezeigten Text zu geben. Insgesamt wirkt die App einfach etwas umständlich, bietet aber alle wichtigen Funktionen. Schlussendlich ist sie schon brauchbar, hat aber noch Luft nach oben.
Wie gut ist der Empfang vom Handy zum A1500?
Die Kommunikation zwischen Handy und Mäher erfolgt ausschließlich via 4G-Modul, das bereits im A1500 integriert ist und ein Roboterleben lang für den Kunden kostenfrei bleibt. Letzteres ist bei den meisten Konkurrenten anders, hier sind oft nur die ersten 1 oder 2 Jahre kostenfrei, danach müssen Besitzer in die eigene Tasche greifen. Wer eine halbwegs ordentliche Mobilfunkabdeckung am Mähort hat, kann von überall auf der Welt aus problemlos auf den Stiga-Roboter zugreifen.
Auch die Diebstahl-Sicherung wird über die App geregelt. Sobald ein Nutzer sich über die App als Eigentümer registriert hat, ist Zugriff auf den Mäher nur noch über das Benutzerkonto des Besitzers möglich. Löscht er den Roboter in seiner App, löscht er auch die Bindung an seinen Account. Im Zweifelsfall kann Stiga bzw. ein Fachhändler in der Nähe als letzte Instanz eine Wiederaufnahme der Verbindung herbeiführen, sofern die Eigentümerschaft zweifelsfrei (etwa durch Kaufbelege) verifiziert werden kann. Im Falle eines Diebstahls gibt es eine Nachricht auf das Smartphone des Besitzers, sobald der Mäher aus dem Geofence-Bereich entfernt wird. Ist das Gerät noch aktiviert, ist eine Ortung möglich.
Wie gut mäht der Stiga A1500 im Alltag?
Bevor wir auf diese Frage eingehen, wollen wir erwähnen, dass es der A1500 als erster Mähroboter im Jahr 2024 bei uns im Test und noch dazu zu einer recht frühen Jahreszeit schwerer als einige Pendants im vergangenen Jahr hatte. In Norddeutschland regnet es auch Mitte April noch sehr häufig, entsprechend tief und nass war der Rasen. Trotz allem war dieser zu Testbeginn schon recht hoch und glich zusätzlich einer Huckelpiste statt eines englischen Rasens. Hinzu kam eine geschlossene Wolkenschicht, die es der Ortung und Positionierung bei GPS-Mähern zusätzlich schwer macht. Trotzdem kam der Stiga A1500 auf ähnlich gute oder sogar bessere Ergebnisse wie unsere bisherige Nummer Eins, der Mammotion Luba unter besseren Bedingungen – beachtlich! Noch dazu geht der A1500 wesentlich schonender mit dem schwierigen, nassen Grün um, als der Luba oder dessen Nachfolger. Mehr dazu demnächst, sobald der Test mit dem Luba 2 möglich ist, ohne einen völlig zerstörten Acker aus dem Testrasen zu machen.
Bleiben wir beim Umgang mit dem Rasen. Der Stiga A1500 punktet mit für diese Klasse (der Hersteller gibt dem Namen entsprechend eine Rasenfläche von 1500 m² als angepeilte Gartengröße an) mit einem äußerst geringen Gewicht von nur 8,5 Kg. Der Mammotion Luba 2 wiegt rund 18 Kg, beim Segway Navimow sind es um 16 Kg und der Ecovacs Goat G1 kommt auf etwa 13,5 Kg. Zusammen mit seiner offensichtlich guten Gewichtsverteilung bewegt sich der A1500 trotz Regen beinahe leichtfüßig über das Grün, ohne es dabei aufzureißen. Tatsächlich haben wir selten durchdrehende Antriebsräder feststellen können – und wenn, dann nur sehr kurz. Andere Modelle wie der Ecoflow Blade fuhr sich trotz deutlich besserem (aber dennoch feuchtem) Wetter regelmäßig fest, seine durchdrehenden Räder gruben sich immer wieder ein. Auch der Segway Navimow geriet durch sein ruppiges Anfahren wieder und wieder ins Rutschen. Selbst Steigungen bewältigt der Stiga-Roboter nahezu ohne Rutschbewegungen. Das konnten wir zwar nicht selbst (im norddeutschen Testgarten) ausprobieren, dafür aber mit eigenen Augen auf dem Testgelände des Herstellers in Italien sehen. Nach offiziellen Angaben schafft der Roboter 45 Prozent Steigung (24 Grad) – wir waren verblüfft, wie einfach der A1500 an Hängen navigiert, obwohl er nur zwei angetriebene Räder hat.
Auch der eigentliche Rasenschnitt hat uns überzeugt. Aufgrund der schlechten Testbedingungen scheuen wir uns zwar, zweifelsfrei vom „besten Schnitt“ der bislang von uns getesteten Mäher ohne Begrenzungsdraht zu sprechen. Was wir gesehen haben, ist aber wirklich beeindruckend. Schon beim Erstschnitt bei viel zu langem Gras biss sich der A1500 kraftvoll durch. Uns ist bewusst, dass der eigentlich von einem Handmäher gemacht werden sollte, wir haben das gleich als Extremtest genommen. Das hat bislang nur der Luba geschafft, der Rest der Testmodelle konnte dafür oft nicht genug Kraft im Schnittwerk aufbringen. Das sah anfangs zwar erstaunlich gut, aber alles andere als perfekt aus. Nach einigen Durchgängen an verschiedenen Tagen wich das Massaker dann einem glatten Grün – im Rahmen der Möglichkeiten des Testareals. Dann kamen auch schön die Testbahnen zum Vorschein, die schnurgerade in den Rasen geschnitten wurden. Dabei besonders beachtlich: der niedrige Geräuschpegel, mit dem der A1500 mäht. Stiga spricht von 57 bis 59 LWA (Schalldruck direkt am Mäher), der A1500 gehört damit zu den leisesten Rasenrobotern ohne Begrenzungsdraht.
Im Rahmen der Möglichkeiten des Testareals hat der Stiga A1500 in kürzester Zeit aus einer Wiese (siehe hinterer Rand) eine fast schöne Grünfläche gemacht TechStage.de
Was uns erst irritiert hat, ist der Umstand, dass der A1500 seine Arbeit nicht fortsetzt, wenn er wegen leerem Akku zur Ladestation zurückgekehrt und nach etwa 2 Stunden wieder geladen ist. Stiga begründet das damit, dass das den Rasen schont, da immer nur ein Teil des Gartens gemäht wird und empfiehlt, maximal zwei Durchgänge pro Tag einzustellen. Denn nach dem Laden ist natürlich ein manueller oder ein geplanter Start möglich, wobei der Roboter an der zuletzt gemähten Stelle anknüpft. Was uns dann aber fehlt, ist eine Benachrichtigung per Push-Benachrichtigung, dass der Roboter wieder lädt. Solche Nachrichten gibt es nur, wenn er sich doch einmal festgefahren hat.
Oder natürlich bei anderen Vorkommnissen wie, wenn der Bot angehoben oder gar aus dem Garten entfernt wird. Vom Fahren in Dämmerung oder Nacht raten wir (und Stiga) übrigens dringend ab. Der A1500 hat zwar eine weit bis nach unten gezogene Frontschürze, mangels zusätzlicher Sensoren außer dem Stoßsensor kann er nachtaktive Tiere oder andere Hindernisse nicht erkennen.
Navigation – wie stabil ist der GPS-Empfang beim A1500?
Stiga gibt an, dass das AGS (Active Guidance System) des A1500 zusammen mit KI dazulernt und dann genau weiß, wann und wo Satellitenbahnen sind und wann der Empfang am Tag gut oder schlecht ist. Das können wir nicht genau beurteilen. Fakt ist, dass Empfang und damit auch die Positionierung und Ortung trotz der widrigen Umstände sehr gut funktioniert haben. Es gab aber Stellen, an denen der A1500 immer wieder mal (jedoch nicht immer) zu knabbern hatte. Dazu gehörte etwa die Zufahrt über einen schmalen Weg direkt am Haus, der noch dazu durch einen Dachüberhang oben und auf der anderen Seite von mehrere Meter großen Rhododendron-Büschen abgeschirmt wird. Hier verzweifelte bislang jeder GPS-Mäher früher oder später, der A1500 seltener.
Denn so fortschrittlich die GPS-Technik auch zu sein scheint – solche Umgebungen sind der Endgegner für jeden entsprechend navigierenden Mähroboter. Von solchen Extremstellen abgesehen hat sich der Mäher nicht festgefahren und eine Unterbrechung der Arbeit, um verlorene GPS-Positionierung zu finden, konnten wir ebenfalls nicht verzeichnen. Bestenfalls dauert es vor dem Losfahren aus der Station einige Sekunden, bis der A1500 wirklich startet, da er erst ein GPS-Signal sucht. Das ist ziemlich beeindruckend.
Produktion, Garantie und mehr
Es klang bereits an: Stiga produziert zwar auch im Ausland, aber eben im Werk in Italien. Dort findet auch die Entwicklung und der Test von diversen Modellen statt, bei denen Gefährdung für Nutzer betrachtet, aber auch Langlebigkeit, Funktion und weitere Faktoren erprobt werden. Davon konnten wir uns selbst einen Überblick vor Ort in Castelfranco Veneto machen. Zwar werden Dinge wie bestimmte Bauteile (etwa einzelne Akkuzellen, Schrauben etc.) natürlich von externen Quellen bezogen, Entwicklung, Design, Zusammenbau und sogar die Software entwickelt Stiga aber selbst.
Da ist es kein Wunder, dass der Hersteller recht schnell auf Anpassungswünsche reagieren kann. So mag die Software zum Testzeitpunkt bis jetzt nicht perfekt sein, im Vergleich zu Berichten aus 2023 ist der Fortschritt aber enorm. Außerdem kann Stiga so beruhigt bis zu 5 Jahre Garantie und damit mehr als die meisten Wettbewerber auf seine Mähroboter geben – schließlich weiß der Hersteller bis ins Detail, was wann und wie mit den einzelnen Bauteilen passiert. Die Absicherung über die Verpflichtung des Käufers, jährlich eine Inspektion des Roboters von einem Vertragshändler vornehmen zu lassen, sichert Stiga letztlich zu, dass der A1500 stets sachgerecht behandelt wird. Ersatzteile verspricht der Hersteller für einen „langen Zeitraum“, eine fixe Angabe dazu gibt es aber nicht.
Die Reinigung sollte auf dem Rücken liegend nicht mit dem Gartenschlauch erfolgen, stehend reicht der IPx5-Schutz dafür aber aus TechStage.de
Wir haben übrigens den nächsten Händler in der Nähe kontaktiert, den wir bequem über die Stiga-GO-App finden konnten. Zwar schwanken die Preise für den Service von Händler zu Händler, in unserem Fall nannte der Ansprechpartner allerdings einen Preis von 100 Euro plus Material. Eine Einlagerung über den Winter lag bei 25 Euro. Nach Angaben von Stiga gibt es dabei vorgegebene Arbeitsschritte, die ein Vertragshändler beim Service durchführen muss – etwa eine Dichtigkeitsprüfung. Der Service geht also über „einfach mal drüberwischen“ weit hinaus. Kosten für die Kommunikation über das 4G-Netz fallen standardmäßig ein Roboter-Leben nicht an.
Preis
Knapp 3000 Euro kostet der Stiga A1500 in der UVP des Herstellers, den wir hier getestet haben. Darunter angesiedelt sind die technisch minimal abgespeckten Modelle A1000 und A750, darüber die Modelle A3000, A5000, A7500 und A10000 mit den sogenannten „großen Chassis“. Die Zahl bestimmt jeweils, für welche Rasenflächen sie laut Hersteller gedacht sind.
Inzwischen sind die Preise für die 2024er-Modelle aber deutlich gefallen. Der Test der 2025er-Varianten folgt in Kürze
Die verschiedenen Modelle gibt es hier am günstigsten:
Weitere Mähroboter ohne Begrenzungsdraht und Zubehör wie Garagen und Ersatzklingen gibt es unter anderem hier.
Fazit
Zugegeben: Wir haben dem Stiga A1500 den ersten Platz unserer Bestenliste für Mähroboter ohne Begrenzungsdraht (zum Testzeitpunkt) vor dem Test nicht zugetraut – obwohl wir die Modelle in Italien bereits eindrucksvoll in Aktion gesehen haben. Nach unserem Test sind wir hingegen überzeugt: Der Stiga A1500 ist unsere neue Nummer Eins. Denn das Modell (und damit die ähnlich aufgebauten anderen Modelle der Reihe) bietet unter den bislang von uns getesteten Mährobotern ohne Perimeterdraht den besten GPS-Empfang, ist sehr leise, hat ein tolles – wenn nicht sogar das beste Schnittbild. Zudem beschädigt er die Grasnarbe deutlich weniger, als unsere bisherige Nummer Eins Mammotion Luba (Testbericht) und dessen Nachfolger Luba 2, der bereits in den Startlöchern steht. Gerade, wer in regenreicher Landschaft wohnt, wird das zu schätzen wissen.
Tatsächlich ist der Preis, den wir anfangs für recht hoch erachteten, derzeit durch diverse Angebote relativiert, gleiches gilt für die lange Garantie, die Ersatzteilversorgung sowie lebenslang kostenlose Kommunikation per Mobilfunk. Auch unser zweiter kleiner Kritikpunkt, nämlich die App, schafft es nicht, den A1500 hinter anderen Modellen unserer Bestenliste zu drängen. Denn die Software ist bisher nicht perfekt, aber man kann damit problemlos arbeiten, wenn man sich einmal dran gewöhnt hat. So bleibt unter dem Strich ein toller Mähroboter ohne Begrenzungsdraht für alle, die sich solch ein Luxusgut leisten können und wollen. Die günstigeren Alternativen bleiben (wenn es ein Roboter sein soll) kabelgebundene Geräte, wie wir bereits in unserem Ratgeber aufgezeigt haben.
Dreame A1
ab 1299 EUR
Mähroboter fahren mittlerweile auch ohne Begrenzungsdraht. Stattdessen verwenden sie GPS und/oder Kameras. Saugroboter-Hersteller Dreame setzt beim neuen Mähroboter Dreame A1 auf Lidar. Wie gut das funktioniert, zeigt der Test.
VORTEILE
- hervorragende Navigation mit Lidar statt GPS oder Begrenzungsdraht
- schickes, flaches Design
- schon jetzt gute App
- ordentliches Schnittbild
NACHTEILE
- noch keine Anpassung von Zonen möglich
- derzeit nur 2 Zonen
- Chassis zu lang, dadurch bisweilen durchdrehende Räder
Perfekt für schwierige Gärten: Mähroboter Dreame A1 mit Lidar statt GPS im Test
Mähroboter fahren mittlerweile auch ohne Begrenzungsdraht. Stattdessen verwenden sie GPS und/oder Kameras. Saugroboter-Hersteller Dreame setzt beim neuen Mähroboter Dreame A1 auf Lidar. Wie gut das funktioniert, zeigt der Test.
Saugroboter fahren schon seit Jahren mit Lidar (Light Detection and Ranging) zentimetergenau durch den Haushalt, Haushaltshelfer mit Laserturm haben sich längst gegen Kamerasysteme durchgesetzt. Bei Mährobotern ist das anders, aktuelle Modelle, die ohne Begrenzungsdraht auskommen, verwenden überwiegend entweder Kameras und/oder RTK (Real Time Kinetics) mit GPS (Global Positioning System) zur Orientierung. Kameras haben bisweilen Probleme bei der Erkennung bestimmter Situationen. GPS ist hingegen nicht immer stark genug verfügbar und lässt sich zu leicht durch Hindernisse blockieren – alle von uns getesteten Modelle erledigen zwar mehr oder weniger gut ihren Job, allerdings gibt es dabei immer wieder diverse Einschränkungen.
Der chinesische Hersteller Dreame geht nun einen anderen Weg. Nachdem das Unternehmen mit seinen Saugrobotern inzwischen den Konkurrenten aus gleichem Hause, Roborock, bei den smarten Saug- und Wischrobotern zumindest in Deutschland überholt hat, bringt das Unternehmen jetzt einen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt. Und der navigiert wie Saugroboter mit Lidar – nur mit Lidar. Kamera, GPS oder andere Sensoren außer einem Stoßfänger gibt es nicht, Datenschützer dürfte das freuen.
Mangels Abhängigkeit von der Stärke eines GPS-Signals verspricht der Dreame A1, auch dort noch fahren und gute Arbeit verrichten zu können, wo RTK- und Kameramäher kapitulieren. In eine ähnliche Kerbe schlagen auch die Modelle von Ecovacs, die hauptsächlich auf Kamera, aber auch auf Navigationsbaken statt GPS setzen. Was gut klingt, stößt in einem gewachsenen Garten aber schnell an Grenzen, wie wir beim Ecovacs Goat G1 (Testbericht) ausführlich beschrieben haben. Wir wollten im Test des Dreame A1 wissen, ob Lidar sich unter solchen Umständen besser schlägt und ob der A1 überhaupt Konkurrenz für bewährte Modelle ist.
Was sind die Highlights des Dreame A1?
- Schickes Design
- Gute App
- Keine Abhängigkeit von GPS-Empfang
- Keine Probleme durch Kameras
Der Dreame A1 kostet in der UVP des Herstellers 1999 Euro. Auch bei Amazon kostet der Mäher zum Testzeitpunkt 1999 Euro.
Design
Eins fällt beim neuen Dreame A1 sofort auf: Das lange, flache Chassis mit glänzendem Finish in Silber. Während so gut wie alle anderen Hersteller auf widerstandsfähigen, matten Kunststoff setzen, verpasst Dreame seinem Modell eine Oberfläche wie ein Luxusauto. Finish und langgestrecktes Chassis lassen den Roboter mit dem kleinen „Knopf“ vorn, bei dem es sich um das Lidar-System handelt, hochwertig erscheinen. Außerdem ist der Wiedererkennungswert hoch.
Der Rest ist hingegen Standard: Es gibt zwei nur teilweise verdeckte, große Antriebsräder mit Stollen, vorn zwei ungelenkte Stützräder. Die große Stopp-Taste im hinteren Bereich der Oberseite unterbricht nicht nur sofort den Mähvorgang, sondern öffnet gleichzeitig auch die obere Abdeckung, unter der ein kleines Display sowie ein dreh- und drückbarer Bedienknopf und Folientasten zur weiteren Steuerung untergebracht sind. Das erinnert an den Worx Vision (Testbericht), nur dass diese Elemente dort nicht unter einer Abdeckung verborgen sind. Die Unterseite des A1 bietet mit drei per Schnellverschluss ohne Werkzeug wechselbaren Klingen ein weiteres kleines Highlight des rund 12 kg schweren Geräts. Zudem darf der Dreame-Mäher dank IPx6-Zertifizierung auch auf der Unterseite mit einem Gartenschlauch abgespritzt werden – das ist bei vielen Wettbewerbern anders.
Wie gut ist die App des Dreame A1?
Zur Steuerung des Dreame A1 kommt die bewährte Dreamehome-App zum Einsatz. Dort scannt der Nutzer mit seinem Smartphone wie gewohnt den QR-Code, der unter der Bedienfeldabdeckung positioniert ist, und folgt den weiteren Anweisungen. Das klappt genauso einfach wie bei den Saugrobotern des Herstellers. Im Laufe der Einrichtung wird nach der Bluetooth-Verbindung auch eine WLAN-Verbindung hergestellt, über die der Roboter später auch aus der Ferne gesteuert werden kann. Ist das geschafft, erwartet den Besitzer ein im Vergleich zu den Saugrobotern ähnlicher, aber nicht identischer Aufbau der App-Oberfläche.
Mittig ist die Mähkarte positioniert, darüber Auswahlbuttons für die Mähart („Gesamtes Gebiet“, „Begrenzung“, „Zone“), Zeitpläne (unterteilt nach Frühling/Sommer und Herbst/Winter), Karte, Einstellungen und Sperrung der Bedienung am Mäher. Darüber befindet sich eine weitere Reihe mit Anzeigen für Bluetooth, WLAN und (optionales) 4G, außerdem werden hier die Gesamtgröße aller Zonen und die Akkuladung des Roboters angezeigt. Ganz oben rechts gibt es über das typische Dreipunkt-Menü Zugriff auf weitere Optionen wie Aktivitätenprotokolle, Regen- und Frostschutz, Roboterstimme und einiges mehr.
Im Kartenmenü zeigt sich die Erfahrung des Herstellers mit Saugrobotern. Bei Dreames „Erstlingswerk“ sind zahllose Features zum Anlegen von Zonen, Verbotszonen und Pfaden implementiert, so viel gibt es bei der Konkurrenz meist nicht. So dürfen Nogo-Zonen nicht nur wie gewohnt mit dem Roboter abgefahren, sondern wahlweise auch in der App eingezeichnet werden, wobei Nutzer Linien, Rechtecke oder Kreise verwenden können. Pfade verbinden Zonen untereinander oder die Ladestation mit einer Zone – sie darf also auch außerhalb stehen. Die Schnitthöhe darf der Nutzer pro Zone oder global zwischen 30 und 70 mm wählen, die Ausrichtung der Mähbahnen frei bestimmen.
Was fehlt, ist eine Möglichkeit zum nachträglichen Ändern von bereits angelernten Zonen. Ein Problem, welches auch Ecovacs hat, die dieses Feature auch nach einem Jahr bei ihrem ersten Mähroboter Goat G1 (Testbericht) und selbst beim aktuellen Goat G1 800 (Testbericht) noch nicht nachgeliefert haben.
Dass auch Dreame noch nicht ganz fertig mit der Entwicklung ist, zeigt sich in der App zudem daran, dass aktuell gerade einmal zwei Zonen eingerichtet werden dürfen. Das ist einfach zu wenig. Außerdem sind einige Menüstrukturen etwas verschachtelt oder auf mehreren Wegen anwählbar, was auf den ersten Blick verwirrend ist.
Schick ist hingegen die 3D-Darstellung dessen, was der Roboter sieht. In einem Punktraster findet der Nutzer hier eine erstaunlich detaillierte Karte der Umgebung vor, auf der Gegenstände, Pflanzen, Bäume, Autos und wegen der großen Reichweite des Lidar-Systems auch schon mal Teile vom Nachbarhaus schematisch angezeigt werden. Der „Laser“ des A1 kommt nämlich bis zu 75 Meter weit und in einem Winkel von bis zu 59 Grad hoch. Die Karte ist flüssig zoom-, dreh- und bewegbar. Um auf sie zugreifen zu können, ist eine WLAN-Verbindung nötig. Eigentlich scheint sie mit jedem Abruf neu heruntergeladen zu werden, allerdings stellten wir im Test fest, dass immer nur die Teile angezeigt werden, die wir zuerst eingerichtet hatten. Nach dem Löschen einer großen Zone und dem Hinzufügen einer neuen auf der anderen Seite des Hauses blieb diese allerdings schwarz – obwohl der Mäher dort erfolgreich mäht. So faszinierend die 3D-Karte schon jetzt ist, hat Dreame wohl auch hier noch etwas Arbeit vor sich.
In den Einstellungen für Mäher und Mähzonen dürfen Dinge wie die Mäheffizienz oder die Mähhöhe angepasst werden. Im genauen Standard-Modus fährt der A1 überlappende Bahnen und lässt nichts aus, er mäht hier bis zu 120 m² pro Stunde. Im Effizienzmodus sinken Genauigkeit und Hinderniserkennung, dafür steigt die Mähleistung auf bis zu 200 m²/h. Einer der wichtigsten Punkte dürfte die Hinderniserkennung sein. Hier darf der Nutzer bestimmen, ob der Roboter generell berührungslos fahren soll und wie groß Hindernisse sein müssen, um erkannt werden zu können. Die App unterscheidet dabei zwischen ab 10, 15 und 20 Zentimeter Höhe. Je unebener oder höher der Rasen ist, desto häufiger werden mit abnehmender Höhe der zu erkennenden Objekte allerdings Fehlerkennungen. So kann es passieren, dass der Roboter einzelne Grasbüschel nicht mehr mäht oder in die Zone hängende Zweige und Blätter dafür sorgen, dass er darum herum statt darunter herfährt.
Da leider auch die minimalen 10 Zentimeter Höhe in den meisten Fällen nicht ausreichen dürften, um einen Igel als Hindernis zu erkennen, haben wir die Hinderniserkennung gleich ganz ausgestellt. Das sorgt dafür, dass der Roboter in den meisten Fällen trotzdem größere Hindernisse wie Wände oder Pflanzen ohne Kontaktaufnahme erkennt, gleichzeitig folgt er aber den eingangs angelernten Grenzen. Entsprechend mäht er dann auch unter hängende Vegetation. Das können kamerabasierte Systeme wie etwa die Bots von Ecovacs nicht und so ist das ein großer Vorteil des Dreame A1.
Wie lernt der Dreame A1 die Mähzonen?
Die Einrichtung der einzelnen Mähzonen klappt dank der guten Erklärungen und des überwiegend einfachen Aufbaus der App kinderleicht und letztlich wie beim Großteil der Konkurrenz. Der Nutzer muss dafür beim Anlernen den A1 wie ein RC-Auto mit dem Smartphone steuern und die Grenzen abfahren – fertig. Hinzu kommen bei mehreren Zonen noch Verbindungspfade. Das funktioniert ausreichend präzise – besser als beim Stiga A1500 (Testbericht), aber nicht ganz so einfach wie etwa beim Mammotion Luba (Testbericht). Ist eine Zone umrundet, dürfen zusätzlich Sperrflächen definiert werden, um etwa Beete oder einen Teich auszugrenzen. Dabei sollen mindestens 10 cm Abstand zu entsprechenden Hindernissen gehalten werden, bei starkem Gefälle oder höheren Hindernissen wie Mauern auch mehr.
Wie navigiert der Dreame A1 im Alltag?
Wir haben uns wie immer nicht an die Vorgaben gehalten, sondern ohne Blick ins Handbuch losgelegt – und sind grundsätzlich nicht enttäuscht worden. Zwar bezahlte unser Testgerät des Dreame A1 schon nach kurzer Zeit mit einer hässlichen Schramme von der unsachgemäßen Installation, die er sich an einer Wand zugezogen hatte. Das als Bumper konzipierte Chassis sorgt aber in solchen Ausnahmen dafür, dass der Roboter problemlos weiter mäht. Hier rächt sich dann allerdings das schicke Hochglanz-Chassis des „Silberpfeils“.
Davon abgesehen schlug sich der A1 bei der grundsätzlichen Navigation aber sehr gut, auch wenn es im Detail noch etwas Anpassungsbedarf gibt. So findet sich der Mähroboter stets sehr gut zurecht und navigiert daher auch in Umgebungen, in denen RTK/GPS-basierte Modelle längst aufgeben. Wir haben ihn etwa dem Härtetest rechts neben dem Haus unterzogen, wo selbst die besten GPS-Mäher wie Mammotion Luba (Testbericht) und Stiga A1500 (Testbericht) immer wieder mit Problemen zu kämpfen hatten. Außerdem haben wir zwei Zonen per Pfad zwischen zwei Gebäudeteilen hindurch verbunden. Spätestens hier hätte sich jeder GPS-Mäher geweigert und die Arbeit eingestellt. Nicht so der A1, der nach dem ersten Anlernen fortan stoisch dem einmal angeeigneten Weg folgte und auch die beiden Problemzonen ohne Einschränkung mähte.
Es wurde bereits angedeutet: Ganz rund läuft trotzdem nicht alles beim A1. Zwar passt für uns die grundsätzliche Navigation schon sehr gut und auch die Genauigkeit, die der Hersteller mit bis zu 1 cm angibt, scheint meist erreicht zu werden. Gerade in Verbindung mit der anpassbaren Hinderniserkennung, die im Abschnitt "App" beschrieben wurde, mäht der Roboter nach der Fläche dann auch direkt an der Begrenzung – und das bei entsprechender Einstellung auch unter Büschen. Bei GPS-Mähern steigt hier die Abweichung, Kamera-Mäher wollen sich erst gar nicht in die Büsche schlagen.
Auffällig ist allerdings, dass der A1 – egal ob manuell per Fernbedienung gesteuert oder automatisch fahrend – immer wieder für den Bruchteil einer Sekunde abrupt stehenbleibt und dann direkt ohne Richtungswechsel weiterfährt. Das hatte im Test auch der sehr gute Segway Navimow (Testbericht) gemacht. Außerdem wirkt er – vor allem bei aktivierter Hinderniserkennung – bisweilen recht unstrukturiert. Dann wird mal hier, mal dorthin gedreht, ein Bogen gefahren oder sonst wie versucht, mit dem Störfaktor klarzukommen. Das funktionierte letztlich immer, wirkt aber noch sehr chaotisch und kostet Zeit. Denn gemäht wird bei solchen Kapriolen auch nicht, wohl aus Sicherheitsgründen. Zudem schien sich der A1 bei schwindendem Licht zunehmend schwer zu tun, obwohl er dank Lidar eigentlich lichtunabhängig navigieren sollte. Da Mähroboter bei Dämmerung oder Nacht aus Tierschutzgründen ohnehin nicht fahren sollen, finden wir das aber auch nicht schlimm.
Wie gut mäht der Dreame A1?
Dank der systematischen (und in der Ausrichtung frei wählbaren) Bahnennavigation schafft der Dreame A1 pro Tag etwa 1000 m² Rasenfläche. Die versprochenen 2000 m² beziehen sich also auf 2 Tage – oder der Nutzer stellt die Mäeffizienz in der App von „Standard“ auf „Effizient“ um. Die angegebenen Rasenflächen erreicht er wie die Konkurrenz, indem er mäht, anschließend zur Ladestation zurückkehrt, lädt und nach rund 1 Stunde wieder seine Arbeit fortsetzt. Das Schnittbild ist dabei auf großen Flächen ordentlich, auch wenn es an Modelle wie den richtig guten Stiga A1500 (Testbericht) nicht ganz herankommt.
Wird es enger und der A1 muss viel rangieren, macht sich das langgezogene Chassis negativ bemerkbar. Gerade dann, wenn der Rasen eher holperig ist und nicht einem englischen Wimbledon-Grün entspricht, bleibt der Mäher bei Wendemanövern immer wieder kurz mit den vorderen, ungelenkten Rädern hängen. Das führt dann immer wieder kurzzeitig zu durchdrehenden Rädern, denn die Kraft, die der Bot benötigt, um den langen Vorbau herumzuschwenken, ist einfach höher als bei einem kompakten Modell. Das macht sich auch an Hängen bemerkbar. Muss er sie nur gerade hinauf oder hinunterfahren, gibt es bis zur Herstellerangabe von 45 Prozent oder 24 Grad keine Probleme. Soll am Hang gewendet werden, rutscht der Roboter aber immer wieder ab. Das machen Stiga und Mammotion besser.
Diese Probleme führt dann schnell dazu, dass die Haupträder kurz durchdrehen und besonders nassen Rasen leicht beschädigen. Besonders stark sieht man das vor der Ladestation. Da der A1 vor Mähbeginn immer gleich weit aus der Station fährt und sich anschließend auf der Stelle drehend orientiert, blieb bei „gutem norddeutschem Testwetter“ schnell eine kreisrunde Spur zurück, an der die Grasnarbe zerstört war. Ein ähnliches Bild dürfte sich wegen der dauerhaften, punktuell hohen Belastung an dieser Stelle auch im Hochsommer bei entsprechend hohen Temperaturen ergeben. Auf normalem, trockenem Grund ist das hingegen ein untergeordnetes Problem.
Da die Ladestation nicht in oder an einer Mähzone positioniert werden muss, empfehlen wir die Platzierung auf der Terrasse mit mindestens 1,5 Meter Abstand zum Rasen. Alternativ wäre es schön, wenn Dreame hier schnell nachbessern würde, indem etwa die Strecke beim Heraussetzen aus der Station variiert wird. Um solche Spuren zu vermeiden, bietet die App an anderer Stelle bereits solche Vermeidungsstrategien. So gibt es eine Option, dass der Roboter automatisch die Mähbahnen nach jedem Durchgang um 5 Grad versetzt.
Funktioniert der Dreame A1 immer gut?
Zum Schluss ein Gedanke, den wir wegen der typischen, vergleichsweise kurzen Testphase des A1 bislang nicht verifizieren konnten. Saugroboter, die im Haus mit Lidar navigieren, treffen zwar bisweilen auf leicht veränderte Umgebungen, da etwa hier ein Stuhl anders steht oder dort plötzlich ein Spielzeug auf dem Boden liegt. Dennoch bleiben einige Dinge wie Wände oder größere Möbel normalerweise unverändert und dienen dem Bot somit als fixe Referenzpunkte.
Bei einem Mähroboter ist das anders. Zwar gibt es auch hier etwa das Haus als festen Bezugspunkt, andere Grenzen wie etwa Büsche oder Bäume verändern sich im Laufe eines Jahres aber stark. So kann es schnell passieren, dass eine Hecke zwischen den Schnitten um 20 cm wächst – auch nach innen in die Rasenfläche. Das gilt noch viel mehr bei sonstigen Büschen, die wie in unserem Testgarten als Eingrenzung dienen. Wir sind gespannt, wie der Dreame A1 mit diesen Veränderungen im Laufe des Jahres klarkommt. Denn theoretisch könnte das zu einer Ungenauigkeit führen, die weit über die angegebenen 10 mm hinausgeht.
Preis
Die UVP für den Dreame A1 beläuft sich auf 1999 Euro, eine andere Farbe als Silber gibt es nicht. Unter anderem kostet der A1 bei Amazon 1999 Euro.
Fazit
Wer sich mit dem Thema „Mähroboter ohne Begrenzungsdraht“ beschäftigt, wird sich entweder auf den A1 mit Lidar gefreut, oder seine ordentliche Funktion bezweifelt haben. Wir lagen vor dem Test irgendwo dazwischen. Nach dem Test freut es uns aber, mit Fug und Recht sagen zu können, dass der Dreame A1 sehr wohl funktioniert. Und das sogar richtig gut. In unseren Augen ist er die bislang beste Lösung für alle, die einen sehr schwierigen Garten besitzen, in dem GPS-Mäher teilweise oder vielleicht sogar gar nicht funktionieren. Denn die einzige (eigentlich) gute Alternative dafür, die Goat-Modelle von Ecovacs, setzten auf Signalbaken am Boden, die allerdings nach Möglichkeit freien „Sichtkontakt“ verlangen und bei verwinkelten Gärten wegen der immer größeren benötigten Menge solcher Beacons schnell ins Geld gehen. Der Dreame A1 fühlt sich hingegen selbst zwischen meterhohen Wänden oder einem Carport-Dach wohl und auch großer Pflanzenwuchs stellt kein Problem dar.
Natürlich gibt es noch einige Baustellen, fast alle davon betreffen aber Software und sollten so nach und nach beseitigt werden können. Dass der Hersteller dazu die Motivation hat, zeigt er bei seinen Saugrobotern. Zu den Baustellen gehört das teils etwas ruppige Fahren, die starke Limitierung auf derzeit nur 2 Mähzonen und die „Kornkreise“ vor der Ladestation. Das in unseren Augen zu lange Chassis ist hingegen erst beim Nachfolgemodell zu beheben und darf dann gern auch zusätzlich über eine Möglichkeit zur Vermeidung von Flurschäden bei kleinen Tieren wie Igeln, Fröschen oder Schlangen verfügen. Bis dahin ist der A1 die bislang beste Möglichkeit, auch schwierige Rasenflächen ohne ausreichenden GPS-Empfang kabellos mähen zu lassen.
Segway Navimow H-Serie
ab 1159 EUR
Segway hat mit dem Navimow am längsten einen Mähroboter auf dem Markt, der ohne Begrenzungskabel auskommt. Das Alter ist aber vor allem Vor- statt Nachteil. Wir haben ihn getestet und erklären, was ihn zum besten Modell unter 3000 Euro macht.
VORTEILE
- sehr gute Navigation und Hinderniserkennung
- schnurgerade Bahnen, hohe Verlässlichkeit
- tolle App
- niedriger Preis (für einen GPS-Mäher)
NACHTEILE
- Randmähen wie bei allen RTK-Mähern ausbaufähig
Mähroboter Segway Navimow H im Test
Segway hat mit dem Navimow am längsten einen Mähroboter auf dem Markt, der ohne Begrenzungskabel auskommt. Das Alter ist aber vor allem Vor- statt Nachteil. Wir haben ihn getestet und erklären, was ihn zum besten Modell unter 3000 Euro macht.
Mähroboter, die ohne das lästige Begrenzungskabel auskommen – das klingt super. Schließlich nervt das Verlegen des Drahtes und ist zeit- und arbeitsaufwendig. Und wenn dann doch ein Fehler unterlaufen ist, muss das Kabel anders verlegt werden, mit etwas Pech sogar umständlich verlängert. Oder wenn man im nächsten Frühjahr feststellt, dass das Perimeterkabel beschädigt ist, geht die Suche nach der Nadel im Heuhaufen los – ätzend! Außerdem ist das mit dem Kabel generell einfach so 2010. Hilfe zu diesem Thema geben wir in unserem Ratgeber Zubehör für Mähroboter - von Rallystreifen bis Roboter-Garage.
Und so kommen aktuell immer mehr Geräte in den Handel, die sich nicht von Drähten leiten lassen, sondern von Signalen aus dem All. Wir haben uns bislang den Marotronics Alfred (Testbericht) angeschaut, der in 2022 noch viel Entwicklungspotenzial bot, außerdem den Ecovacs Goat G1 (Testbericht) mit toller App und Ladestation mit automatischen Reinigungsbürsten sowie den Ecoflow Blade (Testbericht) mit außergewöhnlichem Design und optionalem Laubsammler. Alle Geräte haben ihre Vor- und Nachteile, alle Geräte haben vor allem beim Funktionsumfang der Software oder der Umsetzung noch Nachholbedarf. Da hat Segway mit dem Navimow einen Vorteil, denn es steht nicht nur ein großes Unternehmen hinter dem Mäher, sondern da das Gerät schon etwas länger auf dem Markt ist, sind die meisten Kinderkrankheiten bereits behoben. Ganz ohne Probleme geht es aber auch hier leider nicht. Wir zeigen im Test, was der „Oldie“ bereits gut macht und wo es noch Verbesserungsbedarf gibt.
Design und Verarbeitung
Segway setzt auf eine auffällige Mischung aus dunkelgrauem und leuchtend-orangenem Farbdesign für die beiden größeren Modelle H1500E und H3000E. H500E und H800E haben schwarze statt orange Räder. Zusammen mit einer rundlichen Designsprache finden wir die Optik des Gerätes nicht ganz so hochwertig oder gar modern wie etwa bei Ecovacs Goat oder Ecoflow Blade. Bestenfalls geht die knuddelige Form als retro durch. An der Verarbeitung liegt der nicht ganz so hochwertige Look des Gerätes nicht, denn die ist so vorbildlich wie bei den anderen Modellen. Insgesamt ist der Navimow mit praktischem Tragegriff am Heck und auffälligem Zylinder an der Stelle, an der sich der 21 Zentimeter breite Mähteller mit drei Klingen befindet, gut verarbeitet und macht einen langlebigen Eindruck. Der Mähteller ist dabei nicht wie bei den meisten Modellen mittig, sondern nach rechts versetzt in den Mäher integriert, damit der Navimow auch nah an Hindernissen und Rasenkanten entlang mähen kann. Nur das leichte Knacken auf unebenem Rasen, das von den beiden Stützrädern vorn zu stammen scheint, passt nicht ganz dazu.
Neben dem Tragegriff finden wir auch das einfache Display praktisch, das im Betrieb etwa den prozentualen Fortschritt der Arbeit anzeigt. Die angrenzenden Folientasten helfen bei der Bedienung vor Ort und erlauben einfache Befehle auch ohne Smartphone und Navimow-App. In unmittelbarer Nähe befindet sich zudem eine rote Not-Stopp-Taste, um den Mäher bei Bedarf zum direkten Abbruch des Mähvorgangs zu zwingen. Ebenfalls hier zu finden: ein Regensensor. Der arbeitet gerne mit einem Zeitversatz von rund 10 Minuten, aber ist ansonsten zuverlässig. Der hintere Teil des Mähers ist frei von Bedienelementen, hier befindet sich unter anderem die RTK-Antenne (Real Time Kinematics - Echtzeitpositionierung). Eine mechanische Einstellung für die Mähhöhe wie etwa beim Ecovacs Goat G1 (Testbericht) gibt es nicht, stattdessen darf sie in der App zwischen 30 und 60 Millimeter in 5-Millimeter-Schritten bestimmt werden und ein Motor passt die Höhe des Mähwerks dann umgehend an. Hinten stehen die orangenfarbigen, vergleichsweise weichen Gummiräder mit deutlichem Stollenprofil nur dezent aus dem Gehäuse hervor – kein Vergleich zum ausladenden Ecoflow Blade (Testbericht).
Die Kamera, die vorn mittig auf der Oberseite des Gerätes positioniert ist, ist nachträglich installiert, wirkt aber nicht wie ein Störfaktor. Während dort bislang (nur beim größten Modell H3000E inbegriffen) optional erhältliche Ultraschallsensoren installiert werden konnten, hat Segway für den Navimow inzwischen eine Vision Fence Sensor genannte Kamera im Angebot, die bessere Navigation inklusive intelligenter Hinderniserkennung bieten soll. Wir haben das gleich mitgetestet. Die Ladestation ist eher unspektakulär. Auffälligstes Merkmal: Der Mäher fährt auf eine weitgehend geschlossene Platte auf, auf der sich gern Regen sammelt. Bei der Konkurrenz sind das normalerweise eher Gitter. Ansonsten ist noch das runde Segway-Logo hervorzuheben, das je nach GPS-Empfang der Station in rot, gelb oder blau leuchtet. Beim Laden des Roboters ist die Farbe Grün.
Inbetriebnahme mit der App
Die Inbetriebnahme des Segway Navimow geschieht anfangs am Gerät selbst, etwa, wenn der ab Werk eingestellte PIN-Code (0000) eingegeben werden muss. Anschließend geht es direkt in die Navimow-App, die kostenlos für iOS und Android erhältlich ist. Ab dann wird der Nutzer vorbildlich an die Hand genommen, der den Mähroboter anhand von Bildern, Texten und animierten Videos Schritt für Schritt einrichtet. Das ist grundsätzlich gut gelöst und lässt keine Fragen offen, auch wenn man zuvor keinen App-gesteuerten Rasenroboter hatte. Etwas nervig, aber aus Herstellersicht verständlich ist der Umstand, dass man bei der ersten Installation das mehrere Minuten andauernde Installationsvideo nicht überspringen darf. Noch dazu zeigt die App Teile des Videos später – erneut beim ersten Mal nicht überspringbar – noch einmal gezeigt, etwa wenn es daran geht, Mähbereiche auszuschließen und Korridore zwischen Mähzonen anzulegen. So sollte wirklich jeder Nutzer genau wissen, wie er den Navimow zu bedienen hat – sofern er nicht genervt das Handy beiseitegelegt hat, bis das Video vorbei ist.
Festlegen der Mähfläche
Dem Segway Navimow die Mähfläche beizubringen, ist genauso einfach wie bei den anderen Herstellern: Einfach die Ränder der Fläche im Lernmodus (bei Segway im Querformat) abfahren und sobald man wieder am Ausgangspunkt angekommen ist, berechnet die App daraus eine Fläche. Anschließend zeigt sie dem Nutzer das errechnete Grün noch einmal an und färbt die zuvor abgefahrenen Ränder anhand der Signalstärke des RTK (Real Time Kinematic) ein: Optimal ist grün für sehr guten GPS-Empfang und gelb zeigt hingegen schon, dass die empfangenen Signale beim Erstellen nicht immer ausreichend waren. Ein schlechteres Signal hatten wir während des Tests nicht, doch auch bei Gelb zieht schon Probleme mit der Mähgenauigkeit nach sich. Zwar versucht der Navimow wie alle anderen RTK-Mäher, unzulängliche GPS-Signale bis zu einem gewissen Grad per Odometrie, also dem Schätzen der zurückgelegten Strecke per Radumdrehungen, auszugleichen, aber das klappt deutlich ungenauer als mit einem guten GPS-Signal. Schön: Beim Erstellen einer Mähzone sieht man schon an der gezogenen Linie, die die App bei Bewegung des Mähers erstellt, wie gut das tatsächliche GPS-Signal ist. Mit schwächer werdendem Signal erscheint sie immer krakeliger.
Ein weiteres Hilfsmittel: Ein LED-Band rings um den Zylinder, in dem sich das Mähwerk des Roboters befindet, leuchtet je nach Empfangsqualität in den gleichen Farben wie die Station. Beim Anlernen neuer Mähflächen sollte also immer ein durchgehend blaues LED-Band zu sehen sein. Das setzt voraus, dass Ladestation und die im Lieferumfang enthaltene Antenne gute Sicht in den Himmel haben – das ist bei allen RTK-Mähern so, nur bei Ecovacs ist das wegen der verwendeten Beacons anders. Beim Navimow ist übrigens das Kabel für die RTK-Antenne so kurz, dass sie mittels der drei Erdspieße nur direkt an die Station gestellt werden kann. Wer eine andere Installation wünscht, muss auf ein Verlängerungskabel zurückgreifen. Probleme mit dem Empfang hatten wir deshalb aber nicht.
Navimow-App
Die Navimow-App von Segway gefällt uns richtig gut – sie ist einfach und übersichtlich sowie umfangreich zugleich. Der Hauptbildschirm zeigt zentral die Mähkarte, darunter einen Hinweis auf den derzeitigen Status des Mähers sowie Angaben zu Mähfortschritt in Quadratmetern und Prozent sowie Angaben zu Verbindungsqualität von Mobilfunk/Wlan, Bluetooth, Akkustand und virtuelle Buttons zum Starten/Stoppen sowie für die Rückkehr zur Ladestation. Alle Einstellungsmöglichkeiten finden sich übersichtlich im Menü, das oben links über einen speziellen Button erreicht wird. Oben rechts gibts abschließend noch Zugang zu den Informationen, die der Navimow an den Nutzer weitergibt, etwa Infos zur Rückkehr zur Ladestation oder Fehlermeldungen.
Das Menü ist aufgeteilt in einen Bereich für den Mäher und den für die meisten Nutzer weniger interessanten Bereich für die App, wo auch Kontodaten zu finden sind. Für den Mäher gibt es alles, was das Herz begehren könnte, übersichtlich untereinander aufgelistet. Verschachtelte Menüs? Fehlanzeige. Neben einem Punkt für zeitgesteuerte Mähpläne und der Einstellung der Mähhöhe gibt es typische Optionen, etwa für den Regensensor. Außerdem finden sich hier die PIN-Code-Einstellungen und es gibt sogar einen Nachtmodus für die LED-Beleuchtung von Mäher und Ladestation. Damit sollte der Garten nachts nicht wie eine Disko aussehen – wenn der Modus funktionieren würde. Bei uns klappte das leider nicht – egal, ob wir ihn manuell an- und ausmachten oder die Zeitsteuerung dafür verwendeten.
Der wichtigste Punkt dürfte aber die Kartenverwaltung sein – und hier schlägt die Sternstunde des Navimow. Denn im Gegensatz zu allen anderen von uns getesteten Mährobotern ohne Begrenzungsdraht (außer dem Marotronics Alfred im Test!) ### erlaubt der Navimow nicht nur das Hinzufügen weiterer Mähbereiche, sondern auch das Anpassen bestehender. Bedeutet im Klartext: Wer bei Ecovacs oder Ecoflow einen Fehler bei der Kartenerstellung macht oder später feststellt, dass der Roboter sich immer wieder an einer bestimmten Stelle festfährt, muss die komplette Karte neu anlernen. Das kostet bei Rasenflächen jenseits der 50 m² Zeit und Nerven – und ist ohne Garantie, dass der Nutzer dabei nicht an anderer Stelle erneut einen Fehler macht. Bei Marotronics Alfred (Testbericht) und eben dem Segway Navimow ist das anders, hier können Fehler einfach korrigiert werden. Wenn sich etwa an einer bestimmten Stelle der Roboter immer wieder festfährt, kann der Nutzer in der Navimow-App einfach eine bestimmte Stelle der Grenzlinie neu abfahren und ersetzt damit die alte Grenze an dieser Stelle – so muss das sein!
Außerdem bietet der Segway-Roboter die Möglichkeit, mehrere Mähzonen anzulegen. Anschließend ist es möglich, die per virtuellem Korridor miteinander zu verbinden – ein weiterer großer Vorteil von RTK-Mähern, denn das klappt auch bei größeren Abständen als nur für die Überquerung eines schmalen Gartenwegs einfach und zuverlässig. Gleiches gilt für das Hinzufügen und Löschen von Mähzonen und Ausgrenzungen von Bereichen wie Beeten. Was fehlt, ist die Möglichkeit, die Ausrichtungen der Mähbahnen selbst bestimmen zu können. Stattdessen wählt der Navimow diese selbst und verwendet dabei scheinbar immer 90-Grad-Schritte in Relation zur Ladestation. In unserem Fall passte das bei der Hauptfläche sehr gut, eine kleine Nebenfläche hingegen hat er um 90 Grad dazu versetzt gemäht. Damit sich bei täglicher Nutzung keine Fahrspuren im Gras bilden, verwendet der Bot laut Hersteller ein automatisches Mähpfad-Optimierungssystem – wie das genau aussieht, verrät er nicht. Fest eingefahrene Spuren konnten wir im Test aber nicht feststellen.
Navigation und Arbeitsalltag
Die Einrichtung ist einfach und dank Anpassbarkeit einer bestehenden Mähkarte auch dauerhaft praktisch. Sollte der Nutzer im Laufe der Zeit feststellen, dass sich der Mäher immer an einer bestimmten Stelle festfährt, lässt sich die Karte anpassen. Gleiches gilt für den Fall einer Umstrukturierung des Gartens: neues Beet? Kein Problem. Mehr oder weniger Rasenfläche als zuvor? Problemlos anpassbar! Von solchen Änderungen abgesehen sollte das aber nicht vorkommen, wenn man sich an die Installationshinweise des Herstellers hält. Der rät 15 Zentimeter Abstand zum Rand und zu Hindernissen, im Lieferkarton liegt extra ein entsprechendes Zentimetermaß zum Aufkleben auf das Chassis des Navimow bei. Später zieht der Bot leicht überlappende, parallele Bahnen, die nach getaner Arbeit gut zu sehen sind und einen ständig gepflegten Eindruck des Grüns vermitteln. Hindernisse erkennt der Navimow selbständig, etwa einen Rasensprenger samt Gartenschlauch, der während des Tests auf dem Rasen vergessen wurde. Das gilt außerdem für Menschen und bestimmte Kleintiere sowie etwa Steinwege. Laut Hersteller lernt die KI der Kamera mittels Machine Learning (Vision Fence Sensor) wie bei der Konkurrenz zudem ständig dazu.
Auffällig sind beim Segway Navimow eine vom Fahrverhalten der Konkurrenz abweichende Navigation und die besonders niedrige Lautstärke. Letztere gehört zum niedrigsten aller derzeit getesteten Modelle, vor allem leiser als Ecovacs Goat G1 (Testbericht) und Ecoflow Blade (Testbericht), die in den entsprechend „leisen“ Einstellungen aber auch nicht übermäßig laut sind. Beim Navimow ist aber das leise Geräusch der abrasierten Grashalme fast schon lauter als Fahr- und Mähmotoren – das ist extrem leise. Schon in wenigen Metern Entfernung zum Mäher ist so gut wie nichts mehr zu hören. Die andere Auffälligkeit betrifft die Fahrweise. Die verläuft grundsätzlich ähnlich wie bei der Konkurrenz, allerdings baut Segway bei jedem Umdrehen für die nächste Bahn ein kleines Zurücksetzen ein – das gibt es bei den Wettbewerbern nicht. Außerdem verwendet der Navimow auch abseits der geraden Bahnen gerne mal den Rückwärtsgang. Das passiert etwa dann, wenn der Roboter am Rand mittels der Kamera zu erkennen glaubt, dass die in den Mähbereich ragende Vegetation umfahren werden müsste. Dann passiert eben dies – zuverlässig und sicher – und am Ende drängt sich der Navimow geradezu rückwärts wieder unter das Gebüsch, um so wieder bis zur Grenzlinie zu kommen. Alle anderen von uns bislang getesteten Mäher fahren ausschließlich vorwärts.
Generell ist übrigens in die Mähfläche ragendes Blattwerk kaum ein Problem. Im Gegensatz zum Ecovacs Goat, der zum Testzeitpunkt selbst dünne Zweige als festes Hindernis interpretierte, lässt sich der Navimow von so etwas eher wenig beeindrucken. Im Alltag ist der Segway-Mäher dadurch auch deutlich praxistauglicher. Sollte hereinragendes Gestrüpp doch mal ein Problem sein, lassen sich dank des jüngsten Updates Bereiche der Karte benennen, in denen der Roboter auf die Kamera als Navigationshilfe verzichtet. Ganz ausschalten kann man sie in der App natürlich auch, aber das klingt wenig sinnvoll. Übrigens: Den Mäher mithilfe der Kamera manuell steuern oder überhaupt ein Live-Bild vom Roboter aufs Handy bekommen, klappt beim Navimow nicht. Datenschützer freut's.
Bei der Navigation fallen außerdem aber auch noch andere Sachverhalte auf. So kommt es immer wieder vor, dass der Mäher ohne erkennbaren Grund kurz anhält und nach einer halben Sekunde direkt wieder weiterfährt. Das ist nach Rücksprache mit dem Generalimporteur des Navimow in Deutschland ein bekannter Fehler, den kommende Updates beheben sollen. Das geschieht beim Navimow übrigens ausschließlich OTA (Over the Air), also kabellos. Andere Anbieter ermöglichen das zusätzlich auch per USB-Anschluss.
Und noch etwas ist auffällig: Der Navimow kann eigentlich sanfte Kurven fahren, zumindest klappt das beim Anlernen der Mähfläche problemlos. Im späteren Betrieb hingegen fährt er immer nur gerade Linien, bleibt dann stehen, korrigiert die Fahrtrichtung auf der Stelle und setzt dann seinen Weg fort. Das wirkt etwas hakelig und ungelenk, soll sich aber ebenfalls mit kommenden Updates bessern. Und noch eine Auffälligkeit: Im Betrieb kann es immer mal wieder vorkommen, dass der Navimow kurz das Mähwerk stoppt. Meist setzt er seinen Weg direkt mit wieder anlaufendem Mähteller fort, bisweilen legt er aber auch mal einen Meter oder mehr ohne aktives Mähwerk fort. Auch hier sollte (und dürfte) der Hersteller noch einmal Hand anlegen.
Nicht zuletzt fiel uns (und wohl auch der Community des Navimow) auf, dass der Rasenroboter wenig hilfreich nur durch Töne statt per Sprache kommuniziert. So gibt es immer mal wieder Piepgeräusche oder den Sound eines startenden Motors statt aussagekräftiger Worte. Ohne Blick auf das Smartphone weiß man daher oft nicht, was der Navimow will. Auch hier arbeitet der Hersteller aber offenbar an einer Lösung. Das gilt nicht zuletzt auch für ein anderes fehlendes Feature. So gibt es zwar eine Zeitplanung, die täglich sogar zwei Fahrtzeiten erlaubt, allerdings dürfen bislang keine einzelnen Zonen gezielt angefahren werden und auch die elektronisch verstellbare Mähhöhe lässt sich nicht in Abhängigkeit der Zonen bestimmen. Das soll – ebenso wie eine Benennungsmöglichkeit der einzelnen Zonen – ebenfalls bald kommen. Mit Ende Mai gibt es hier sogar ein halbwegs konkretes Datum. Dann dürfte auch der kleine Darstellungsfehler in der App, der es bisweilen so aussehen lässt, als hätte der Bot einzelne Bahnen ausgelassen, behoben sein.
Eine andere Sache, die Segway ebenfalls noch einmal überarbeiten könnte: Der Navimow hat sich zwar in unserem Test zu keinem Zeitpunkt eingegraben, kurz durchdrehende Räder sind ihm aber dennoch nicht fremd. Das geschah auch auf trockenem Rasen und vor allem an Gefällen – obwohl der Mäher bis zu 45 Prozent Steigungen bewältigen können soll. Hier sind wir etwas skeptisch, zumal unser Testrasen kaum Steigung aufweist. Übrigens: Vor dem Mähen der Fläche steht für den Navimow immer erst der Randschnitt.
Und wie steht es um die Verbindungqualität des Navimow? Insgesamt sehr gut – das gilt sowohl für die Verbindung zwischen Mäher und App als auch für die Verbindungsstabilität zu den GPS-Satelliten. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt dabei je nach Modell per Bluetooth, WLAN und/oder eSIM. WLAN hat dabei nur das kleinste Modell H500E, eine eSIM alle anderen. Die eSIM ist bei den mittleren Modellen H800E und H1500E 1 Jahr kostenfrei nutzbar, beim H3000E sind es 3 Jahre. Danach soll eine Verlängerung des Dienstes rund 30 Euro im Jahr kosten. Ein weiterer Betrieb ist auch ohne aktivierte eSIM möglich, allerdings verlieren Nutzer dann die Möglichkeit, ein gestohlenes Gerät zu orten. Außerdem verbleibt für die Kommunikation dann nur das wenig weitreichende Bluetooth. Schade, dass Segway nicht in alle Modelle WLAN einbaut.
Unser Testgelände weist etliche Bereiche auf, in denen die Mäher unter dichtes Laubwerk fahren, was eine Herausforderung für RTK-Mäher ist. Hier zeigte sich der Navimow von seiner besten Seite. Er kapitulierte – zumindest teilweise – erst in der schwierigsten Zone, einem schmalen Rasenstreifen zwischen Haus und meterhohen Büschen. Hier quittierten außer dem Ecovacs Goat G1 (Testbericht) alle RTK-Mäher bislang den Dienst ganz oder setzten ihn nur mit deutlichen Einbußen bei der Genauigkeit fort. Das Ecovacs-Modell arbeitet mit auf im Boden platzierten Funksendern zur Bestimmung der exakten Position, nicht nur per GPS. Dafür schlug sich der Navimow sogar noch recht gut, generell ist das aber ohnehin kein Problem, das dem Segway-Modell besonders angelastet werden dürfte. Es betrifft alle RTK-Geräte, denen die freie Sicht in den Himmel verwehrt wird.
Der Akku unterscheidet sich je nach Modell des Navimow. Er leistet in den kleinsten Modellen 5,2 Ah, für das 1500er und 3000er-Gerät sind es 7,8 und 10,4 Ah. Unser H1500E-Testgerät schaffte mit einer Akkuladung etwa 300 m² und fuhr dann zum Nachladen zur Station zurück. Später setzt der Navimow seine Arbeit automatisch an der letzten Stelle fort. Im Sommer dürften 1000 m² reine Rasenfläche bei gutem Tageslicht und ohne Gefährdung dämmerungs- und nachtaktiver Tiere pro Tag gut drin sein. Wer den Vision Fence Sensor aka Kamera nutzt, kann übrigens eine Option in den Einstellungen aktivieren, die den Mäher automatisch bei zu schwachem Licht in die Station zurückschickt. So sollte also genügend Schutz für Tiere geboten sein, selbst wenn die eigentliche Mähzeit – etwa im Frühling oder Herbst – in die Nachtzeit hereinragen würde.
Preis
Segway bietet vier Versionen des Navimow an: H500E, H800E, H1500E und H3000E. Die Geräte unterscheiden sich geringfügig in der Ausstattung und sind für die im Namen enthaltenen Quadratmeterzahlen gedacht. Der Preis lag zum Testzeitpunkt zwischen 1499 und 2699 Euro. Das Testgerät wurde uns von der Firma Herkules Garten zur Verfügung gestellt.
Fazit
Gerade der Teil über die kleinen Bugs klingt fast so, als sei die Software des Segway Navimow eine einzige Baustelle – dem ist definitiv nicht so. Stattdessen bietet der Segway Navimow das zum jetzigen Zeitpunkt rundeste Gesamtpaket, das in erster Linie einige Schönheitsfehler aufweist, trotzdem aber voll alltagstauglich ist. Die kleinen Bugs zu beheben, sollte für den Hersteller kein Problem darstellen – zumal etwa mit der Möglichkeit, die Mähkarte nachträglich zu editieren, die größte Schwierigkeit aller Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht bereits gelöst wurde. Unterm Strich bietet der Segway Navimow mit leisem Betrieb, je nach Modell großer Flächenleistung und toller Software sowie Navigation aktuell die Spitze unter den Mähern unter 3000 Euro.
Einen guten und dafür erstaunlich günstigen Ansatz hat Ecovacs mit dem Goat G1 (Testbericht) gezeigt, allerdings fehlen hier noch wichtige Software-Features. Mehr Features, aber ein nicht ganz so rundes Paket ergab zumindest im vergangenen Jahr der Marotornics Alfred (Testbericht), wir werden den Artikel bald aktualisieren. Wesentlich teurer, dafür mit Laubsammelfunktion und futuristischem Design will der Ecoflow Blade (Testbericht) punkten, ist aber auch noch längst nicht auf einem Level mit dem Navimow. Generelle Informationen zum Thema haben wir in unsrem Ratgeber Mähroboter ohne Begrenzungskabel zusammengetragen. In unserer Bestenliste der kabellosen Mähroboter vergleichen wir die bislang von uns getesteten Roboter ohne Perimeterdraht untereinander.
Roboup T1200 Pro
ab 1649 EUR
Der Mähroboter ohne Begrenzungskabel Roboup T1200 Pro löst in der zweiten Generation den Vorgänger ab, der mit Verbindungs- und Akkuproblemen zu kämpfen hatte. Wir klären im Test, wie gut die 2024er-Modelle sind.
VORTEILE
- mäht ohne Begrenzungsdraht und normalerweise strukturiert
- ordentlicher Empfang, unterstützt von Kameras
- tolle Objekterkennung
- viel Mähfläche und Technik fürs Geld
- übersichtliche App
- autonomes Anlernen von (einfachen) Mähzonen
NACHTEILE
- der App fehlt Feintuning
- Mähzonen nicht korrigierbar
- manchmal seltsame „Aussetzer“ beim Mähen
- Roboter ignoriert genau manuell angelernte Grenzen zugunsten seiner KI
Mähroboter Roboup T1200 Pro im Test: Günstig wie Segway, gut wie Ecovacs
Der Mähroboter ohne Begrenzungskabel Roboup T1200 Pro löst in der zweiten Generation den Vorgänger ab, der mit Verbindungs- und Akkuproblemen zu kämpfen hatte. Wir klären im Test, wie gut die 2024er-Modelle sind.
Mammotion ist ein Start-up, das aus dem Nichts zwei tolle Mähroboter ohne Begrenzungskabel auf den Markt gebracht hat, nämlich den Luba (Testbericht) und den Luba 2 (Testbericht). Andere Start-ups wie Eeve sind mit ihrem Willow nicht so erfolgreich, sondern es gibt eher Probleme und gebrochene Versprechen – sofern Startup-Produkte überhaupt auf den Markt kommen. Da wundert es nicht, dass mancher Interessent bei unbekannten, neuen Anbietern skeptisch ist.
Ganz frei davon konnten auch wir uns nicht machen, als wir nach Problemen im vergangenen Jahr nun endlich den aktuellen Roboup T1200 Pro in Betrieb nahmen. Denn zuvor scheiterte ein Test an einer gebrochenen Frontachse (Transportschaden – passiert) und an anhaltenden Verbindungs- und GPS-Problemen (sollte nicht passieren), die uns an den Marotronics Alfred (Testbericht) erinnerten. Die Verbindungsprobleme scheint das junge Unternehmen Roboup, das seit 2016 besteht, in den Griff bekommen zu haben, an anderer Stelle gibt es aber noch Arbeit. Immerhin: Zwar lief unser Test des T1200 Pro nicht vollständig komplikationslos, allerdings letztlich erfolgreich. Was das genau bedeutet, erklären wir im Test.
Was sind die Highlights des Roboup T1200 Pro?
- Orientierung per GPS und Kamera
- Objekterkennung per Kamera
- Automatisches Mapping
- Moderater Preis für 1500 m² Mähfläche
Wie ist das Design des Roboup T1200 Pro?
Nach umgedrehten Modellen wie dem Segway Navimow i150E/i108E (Testbericht), bei dem die Antriebsachse vorn statt hinten liegt, dem „Silberpfeil“ Dreame A1 (Testbericht) und dem Rennwagen Mammotion Luba 2 (Testbericht) wirkt der Roboup T1200 Pro recht normal, beinahe langweilig. Er setzt auf große, Stollen-bewährte Hinterräder und versteckte Stützräder vorn und wortwörtlich Grau in Grau beim Chassis – von aufregendem Design kann man hier nicht unbedingt sprechen. Hässlich ist das T-Modell aber auch nicht und an der Verarbeitung gibt es von unserer Seite aus nichts zu meckern.
Spannend sind die beiden „Nebelscheinwerfer“ ganz tief unten in der Frontschürze, die leider kein Bumper ist. Mit den Scheinwerfern kann der Roboter theoretisch auch nachts seinen Weg ausleuchten – wie immer aber an dieser Stelle der Hinweis, dass nachts und in der Dämmerung Mähroboter nicht fahren sollten, um dämmerungs- und nachtaktive Tiere nicht zu gefährden. Mittig vorn platziert der Hersteller zwei Kameras. Mit der einen erkennt und identifiziert der Roboup T1200 Pro Hindernisse, um sie zu umfahren, bei der anderen handelt es sich um eine sogenannte VSLAM-Kamera (Visual Simultanious Localization and Mapping). Damit orientiert sich der Bot zusätzlich zu den GPS-Signalen im Raum.
Vorn, aber nach rechts blickend, sitzt zudem ein Ultraschallsensor, der Hindernisse neben dem Mäher erkennt. Darunter prangt ein auffällig gelber Gefahrenaufkleber über einer kleinen Ausbuchtung an der tiefsitzenden Seitenschürze. Darunter verbirgt sich die nach rechts versetzte Mähscheibe mit den Mähklingen. Durch den Versatz soll der T1200 Pro besonders gut Ränder mähen können. Oben gibt es ein kleines LCD samt Folientasten, mittels derer der Roboter auch ohne App direkt am Gerät gesteuert werden kann. Dahinter installiert Roboup die obligatorische rote Stopp-Taste für Notfälle. Spannend: Vorn oben auf dem Gerät gibt es so etwas wie eine Abdeckung, die wirkt, als sei hier Platz für andere Sensoren gewesen. Allerdings war das auch schon beim roten Vorgänger aus dem vergangenen Jahr so, eventuelle zusätzliche Sensorik hat es offensichtlich nicht in die Serienversion geschafft.
Wie einfach lässt sich der Roboup T1200 Pro in Betrieb nehmen?
Dem großen Karton, der den Käufer erreicht, ist neben Roboter, Basisstation und GPS-Antenne auch ein Handbuch beigelegt. Das wird aber eigentlich nicht benötigt, denn die App erklärt vom Aufbau von Station und Roboter bis hin zur Verbindungsaufnahme jeden Schritt helfend in Bild und Text. Im Gegensatz zum roten Vorgängermodell aus 2023 gibt es jetzt eine externe GPS-Antenne, entsprechend liegt sowohl ein dreiteiliger Antennenmast sowie ein 10-m-Verlängerungskabel bei. Das ist einer der Gründe, warum die Verbindungsprobleme des Vorgängers passé sind. Im vergangenen Jahr war das RTK-Modul noch in der Basisstation eingebaut, konnte auf Wunsch aber abgeschraubt und extern aufgebaut werden.
Bei uns klappte die erste Verbindungsaufnahme per Bluetooth problemlos, die Eingabe des ab Werk auf 0000 stehenden PIN-Codes hätte sich der Hersteller aber sparen können. Er lässt sich zum Glück später problemlos in der App ändern – aber warum dann überhaupt ein Werks-Code? Schwieriger gestaltete sich da schon die Einrichtung des WLANs, wobei die schwankende Qualität des Test-WLANs sicherlich nicht gerade hilfreich war. Nachdem das nach drei Anläufen geschafft war, konnte es auch schon losgehen.
Nach ersten erfolgreichen Fahrten meldete die App allerdings plötzlich ein neues Update, das leider nicht optional war, sondern zwingend gefordert wurde. Allerdings wurde der Update-Vorgang direkt abgebrochen und dem Nutzer bleibt nur ein virtueller Button, mit dessen Hilfe er das Update beim Support anfordern kann. Denn ohne erfolgreiches Update verweigerte der Roboter fortan Zugang zur App, blieb aber per Tasten am Gerät selbst steuerbar – seltsam. Am kommenden Tag waren allerdings bereits eine Mail von Roboup im Postfach und das benötigte Update verfügbar. Nach zahllosen Fehlversuchen inklusive Rücksetzen des Roboters und Neustart des WLANs (was wir auch an dieser Stelle nicht als Fehlerquelle gänzlich ausschließen können), dauerte allerdings allein die Installation nach dem gefühlt ewig währenden Download auch locker 10 Minuten – das ist doch ziemlich lang. Danach klappte es dann doch noch und wir könnten den Mähroboter wieder per App befehligen. Eine Änderung durch die neue Firmware-Version konnten wir im Betrieb allerdings nicht ausmachen.
Wie gut ist die App des Roboup T1200 Pro?
Das nach rechts versetzte Schnittwerk sollte Kantenschnitt eigentlich perfekt machen – die App hindert den T1200 Pro aber daran | TechStage.de
Die App ist einfach gehalten und übersichtlich. Hat der Nutzer seinen Roboter ausgewählt, landet er auf der Übersichtsseite, deren beherrschendes Motiv die angelernte Mähkarte ist. Darauf sieht man die bis zu 10 Mäh- und 50 No-Go-Zonen, außerdem Verbindungswege dazwischen und grafisch dargestellt den Mähfortschritt. Darunter gibt es Informationen zur Verbindung per GPS, Bluetooth und WLAN, zudem die Akkuladung sowie eine kurze Statusmeldung in Textform. Weitere Angaben zeigen während des Mähens etwa die Größe der zu mähenden Fläche, die davon bereits gemähte Fläche und die dafür benötigte Zeit. Darunter befinden sich zwei große Buttons zur Aufnahme/Unterbrechung der Arbeit und zur Rückkehr zur Ladestation – alles schön übersichtlich.
Rechts platziert der Hersteller zudem zwei Karten-Icons – das eine führt zu Mäheinstellungen wie der Schnitthöhe, das andere zu Einstellungen zum neuen Anlernen von Mähbereichen. Eine Option zum Anpassen vorhandenen Zonen fehlt leider. Dafür gibt es Möglichkeiten, sogenannte „gefährliche Grenzen“ und To-Go-Zonen zu definieren. Im ersten Fall wird zu so einer Grenze mehr Abstand gehalten, To-Go-Zonen werden von KI- und Kamera ignoriert und der Mäher mäht dort ohne diese Hilfsmittel – mehr dazu später.
Im Hauptmenü, das der Nutzer über einen virtuellen Button oben rechts erreicht, ist es ebenfalls ziemlich übersichtlich. Hier reihen sich aufgelistet untereinander diverse Optionen auf, etwa (erneut) Mäheinstellungen wie die Schnitthöhe, die Ausrichtung der Mähbahnen und eine Option, ob die Bahnen immer in einer Linie verlaufen oder sinnvoll dem Verlauf der Mähfläche angepasst werden sollen. Was uns fehlt, ist eine Möglichkeit, die Randerkennung, die die Kamera immer vornimmt, zu beeinflussen – mehr dazu später. Außerdem vermissen wir mehr Einstellmöglichkeiten beim Mähen. So fährt der T1200 Pro immer erst die Fläche und dann zwingend die Ränder ab, das kann nicht beeinflusst werden. Überdies darf der Nutzer zwar den Winkel der Bahnen selbst bestimmen, einen Schachbrettschnitt erreicht er aber nur, wenn er an einem Tag längs mähen lässt und am nächsten quer.
Uns fehlt eine etwas filigranere Einstellmöglichkeit der Mähhöhe, sie arbeitet nur in Zentimeter-Schritten. Die Konkurrenz bietet 5-Millimeter-Schritte. Zudem finden wir die manuelle Steuerung viel zu hektisch – Geradeausfahren war beim Anlernen von Zonen besonders anfangs enorm schwierig im Vergleich zu Konkurrenzprodukten. Jede noch so kleine Bewegung der Finger auf dem Touchscreen des Smartphones wird direkt in (zu) starke Lenkbewegungen umgesetzt, präzises Abfahren von Grenzen ist dadurch sehr anstrengend und wird später im Alltag nicht mal gewürdigt – auch dazu später mehr. Das ist zwar gewöhnungsbedürftig, dramatisch ist das (bis auf die fehlende Korrekturmöglichkeit bestehender Flächen) insgesamt aber nicht.
Wie schlägt sich der Roboup T1200 Pro im Alltag?
Die gute Nachricht vorweg: Die Verbindungsprobleme des Vorgängers bestehen beim aktuellen T1200 Pro nicht mehr. Ungeplante Ausflüge ins Beet gab es nicht, der Roboter fährt parallele, überlappende Bahnen. Das Schnittbild sieht dabei ordentlich aus und es scheint auch nichts ausgelassen zu werden. Toll ist auch die Objekterkennung, die den Roboter in den meisten Fällen vor einer Kollision vor Hindernissen zum Stehen bringt. Wir haben das mit einer Igel-Attrappe und einem Gartenschlauch ausprobiert, beides hat der T1200 Pro wiederholt nicht überfahren. Die Verbindung von WLAN und Bluetooth scheint ebenfalls stärker als im Vorjahr zu sein. Nur unter Extrembedingungen bei sehr schlechter GPS-Abdeckung kommt das Modell in puncto Mähgenauigkeit nicht ganz an die Elite wie Luba 2 (Testbericht) oder Segway Navimow i105E/i108E heran.
Und trotzdem sind wir nicht so recht glücklich mit dem Roboup T1200 Pro und dafür gibt es mehrere Gründe. Einer davon ist das fast immer sehr strukturierte, bisweilen aber doch seltsam unkoordinierte Fahrverhalten des Mähers. So kommt es immer wieder vor, dass er dutzende Quadratmeter perfekt abfährt, dann aber plötzlich den Mähvorgang unterbricht, um an eine andere Stelle zu fahren. Dort mäht er dann einen Meter oder manchmal auch deutlich weniger, nur um erneut abzubrechen, zum vorherigen Punkt zurückzukehren und seine ursprüngliche Arbeit fortzusetzen. Das ist allerdings der harmloseste Kritikpunkt, denn er kostet nur etwas Akkuladung und Zeit.
Dank der neuen Antenne hat der Roboup T1200 Pro wesentlich besseren Empfang als der Vorgänger | TechStage.de
Störender fanden wir, dass der T1200 Pro bisweilen in Richtung der Mähgrenze zur nächsten Bahn abdreht und sich dann festfährt. Das passiert vorwiegend dann, wenn seine geplanten Mähbahnen sehr spitz auf eine Grenze zuführen. Normalerweise erkennt er die Nähe zu Grenzen, setzt ein Stück zurück und dreht von der Grenze weg. In unserem Fall passierte das beschriebene, falsche Abdrehen an einem Gartenweg, der einige Zentimeter tiefer durch den Rasen führt. Beim Drehen kamen immer wieder die beiden vorderen Stützräder vom Rasen ab und der Mäher fuhr sich fest. Zu allem Überfluss führte ein Klick in der App auf „Start“, von dem wir uns nach Eingabe des Pin-Codes ein Weitermähen erhofft hatten, zum Abbruch der Aufgabe und Neustart einer neuen – ärgerlich. Das Problem mit dieser Kante konnten wir allerdings mit der Definition der Wegkante als „gefährliche Grenze“ (s. Abschnitt App) lösen. Außerdem kam es im Test vor, dass der T1200 Pro beim Mähen oder Randschnitt einfach mit laufendem Mähwerk stehenblieb und dort bis zur völligen Erschöpfung verharrte. Resultat: Der Besitzer darf in tragender Funktion agieren …
Eine andere Sache störte uns im Betrieb des Roboup T1200 Pro aber eindeutig am meisten. Zum Anlernen neuer Mähflächen bietet das Gerät zwei Möglichkeiten: Eine automatische und eine manuelle. Die automatische funktioniert ganz passabel, solange der Garten klare Abgrenzungen von Rasen zu Beet bietet. Am Rand bleibt aber anschließend schon mal ein unterschiedlich breiter Streifen im (größtenteils) einstelligen Zentimeterbereich stehen, wie es bei aktuellen Modellen mit ähnlichen Funktionen üblich ist. Dafür (so denkt man) gibt es wie bei der Konkurrenz den manuellen Modus. Hier kann man beim Anlernen etwa hälftig auf der Terrasse und mit dem anderen Rad auf dem Rasen fahren und bei Bedarf auch unter Büschen mähen lassen. Oder? Falsch gedacht!
Der Roboup T1200 Pro ignoriert im späteren Alltagsbetrieb nämlich die vorherigen Anweisungen des Besitzers komplett und verlässt sich fast ausschließlich auf das, was er per Kamera erkennt. Bedeutet: Er fährt (so wie die meisten Kamera-Modelle) später nicht unter Büsche, obwohl die Grenze dort zuvor angelernt wurde. Und noch schlimmer: Er setzt seinen Dickkopf auch an Rasenkanten durch. Das zuvor angewiesene „halb-halb“ auf Terrasse und Rasen ignoriert der Mähroboter komplett, er bleibt penibel innerhalb des Grüns. Als Resultat kommt er zwar bis auf wenige Zentimeter bis an die Rasenkante, erwischt sie aber trotzdem nicht ganz, obwohl es dank der manuellen Einweisungsfahrt möglich wäre. Außerdem kürzt der Roboter quasi ab. 90-Grad-Ecken, etwa durch Gehwegplatten mit angrenzendem Gras, lässt der T1200 Pro aus, als ob das Grün durch Wände eingegrenzt wäre, an denen er sich keinesfalls sein graues Gehäuse zerkratzen will. Dadurch bleiben an entsprechenden Stellen viel zu große Bereiche ungemäht zurück.
Objekterkennung und Navigation sind dank der beiden eingebauten Kameras grundsätzlich sehr gut | TechStage.de
Und es gibt auch keine Eingriffsmöglichkeit für den Nutzer, um das alles zu verhindern. Bietet etwa ein Dreame A1 (Testbericht) zumindest durch angewiesenes Ignorieren von Hindernissen auf Distanz die Möglichkeit, doch „auf Kontakt“ mit dem Bumper und entsprechend unter Büschen zu mähen, werden solche oder ähnliche Nutzerwünsche beim Roboup-Modell komplett ignoriert. Dabei gibt es theoretisch eine entsprechende Funktion mit den bereits angesprochenen „To-Go-Zonen“. Damit können Bereiche definiert werden, in denen der Roboter seine KI-Kamera nicht zur Navigation verwendet. Denn so könnten etwa einzelne Trittplatten im Gras ignoriert und das Gras dazwischen trotz des „Dickkopfes“ des T1200 Pro gemäht werden. Allerdings wird wohl kaum ein Nutzer sich die Arbeit machen wollen und jede Grenze, an der der Mäher „Halb-halb“ fahren soll, manuell als To-Go-Zone zu definieren. Das bleibt der größte und schwerwiegendste Kritikpunkt, der viele der guten Ansätze (und Umsetzungen) des Modells für uns zunichtemachen. Schade.
Wie stark ist der Akku des Roboup T1200 Pro?
Der Vorgänger kränkelte neben der schwachen Verbindung zu den GPS-Satelliten auch an einem zu schwachen Akku. Dieses Problem wurde beim 2024er-Modell wie schon die Verbindungsprobleme behoben. Unser Testgerät mähte rund 2 Stunden am Stück, bevor es zum Laden etwa 3 oder 4 Stunden zur Station zurückkehren musste. Dabei schaffte es knapp 300 m² auf unserem Testrasen. Die angegeben 1500 m² sollte der Mäher innerhalb von 24 Stunden auch ohne nächtliches Mähen locker schaffen.
Preis: Was kostet der Roboup T1200 Pro?
Den Roboup T1200 Pro gibt es bei Amazon regulär für 1639 Euro. Der T600 für 800 m² Mähfläche ist gerade mit einem 20-Prozent-Rabbat für 1039 Euro im Angebot.
Welche Alternativen zum Roboup T1200 Pro sind empfehlenswert?
Bei kleineren Gärten empfehlen wir den Segway Navimow i105E oder i108E (Testbericht) für bis zu 500 und 800 m² Rasenfläche. Die bis auf den Akku baugleichen Modelle bieten mehr Einstellungsmöglichkeiten dank der tollen App und liefern ansonsten ein mindestens genauso gutes Alltagserlebnis. Vor allem mähen beide Modelle entlang der Grenzen, die der Nutzer vorgibt, sofern dort keine Büsche auf die Mähfläche hängen.
Bei größeren Gärten, besonders bei starkem Gefälle in den Rasenflächen, geht unser Tipp zum Mammotion Luba 2 (Testbericht). Der klettert dank Vierradantrieb wie eine Bergziege, navigiert ähnlich wie Roboup und Segway dank zusätzlicher Kamera auch bei schwacher GPS-Abdeckung hervorragend und schlägt sich dank vieler Einstellungsmöglichkeiten in der guten App bis zu angelernten Grenzen auch ins Gebüsch.
Ebenfalls ins Gebüsch geht es bei entsprechender Einstellung mit dem Dreame A1 (Testbericht), der dank Lidar (Light Detection and Ranging) wie Saugroboter zudem vollkommen unabhängig von GPS-Signalen ist und daher auch unter Überdachungen zentimetergenau mähen kann. Hier fehlt es aber wie beim Roboup-Modell derzeit noch an Bearbeitungsmöglichkeiten bereits angelegter Mähzonen.
Fazit
Der Roboup T1200 Pro hat die Probleme des Vorgängers aus dem Jahr 2023 überwunden und bietet jetzt guten GPS-Empfang und ordentliche Akkuausdauer. Auch die App hat sich weiterentwickelt, allerdings ist die Software des Mähroboters ohne Begrenzungskabel trotzdem unser größter Kritikpunkt. Vor allem der Umstand, dass der Roboter trotz theoretisch ganz genauer Anweisung durch den Nutzer beim manuellen Anlernen der Mähzonen dessen Wünsche später komplett ignoriert, stößt uns sauer auf.
Hier fehlt klar eine Einstellungs- oder Wahlmöglichkeit: Soll der Roboter so fahren, wie es der Nutzer vorgegeben hat oder seine eigene Intelligenz bemühen? Sollte der Hersteller hier nachbessern und zudem eine Korrekturmöglichkeit für bestehende Mähzonen hinzufügen, ist der T1200 Pro – auch im Hinblick auf den günstigen Preis in Relation zur Mähfläche – eine echte Empfehlung wert. So reiht er sich zum Testzeitpunkt eher ins Mittelfeld der von uns getesteten Modelle ohne Begrenzungsdraht ein – ordentlich, aber längst nicht perfekt.
Ecovacs Goat G1 2000
ab 1299 EUR
Der Mähroboter ohne Begrenzungskabel Ecovacs Goat G1 überzeugte im Jahr 2023 mit verlässlicher Technik, hatte aber noch Nachholbedarf bei der Software. Der G1 2000 schafft jetzt noch mehr Fläche – und was sonst noch?
VORTEILE
- mäht ohne Begrenzungskabel
- Objekterkennung
- arbeitet effektiv und strukturiert
NACHTEILE
- Navigationsbaken reichen bei 2000 m² nicht mehr aus
- immer noch keine Anpassung von Mähflächen möglich
- Beacons teuer bei Anschaffung und Unterhalt
Mähroboter Ecovacs Goat G1-2000 im Test: Kamera und Beacons statt GPS & Draht
Der Mähroboter ohne Begrenzungskabel Ecovacs Goat G1 überzeugte im Jahr 2023 mit verlässlicher Technik, hatte aber noch Nachholbedarf bei der Software. Der G1 2000 schafft jetzt noch mehr Fläche – und was sonst noch?
Mit dem Goat G1 gelang Ecovacs 2023 ein voller Erfolg. Der vor allem von Saugrobotern bekannte Hersteller brachte seinen ersten Mähroboter in den Handel, den Ecovacs Goat G1 (Testbericht). Mit Kamerasystem inklusive Objekterkennung, Ladestation mit Reinigungsfunktion für eben jenes und vor allem dem Verzicht auf Begrenzungskabel entwickelte sich das Modell zu einem Top-Seller. Allerdings fehlte es der Software noch an Feinschliff, wir vermissten vorrangig die Möglichkeit, einmal angelegte Mähflächen nachträglich anpassen zu dürfen. Das hat sich leider auch beim neuen Ecovacs Goat G1 800 (Testbericht) aus 2024 nicht geändert, der für kleinere Flächen ausgelegt und daher etwas günstiger ist.
War das beim Erstlingswerk noch akzeptabel, so ist das beim aktuellen Modell deutlich mehr zu kritisieren. Denn inzwischen bekommt Ecovacs von allen Seiten zunehmend Konkurrenz. Modelle wie Dreame A1 (Testbericht), Mammotion Luba 2 (Testbericht), Stiga A1500 (Testbericht), Segway Navimow i150E/i108E (Testbericht) und mehr vielversprechende Alternativen beherrschen das nämlich längst und selbst im Vorjahr konnten das schon Mähroboter ohne Begrenzungsdraht wie der erste Luba (Testbericht) oder die H-Serie von Segway Navimow (Testbericht).
Wir haben uns im Test daher den größten und neuesten Goat, den Goat G1-2000, angeschaut und überprüft, was der besser als seine Geschwistermodelle macht.
Was sind die Highlights des Ecovacs Goat G1 2000?
- mäht ohne GPS und Begrenzungsdraht
- Objekterkennung per Kamera
- für Rasenflächen bis 2000 m²
Der Goat G1 2000 kostet in der UVP des Herstellers 1999 Euro, auch bei Amazon ist das Modell zum Testzeitpunkt nicht günstiger.
Wie sieht der G1 2000 aus?
Optisch unterscheidet sich der Goat G1-2000 kaum vom G1. Allerdings kommt das Modell nun nicht mehr in Weiß, sondern ist Silber-Schwarz zum Kunden. Das gefällt uns gut und ist nicht ganz so schmutzanfällig wie die weiße Variante. Unten nur eine Änderung: Der Hersteller hat das Profil der Hinterräder überarbeitet. So soll das Gerät jetzt besser mit unwegsamem Gelände klarkommen und souveräner über abgesetzte Rasenkantensteine fahren können.
Der Goat G1-2000 wird inklusive Ladestation und Garage geliefert. Der Unterstellschutz verfügt über ein großes Dach aus Metall, die Seitenwände bestehen aus geriffeltem Kunststoff und setzen auf Holzoptik Marke „Eiche brutal“. Die Mähergarage könnte auch aus dem Ikea-Katalog stammen, dürfte aber wohl nicht jedermanns Geschmack treffen. An der ordentlichen Stabilität und dem Nutzen ändert das aber nichts, der Mäher ist so nicht ständig Wind und Wetter ausgesetzt. Bei uns ließen sich allerdings nicht alle Schrauben versenken, zwei gingen nur halb ins Metall des Rahmens und wollten dann weder vor noch zurück.
Auch der G1 2000 ist zur Navigation neben seinen Kameras wieder auf Navigationshilfen in Form der schon von den anderen G1-Modellen bekannten Beacons angewiesen. Da der Garage zwei weitere Signal-Baken beiliegen, bekommen Käufer des G1 2000 nun insgesamt vier dieser Signalfackeln. Das vergrößert die Fläche, die Nutzer damit abstecken können. Unserer Erfahrung mit dem Ur-G1 nach, der nur 2 Navigationsbaken mitbringt, reichen aber auch die vier Beacons nur bei sehr einfachen und offenen Grundstücken.
Alle Bilder zum Ecovacs Goat G1 2000 im Test
Wie schwer sind Aufbau und Inbetriebnahme beim G1 2000?
Aufbau und Inbetriebnahme des Goat G1 2000 dauern in etwa so lang wie bei den anderen G1-Modellen, hinzu kommt die Garage. Die Garage muss mit einigen Schrauben zusammengebaut und die Navigationsbaken zusammengesetzt sowie mit Batterien bestückt werden. Da die Ladestation mangels RTK (Real Time Kinematics) keine direkte Sicht in den freien Himmel benötigt, darf ihr Aufstellort sehr frei bestimmt werden. Anschließend erfolgt die Einbindung in die Ecovacs-App. Hier müssen Nutzer neben dem Roboter auch die Navigationsbaken registrieren. Pro-Tipp: Die Beacons sollten entsprechend nicht schon vorher auf dem Grundstück aufgestellt werden.
Apropos Navigationsbaken: 2023, als die ersten Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Massenmarkt für Endverbraucher kamen, waren diese Beacons ein probates Mittel, auch ohne störanfälligen GPS-Empfang verlässlich mähen zu können. Inzwischen zeigen Rasenroboter wie Segway Navimow i105E/i108E (Testbericht), Mammotion Luba 2 (Testbericht) und Dreame A1 (Testbericht) aber, dass das entweder mittels Kombination aus GPS und Kamera oder mit Lidar auch ohne solche Hilfsmittel geht. Damit sparen sich Nutzer nicht nur die mehr oder weniger auffälligen Baken, sondern auch die drei großen D-Batterien, die jedes Beacon jährlich benötigt. Zudem stellte sich schnell heraus, dass die Beacons am besten freie Sicht untereinander benötigen, um eine stabile Verbindung zu halten. In altgewachsenen Gärten mit dichtem Bewuchs reichen entsprechend auch die maximal 10 nutzbaren Signalfackeln nicht mehr aus. Hier hätten wir von Ecovacs deutliche Nachbesserung erwartet, die bleibt beim G1 2000 wie schon beim G1 800 (Testbericht) leider aus.
Der Mähroboter lässt sich neben dem WLAN-Betrieb auch per Mobilfunk anbinden. Das Modul ist beim G1-2000 Standard und die Nutzung für drei Jahre kostenlos. Bei anderen Modellen muss es separat erworben werden, Stiga hingegen bietet unter anderem bei seinem Modell A1500 (Testbericht) lebenslang kostenlose 4G-Nutzung an. Wer keinen WLAN-Empfang im Garten hat, sollte auf diese Möglichkeit zurückgreifen, wenn das Gerät per App und auch aus der Ferne gesteuert werden soll.
Die Einbindung von Beacons und Mähroboter klappt dank der perfekt illustrierten App problemlos. Dann geht es ans Kartieren der Mähzonen. Das klappt genauso wie beim Ecovacs G1 (Testbericht), weshalb wir an dieser Stelle nicht näher darauf eingehen. Die Bluetooth-Verbindung blieb während des Vorgangs stabil. Der Rasen sollte vor dem ersten Mähen kürzer als 10 Zentimeter sein. Im Gegensatz zu Modellen wie den Lubas würden wir das beim G1 200 auch empfehlen, da er im Betrieb weniger kraftvoll als diese Ausnahmetalente wirkt – für hohes Gras ist der G1 einfach nicht gemacht. Nach der Erstkartierung fährt das Gerät eigenständig die Fläche ab und prägt sie sich ein. Das kann bei größeren Rasenflächen schon mal gut und gerne 30 bis 60 Minuten dauern. Eventuell anzulegende No-Go-Zonen wie Beete sollten nicht vergessen und zwingend vor der ersten Erkundungsfahrt eingerichtet werden.
Wie gut ist die App des G1 2000?
Bedienung und App gleichen dem Modell aus dem vergangenen Jahr – und das ist gleichzeitig gut und das größte Problem des Ecovacs Goat G1 2000. Denn einerseits ist die App übersichtlich und gut aufbereitet. Andererseits fehlt die bereits angedeutete Möglichkeit, angelernte Mähzonen später noch einmal anzupassen, weiterhin. Hinzu kommt, dass die Schnitthöhe ausschließlich manuell am Gerät selbst über ein Drehrad verstellt werden kann.
Auch am Kamerasystem hat sich nichts geändert. Zur Hindernis- oder Objekterkennung reicht es und der Roboter macht seinen Job gar nicht schlecht. Als Überwachungssystem ist es allerdings schlichtweg ungeeignet, da die Qualität deutlich unter der einer Überwachungskamera (Übersicht) liegt. Was genau man mit der Überwachungsfunktion des Goat G1 2000 anfangen kann, haben wir bereits im Test des Goat G1 (Testbericht) beschrieben.
Wie schlägt sich der G1 2000 im Alltag?
Im Alltag macht der Ecovavs Goat G1 2000 insgesamt dennoch einen guten Job – sofern es die Beschaffenheit des Gartens zulässt. Das Gerät mähte die knapp 600 Quadratmeter vor, neben und hinter dem Haus anstandslos und in überlappenden Bahnen. Das Kamerasystem erkennt dabei zuverlässig Objekte oder Hindernisse – auch Personen – und ändert seine Route. Zudem können auf Wunsch dabei auch die Messer gestoppt werden, was für zusätzliche Sicherheit sorgt. Auch unseren Test mit einer Igel-Attrappe bestand der G1 2000, dennoch betonen wir an dieser Stelle erneut, dass Mähroboter weder in den frühen noch in den späten Dämmerungsstunden oder gar nachts fahren sollten – dämmerungs- und nachtaktiven Tieren zuliebe. Innerhalb der App bietet der Hersteller dafür eine Tierschutzzeit, die standardmäßig schon aktiviert ist.
Die Objekterkennung hat wie immer ihre Nachteile: „Ins Gebüsch“ schlägt sich der G1 2000 nicht. Wer am Rasenrand also Büsche stehen hat, wir mit einem ungemähten Streifen daneben leben müssen. Denn die sieht der Roboter als Hindernis an und hält dazu Abstand.
Andererseits kamen wir mit den mitgelieferten 4 Beacons nicht weit. Selbst mit Signalfackeln anderer G1-Modelle konnten wir nicht den kompletten Rasen auf allen Seiten des Hauses abdecken. Denn der dichte Bewuchs mit großen Rhododendron- und Lorbeer-Büschen störte die Kommunikation der Baken untereinander. Bei dem G1 800 finden wir das noch halbwegs in Ordnung, schließlich ist der „nur“ für 800 m², also eher kleinere Gärten, ausgelegt. Bei einem Mäher, der für 2000 m² ausgelegt ist (1000 m² pro Tag) halten wir es schlichtweg für unrealistisch, ordentlichen Empfang per Beacons zu gewährleisten.
Immerhin benötigen Interessenten für den Einsatz keinen Golfrasen. Dank der im Vergleich zu den anderen G1-Modellen gröberen Stollenreifen kommt der Bot selbst mit einem unebenen Grundstück gut zurecht, obwohl die Steigfähigkeit des 2000er mit 45 % gleich geblieben ist. Der G1-2000 besitzt zudem von allen Modellen den größten Akku, damit er nicht ständig zurück zur Station muss. Mit einer Akkuladung mäht er in etwa 300 bis 400 m² am Stück, dann lädt er einige Stunden nach.
Was kostet der Ecovacs G1-2000 und was sind die Alternativen?
Der Ecovacs Goat G1-2000 kostet in der UVP des Herstellers 1999 Euro, auch bei Amazon ist das Modell zum Testzeitpunkt nicht günstiger. Erhältlich ist der Mähroboter einerseits im herstellereigenen Onlineshop, andererseits auch bei Amazon. Jede Navigationsbake kostet zusätzlich 99 Euro. Die Anzahl der benötigten Beacons lässt sich mit einem Online-Tool des Herstellers berechnen, allerdings ist das Ergebnis in unseren Augen bestenfalls für spärlich bepflanzte Gärten zutreffend.
Wer eine Alternative zum Ecovacs Goat G1 2000 sucht, sollte sich einmal den Mammotion Luba 2 (Testbericht) ansehen. Das Gerät gibt es in diesem Jahr in zweiter Generation mit zusätzlichem Kamerasystem, wodurch sich die ohnehin gute Navigation deutlich verbessert hat. Es bietet gleich zwei Messerteller und somit eine deutlich breitere Schnittfläche, hinzu kommt Allradantrieb. Navigationsbaken gibt es nicht.
Ebenfalls einen Blick wert ist der Dreame A1 (Testbericht), der ebenfalls recht neu im Handel ist. Das Gerät verzichtet auch auf Baken und benötigt zudem keine Station mit GPS. Stattdessen kommt wie bei moderne Saugroboter ein LiDAR-System zum Einsatz, mit dem sich der Mähroboter in seiner Umgebung zurechtfindet.
Für kleinere Gärten empfehlen wir ansonsten die Modelle Segway Navimow i105E und i108E (Testbericht). Sie bieten für erstaunlich wenig Geld dank GPS und Kamera eine der besten Navigationen im Vergleichsfeld, außerdem überzeugen Schnittbild und App.
Fazit
Die Goat-Reihe von Ecovacs überzeugt generell mit ihrer Zuverlässigkeit und Einfachheit, allerdings kommt das System mit den Navigationsbaken bei starkem Bewuchs eines Gartens schnell an seine Grenzen. Während wir das beim G1 800 und entsprechend kleinerem Garten nicht so schlimm finden, halten wir den G1 2000 nur für große Gärten mit weiten Flächen und wenig Bewuchs für sinnvoll.
Dann erwerben Interessenten einen Mähroboter ohne Begrenzungskabel, der sich selten festfährt und zuverlässig seinen Job erledigt. Die Hinterräder mit mehr Profil sorgen in schwierigeren Umgebungen für einen verbesserten Bodenkontakt im Vergleich zu den anderen G1-Modellen, die Steigfähigkeit ist allerdings gleichgeblieben. Positiv ist die beim großen Modell mitgelieferte Garage, das ist ein nettes Gimmick. Ansonsten hat sich einfach zu wenig im Vergleich zum Ecovacs Goat G1 (Testbericht) aus 2023 getan.
Weitere spannende Inhalte zum Thema gibt es hier:
Husqvarna Automower 410XE Nera Epos
ab 1999 EUR
Nach seinen Profi-Mährobotern bietet Marktführer Husqvarna seit einiger Zeit nun auch Mähroboter ohne Begrenzungsdraht für Privatkunden. Das neueste Exemplar ist der Automower 410XE Nera mit Epos-System, den wir hier getestet haben.
VORTEILE
- sehr leise
- gute Ortungsstabilität
- mäht wirklich den Rand gut
NACHTEILE
- kann keine strukturierten Bahnen fahren
- App zu durcheinander
- sehr teuer für die Leistung
Mähroboter Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos im Test: Chaos ohne Draht
Nach seinen Profi-Mährobotern bietet Marktführer Husqvarna seit einiger Zeit nun auch Mähroboter ohne Begrenzungsdraht für Privatkunden. Das neueste Exemplar ist der Automower 410XE Nera mit Epos-System, den wir hier getestet haben.
Husqvarna ist Marktführer bei Mährobotern. Da ist die Erwartung groß, wenn ein neues Gerät auf den Markt kommt, und so eine Erwartung macht es oft fast unmöglich, sie in der Realität zu erfüllen. So erging es uns etwas, als wir den Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos auf unseren Testrasen losließen. Denn schon bei der eigentlich einfachen Installation fielen uns Kleinigkeiten negativ auf, die die Konkurrenz besser macht und auch im Alltag konnte uns das neue Modell nicht immer zufriedenstellen. Das ist schade, denn in einigen Bereichen ist der Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht richtig gut. Welche das sind, verraten wir im Test.
Was sind die Highlights des Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos?
- spannendes Design mit Lampen vorne
- Edgecut-Feature mit zweiten Mähteller hinten
- kann mit und ohne Begrenzungsdraht mähen
- Mähroboter vom Marktführer
Der Husqvarna Automower 410XE Nera ist zum Testzeitpunkt ab 2139 Euro zu bekommen. Hinzu kommen 249 Euro für das Plug-in-Kit und 399 Euro für die Referenzstation RS1.
Wie sieht der Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos aus?
Husqvarna entscheidet sich beim Automower 410XE Nera mit Epos für ein Design mit vorn liegenden Antriebsrädern, hinten gibt es wie beim Segway Navimow i105E/i108E (Testbericht) nur zwei Stützräder. Das lässt den Automower zwar sehr agil erscheinen, allerdings schwenkt das Heck bei Kurven seitlich aus, sodass der Mäher in Ecken schon frühzeitig in sanfter Kurve Abstand zu seitlichen Hindernissen gewinnen muss. Dadurch bleiben Ecken weitestgehend unbeschnitten.
Die zweite Besonderheit des Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos ist, dass er grundsätzlich gar nicht mit Epos, also dem Satellitennavigationssystem des Herstellers, zum Kunden kommt. Entsprechend fehlt dann der Epos-Zusatz im Namen. Stattdessen kaufen Kunden immer einen Schleifenmäher, bei dem wie bei herkömmlichen Mährobotern vor Gebrauch aufwendig ein Kabel im Garten verlegt werden muss. Nur, wer noch einmal rund 650 Euro für das in den Roboter einzubauende Epos-Kit und die „kleine“ RTK-Antenne mit rund 500 Meter Reichweite ausgibt (es gibt auch eine mit mehreren Kilometern Reichweite für 999 Euro in der UVP), kann auf den Draht verzichten.
Besonders ist auch die Anordnung der Schneidewerke unten am Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos. So verfügt das Modell recht mittig unter dem Chassis den Hauptmähteller mit drei Klinken, weit hinten am Chassis installiert der Hersteller zudem einen kleineren Mähteller mit ebenfalls drei Klingen. Damit soll der 410XE randlos mähen können.
Die vierte „Besonderheit“ ist die Beleuchtung vorn. Denn wie ein Auto etwa verfügt der dunkelgraue Automower 410XE Nera mit oder ohne Epos über zwei „Scheinwerfer“ vorn. Auch wenn die nicht übermäßig hell sind und der Mähroboter sie zum Mähen auch gar nicht benötigt, sieht das schon schick aus. Allerdings könnten sie Nutzer dazu verleiten, den Roboter auch nachts fahren zu lassen – davon raten wir zum Schutz von dämmerungs- und nachtaktiven Tieren aber dringend ab!
Das restliche Design mit seinen ausgestellten „Kotflügeln“ lässt den Automower breit, tief und bullig wirken. Zur Bedienung am Gerät selbst verfügt der Husqvarna Automower 410XE Nera oben neben der obligatorischen Notstopp-Taste ein kleines Farbdisplay mit angrenzendem Jogdial (Drehrad mit Druckfunktion) sowie eine Start-Taste. Alle Buttons inklusive des Drehrades fühlen sich dabei hochwertig und präzise an.
Alle Bilder zum Husqvarna Automower 410XE Nera mit EPOS im Test
Wie einfach ist die Inbetriebnahme beim Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos?
Bei der ersten Installation sind wir überraschend auf einige kleinere Fallstricke gestoßen, mit denen wir beim Marktführer nicht gerechnet haben. Einige sind darauf zurückzuführen, dass der Automower 410XE eben kein reiner RTK-Mäher, sondern ein Hybridmodell ist, das mit zusätzlichem Plug-in-Kit erst zu einem kabellosen Mähroboter aufgewertet werden will. Allerdings hätte man das wohl im Detail auch besser lösen können.
So fiel als Erstes auf, dass neben Kabel, Befestigungsmaterial und Epos-Kit sowie Antenne zwar (bis auf Schrauben) alles dabei ist, um die Montage zu beginnen. Allerdings wird im umfangreichen, in zahllosen Sprachen ausgeführten Anleitungsbuch zwar davon gesprochen, dass die Antenne an einem Zaun oder einem Mast installiert werden kann, letzterer liegt aber nicht bei. Das macht die Konkurrenz anders, weshalb wir kurzerhand den nur rund 1 Meter langen Metallstab des Segway Navimow i105E & i108E (Testbericht) zweckentfremdeten.
Dabei kam die nächste Überraschung: Husqvarna setzt zum Befestigen der RTK-Antenne an einer Stange auf einfache Schraubschellen, die zwar ihren Zweck absolut erfüllen, aber fummelig sind und etwas billig wirken. In Anbetracht des hohen Preises des Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos finden wir das unangemessen.
Eine kleine Unachtsamkeit ist zudem im eigens dem Epos-Kit beiliegende Handbuch zu finden. Dort wird zwar Schritt für Schritt erklärt, wie man was verkabeln muss, um anschließend das Epos-System nutzen zu können. Wer allerdings einen Hinweis sucht, wo oder wie das Plug-in-Kit installiert wird, findet nur den Verweis auf die Anleitung, die er gerade liest – das ist mäßig hilfreich, um es nett auszudrücken. Letztlich ist das aber kein Hexenwerk: einfach die obere Abdeckung des Roboters entfernen, die nur aufgesteckt ist. Dann die beiden Sternschrauben lösen, die mittig eine Abdeckplatte in Position halten, den Blindstopfen des aus dem Roboter bereitliegenden Kabels entfernen, das Kit daran anschließen und mit den gleichen Schrauben wieder befestigen. Die frühere Abdeckplatte sollten Nutzer aufbewahren, sofern sie später vielleicht doch zum Mähen per Kabel zurückkehren wollen.
Wie gut ist die App des Husqvarna Automower 410XE mit Epos?
Sind alle Ladestation und RTK-Antenne an den Strom angeschlossen, kann es endlich mit der Kontaktaufnahme zwischen Smartphone und Mähroboter losgehen. Benötigt wird dafür die Automower-Connect-App, die es kostenlos im Android Playstore oder im Marketplace für iOS gibt. Anschließend will der Mäher erst einmal mit dem vorgegebenen PIN-Code 1234 entsperrt werden, anschließend ein neuer ersonnen und danach RTK-Antenne und Ladestation mit dem Roboter gekoppelt werden. Wer den Mäher von unterwegs aus steuern möchte, muss sich zudem mit der Husqvarna-Cloud verbinden. Bei der Konkurrenz klappt das alles automatisch. Anschließend wollte unser Testgerät zwingend ein Firmware-Update over the Air einspielen, was mit einer Zeitspanne von bis zu 15 Minuten veranschlagt wurde. Bei uns dauerte das deutlich länger. Zu allem Überfluss gibt es keine Fortschrittsanzeige, sodass der Nutzer nicht erkennen kann, wie lange das wohl noch geht oder ob überhaupt etwas passiert. Das geht besser.
Der Rest der App ist nicht übermäßig, aber ausreichend übersichtlich, zumindest meistens. Das liegt auch daran, dass es schlichtweg nicht großartig viel einzustellen gibt. Auf der Hauptseite erwartet den Nutzer ein Bild des Mähers mit einigen Grundangaben wie der Tätigkeit (etwa Mähen oder Pausieren). Außerdem gibt es hier Buttons für die Rückkehr zur Ladestation oder zum Starten. Am unteren Displayrand gibt es zudem weitere Reiter wie Karte, Shop, Erkunden und mehr. Über die Karte lernt der Nutzer den Roboter an und bringt ihm die Grenzen seiner zukünftigen Arbeitsstätte bei. Das geschieht grundsätzlich wie bei der Konkurrenz – mit dem großen Unterschied, dass der Besitzer jeden GPS-Punkt durch Drücken der großen Plustaste unten rechts selbst festlegen muss. Bei allen anderen von uns bislang getesteten Modelle, bei denen der Nutzer die Grenzen händisch anlernen muss, geschieht das automatisch.
Zum schwammigen Fahrverhalten während der manuellen Steuerung kommt dann also auch noch das sekündliche Drücken einer virtuellen Taste hinzu, was noch dazu jedes Mal von einem Klingelgeräusch untermalt wird. Da ist die Konkurrenz schon deutlich weiter. Immerhin funktioniert diese Vorgehensweise – sowohl für Mähzonen, No-Go-Zonen und Pfade, die Zonen verbinden. In der Kartenansicht sieht man übrigens auch die bereits gefahrenen Mähwege – oder zumindest die letzten. Mangels geordneter Bahnenfahrt lässt sich das aber nicht zweifelsfrei sagen, offenbar wird nur eine bestimmte Anzahl dargestellt und dann wieder überschrieben.
Im Shop lassen sich natürlich Wartungs- und Ersatzteile sowie Zubehör erwerben, der Menüpunkt Erkunden verbirgt einige Tipps und Hinweise sowie etwas Werbung für Produkte des Herstellers. Unter Mehr gelangten Interessenten in die eigentlichen Einstellungen. Hier dürfen sie Dinge wie einen Ecomodus einstellen, der etwa die GPS-Antenne deaktiviert, wenn der Roboter lädt. Außerdem dürfen hier Dinge wie die Objektvermeidung oder Edgecut aktiviert werden.
Im Detail wirken viele Menüpunkte und Features etwas willkürlich verteilt, sodass wichtige Funktionen untergehen. Die Funktion zum Einstellen der elektronischen Höhenverstellung (eigentlich 20 bis 55 mm) für das Schneidwerk etwa haben wir anfangs komplett vergeblich gesucht. Nervig sind zudem die teils langen Wartezeiten, etwa wenn Einstellungen gespeichert werden. Das dauerte bei uns im Test gerne auch mal 20 bis 30 Sekunden und dürfte an einem nicht perfekten WLAN gelegen haben. Im 4G-Betrieb gab es das deutlich weniger.
Wie gut mäht der Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos?
Im Alltag schlägt sich der 410X grundsätzlich ordentlich. Zumindest, nachdem man den ersten Schock verdaut hat. Denn obwohl der Roboter nicht viel unter 3000 Euro kostet und dabei „nur“ für rund 1000 m² ausgelegt ist, mäht er nicht strukturiert in Bahnen, sondern wie die meisten Schleifenmäher nach dem Chaosprinzip. Das bedeutet: Er fährt in gerader Linie, bis er entweder auf ein Hindernis oder die Begrenzung stößt, macht dann in zufälligem Winkel kehrt und fährt genauso weiter.
Im Alltag bedeutet das vor allem eines: Der Husqvarna Automower 410XE Nera ist mit oder ohne Epos wesentlich langsamer als seine strukturierten Wettbewerber. Im Test ist das kaum genau nachzustellen, da aus der App nicht zuverlässig erkennbar ist, wo der Roboter bereits war. Allerdings schätzen wir, dass der Husqvarna-Mäher gut fünf bis zehnmal länger als etwa der Mammotion Luba 2 (Testbericht) für die gleiche Fläche benötigt.
Da der Bot selbst nicht genau weiß, wo er bereits war, beendet er auch nicht den Mähvorgang mit dem Hinweis, dass er seine Aufgabe beendet hat. Stattdessen fährt er immer in vom Nutzer festgelegten Zeitintervallen und „hofft“, eines Tages tatsächlich jeden Winkel des Rasens abgefahren zu haben. Einen Vorteil hat das Chaos-Prinzip aber immerhin: Bahnen sieht man somit nicht auf dem Grün, daran sollen sich ja manche Interessenten stören.
Ansonsten macht der Mäher auf dem Gras einen ziemlich ordentlichen Eindruck. Er ist angenehm leise, am lautesten ist da fast schon das Absäbeln der Grasspitzen. Außerdem hat der Automower 410XE einen nicht zu verachtenden Vorteil: Er mäht nah an den Rand. Das schafft er dank seines zweiten Mähtellers am Heck. Im Betrieb fährt er nah an die zuvor abgesteckte Grenze, setzt dann leicht zurück und dreht sich. Dabei schwenkt das Heck aus und der Bot mäht mit dem hinteren kleinen Schneidwerk den Rand. Das klappt auch nah an höheren Hindernissen wie Mauern oder Zäunen. Bei genügend Zeit klappt das mit dem Husqvarna-Modell vielleicht sogar am besten aller bislang getesteten Modelle. Bei gleich hohen Hindernissen wie Terrassen- oder Randsteinen kann der Automower hingegen wie andere GPS-Mäher einfach leicht auf die Steine fahren, um möglichst viel Rand zu mähen.
Ebenfalls relativ gut gefallen hat und die Hinderniserkennung auf Radarbasis. Damit erkennt er kleinere und größere Objekte auf dem Grün und umfährt sie normalerweise. Wir haben das mit unserer Igel-Attrappe probiert. Sofern der Roboter direkt mittig darauf zufährt, hat er die kleine Statue immer als Hindernis erkannt und abgedreht. Lag sie hingegen eher im Randbereich, wurde sie vom Automower auch an- und fast überfahren. Hier zeigt sich einmal mehr, dass Mähroboter nicht in der Dämmerung oder gar bei Nacht fahren sollten!
Die Signalstärke des Husqvarna Automower 410XE Nera ist ebenfalls tadellos und liegt in etwa auf dem Niveau des Stiga A1500 (Testbericht). Damit gehört er zu den stabilsten RTK-Mähern, so schnell verliert das Modell seine GPS-Positionierung nicht. Allerdings kommt auch dieses System an seine Grenzen. Wer etwa besonders enge, von Büschen, Bäumen oder Hauswänden abgeschirmte Bereiche mähen will, muss etwas mehr Ungenauigkeit in Kauf nehmen. Kombisysteme mit GPS und Kamera wie beim Mammotion Luba 2 (Testbericht) sind hier derzeit das Maß der Dinge.
Gegen Diebstahl helfen beim Marktführer PIN, diverse Sensoren und ein Geofence-Bereich, bei dessen Verlassen der Mäher Alarm schlägt. Außerdem ist er dann per App ortbar. Ein Kletterkünstler ist der 410XE hingegen nicht, der Hersteller spricht von maximal 30 Prozent Steigfähigkeit – ausreichend. Zu Integration ins eigene Smart Home stehen die Dienste Amazon Alexa, Google Home und IFTTT zur Verfügung. Der Akku des Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos reicht aus, um etwa 1,5 Stunden am Stück zu mähen. Anschließend lädt er für etwa die gleiche Zeit und setzt dann seine Arbeit fort, sofern der Nutzer nichts anderes eingestellt hat.
Preis
Die UVP des Husqvarna Automower 410XE Nera als Schleifenmäher liegt bei stolzen 2699 Euro. Wer kabellos mähen möchte, muss noch Plug-in-Kit und RTK-Antenne dazukaufen. Der Husqvarna Automower 410XE Nera ist zum Testzeitpunkt ab 2139 Euro zu bekommen. Hinzu kommen 249 Euro für das Plug-in-Kit und 399 Euro für die Referenzstation RS1.
Bessere Alternativen sind in unseren Augen der deutlich günstigere Segway Navimow i108E (Testbericht) oder der ältere, aber immer noch gute Segway Navimow der H-Serie (Testbericht), etwa in der Ausführung als H1500. Beide Modelle bieten mehr Features und eine bessere App. Noch besser hat uns der Luba 2 von Mammotion (Testbericht) gefallen, der zum fast gleichen Preis wie der 410XE die dreifache Fläche mähen kann und dank GPS und Kamera noch stabiler navigiert. Die beste Hardware hatte in unseren Tests bislang der Stiga A1500 (Testbericht). Wer es hingegen noch einfacher haben will, darf einen Blick auf den Worx Vision (Testbericht) werfen. Er kann zwar noch etwas weniger, ist aber auch günstiger als das Modell vom Marktführer.
Fazit
Sagen wir, wie es ist: Der Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos enttäuscht uns. Nicht unbedingt, weil er ein schlechter Mähroboter ohne Begrenzungskabel wäre, sondern weil er zu einem höheren Preis als bei der Konkurrenz meist weniger bietet – und das vom Marktführer! Positiv hervorzuheben ist das ordentliche und halbwegs leichte Chassis (12,5 kg), mit dem sich der Roboter nie festfuhr und selten durchdrehende Räder zeigte. Zudem ist der Mäher angenehm leise. Außerdem funktioniert die Edgecut-Funktion mit dem zweiten Mähteller hinten recht gut.
Leider wird das zunichtegemacht durch die Fahrt nach dem Chaos-Prinzip, weshalb der Bot wesentlich länger benötigt, als strukturierte Bahnenzieher. Zudem hat uns die App nicht wirklich überzeugen können, hier wirkt alles etwas zusammengewürfelt. In Anbetracht des hohen Preises ist das einfach zu wenig.
Gute Alternativen für Arbeiten im un am Haus sind:
Ecovacs Goat GX-600
Bislang hat sich Ecovacs bei seinen Mährobotern ohne Begrenzungskabel auf Kamera und Beacons zur Navigation verlassen, beim neuen GX-600 ist das anders. Was das für Vor- und Nachteile mit sich bringt, verraten wir im Test.
VORTEILE
- enorm einfach in Betrieb zu nehmen
- kein Begrenzungsdraht, GPS-Antenne oder Beacons
- mäht zuverlässig und in Bahnen
- unabhängig von störungsanfälligen GPS-Diensten oder Kabeln
NACHTEILE
- kann selbstständig nur 1 Zone mähen
- keine Eingriffsmöglichkeiten durch Nutzer
- kein grafischer Fortschritt in App zu sehen
- mäht nicht unter herabhängenden Blättern/Ästen
Einfach gut: Mähroboter Ecovacs Goat GX-600 ohne Begrenzungskabel im Test
Bislang hat sich Ecovacs bei seinen Mährobotern ohne Begrenzungskabel auf Kamera und Beacons zur Navigation verlassen, beim neuen GX-600 ist das anders. Was das für Vor- und Nachteile mit sich bringt, verraten wir im Test.
Lästiges Begrenzungskabel-Verlegen war gestern, auch Ecovacs hat als erfolgreicher Hersteller von Saugrobotern (Bestenliste) kabellose Modelle wie den Goat G1 (Testbericht), G1 800 (Testbericht) und G1 2000 (Testbericht) im Angebot. All diesen Modellen ist aber gemein, dass sie neben der Kamera zur Navigation zusätzliche Beacons benötigen, um sich auf dem Rasen zurechtzufinden. Die sind aber nicht nur teuer in Anschaffung und Unterhalt (99 Euro pro Stück, pro Jahr und pro Bake je drei D-Batterien), sondern je nach Geschmack auch noch eher unschön im Garten anzusehen. Außerdem hindert dichter Bewuchs die Kommunikation der Signalfackeln untereinander und mit dem Roboter, weshalb wir eher offene Gärten mit moderater Vegetation für die G1-Modelle empfehlen.
Ecovacs setzt beim neuen Goat GX-600 auf smarte Sensoren und KI-Algorithmen zur kabelfreien Erkennung des Mähbereichs. Was hochtrabend klingt, bringt allerdings einige Einschränkungen mit sich. Wir haben uns den neuen Mähroboter ausführlich angeschaut und verraten, was er kann.
Was sind die Highlights des Ecovacs Goat GX-600?
- erkennt Rasen ohne Begrenzungskabel und Einrichtung
- intelligente AIVI 3D Objekterkennung
- mäht in Bahnen
- 3 Jahre Garantie auf Mähroboter, 2 Jahre auf Akku
Der Ecovacs Goat GX-600 kostet zum Testzeitpunkt 1299 Euro bei Amazon. Weitere Mähroboter ohne Begrenzungsdraht haben wir in unserer Bestenliste zusammengefasst.
Wie ist die Verarbeitung des Ecovacs Goat GX-600?
Der in schlichtem Grün gehaltene Ecovacs Goat GX-600 wirkt solide und ausreichend hochwertig verarbeitet. Die Form ist nahezu mit den G1-Modellen identisch. So fällt direkt die an der Front eingebaute Weitwinkelkamera ins Auge, die Orientierung und smarter Objekterkennung dient. Die 360-Grad-Kamera, die bei den anderen G1-Modellen oben auf dem Chassis als gläserne Halbkugel sitzt, fehlt dem GX-600. Das gilt auch für die Antenne der G1-Modelle. Da der GX keine weiteren Positionierungs-Baken benötigt, fällt die flexible Stummelantenne der anderen Modelle hier weg.
Der Rest ist weitestgehend gleich. So gibt es oben auf dem Mäher wieder die aufklappbare Abdeckung, unter der sich Bedientasten für Einstellungen am Gerät, Display und mechanische Schnitthöhenregulierung sowie (dahinter) die rote Stopptaste befinden. Größe und Gewicht sind nahezu identisch zu den anderen Modellen der G1-Reihe von Ecovacs. Der Goat GX-600 ist nach IPX6 gegen Regen und Spritzwasser geschützt, entsprechend lässt er sich mit dem Gartenschlauch, nicht aber mit einem Hochdruckstrahler reinigen.
Wie einfach ist die Einrichtung des Ecovacs Goat GX-600?
Etwas Vorsicht ist bei der Positionierung der Ladestation geboten. Diese wird nun nicht mehr im 90-Grad-Winkel zur Mähfläche positioniert, sondern so parallel zur Rasenkante, dass der Roboter bei der Rückfahrt entlang der Rasenkanten entgegen dem Uhrzeigersinn später wieder zurückfindet. Dabei muss die Station nicht zwingend auf der Rasenfläche selbst stehen, sondern darf auch direkt daneben auf der Terrasse positioniert werden, sofern der Roboter sie so finden kann. Dank der gut bebilderten Anleitung in Handbuch und App sollte die richtige Positionierung aber keine Probleme bereiten. So flexibel wie bei den G1-Modellen lässt sich der Aufstellort aber nicht wählen.
Bei der ersten Inbetriebnahme wird der Goat GX-600 per QR-Code mit der zugehörigen Ecovacs-Home-App gekoppelt – ganz wie bei der G1-Serie. Ein vierstelliger PIN-Code schützt vor unbefugtem Zugriff, das war es auch schon. Denn lästiges Verlegen von Begrenzungskabeln entfällt komplett und auch das sonst obligatorische Abfahren der Rasengrenzen wie mit einem RC-Auto (Ratgeber) gibt es nicht. Der Mäher ist direkt startklar.
Die App bietet fast alle Einstellungsmöglichkeiten, die es auch für die G1-Modelle gibt. Einziger Unterschied: Der Nutzer sieht keine Karte der Mähfläche und entsprechend grafisch auch nicht den aktuellen Mähfortschritt. Der wird nur als Prozentzahl angezeigt. Bei ausreichender WLAN-Abdeckung dürfen Nutzer aber durch die Kamera des Mähers schauen und sehen so eventuell, wo der GX gerade mäht. Die automatische Mähplan-Erstellung klappte bei uns übrigens nicht vernünftig – der GX wollte danach mitten in der Nacht mähen, obwohl die Tierschutzzeit aktiviert war.
Wie gut mäht der Ecovacs Goat GX-600?
Der Ecovacs Goat GX-600 orientiert sich allein mittels seiner Kamera und den damit verbundenen KI-Features. Nach dem Start fährt er zuerst am Rand entlang die erreichbare Rasenfläche ab, anschließend geht es in den Innenbereich. Klasse: Im Gegensatz zum ansonsten ähnlich agierenden Worx Vision (Testbericht) fährt der Ecovacs-Mäher geordnete Bahnen und nicht nach dem Chaosprinzip. Das spart Zeit und Strom und garantiert, dass der Mäher tatsächlich auch die komplette Fläche abfährt. Er schafft in der „Fein“-Einstellung 300 Quadratmeter pro Tag, die versprochenen 600 Quadratmeter also innerhalb von 24 Stunden.
Und wie navigiert der GX nun? Mittels der sogenannten Smartedge-Technologie erkennt der Mähroboter dank Kamera und intelligenter Algorithmen Farben und Beschaffenheit unterschiedlicher Materialien und kann so Rasen von Stein, Beton oder anderen Texturen unterscheiden. Das setzt entsprechend voraus, dass die zu mähende Rasenfläche immer gut erkennbare Abtrennungen zu Beeten und anderen Bereichen aufweist. Denkbar sind hier etwa Randsteine, Mauern, Zäune oder Hecken. Wächst Gras ohne erkennbare Abgrenzung ins Beet, endet der daraus resultierende Ausflug des GX ins Beet für Blumen unter Umständen tödlich. Obwohl unser Testgelände streckenweise ohne übermäßig eindeutige Unterscheidungen auskommt, hat sich der GX allerdings nicht einmal ins Beet verabschiedet oder sonst wie festgefahren.
Im Gegenzug kommen allerdings die typischen Probleme der Kamera-Navigation zum Tragen. So mäht der GX-600 zwar oft bis wenige Zentimeter an den Rand und fährt mit einem Rad bisweilen auf dem Randstein, bei einer angrenzenden Terrasse wollte er das aber nicht. So mäht er Ränder genauer als der ähnlich agierende Worx Vision (Testbericht) und deutlich besser als der Einhell Freelexo Cam 500 (Testbericht), Modelle, bei denen der Nutzer aber selbst die genaue Fahrweise vorgeben kann, sind hier trotzdem im Vorteil.
Ein weiterer Negativpunkt: Herabhängende Äste und Zweige werden – wie auch bei den G1-Modellen – als feste Hindernisse umfahren. Gras darunter kann der GX also nicht mähen. Und auch bei Rasen, der einfach anders als erwartet aussieht, gerät der Ecovacs-Mäher leicht ins Schwimmen. So ließ er sich im Test etwa von einem wahren Blütenmeer an verblühten und abgefallenen Blüten irritieren. Zwar umfuhr er sich erstaunlicherweise nicht komplett, hielt hier aber größeren Abstand zum Rand als gewöhnlich. Dafür kam er sehr gut mit einem ehemaligen „Biomüllhügel“ klar, der inzwischen komplett mit Gras überwachsen, aber zu steil zum Befahren ist. Hier fuhr der GX erstaunlich klare Ränder um den Fuß des Hügels herum.
Zudem arbeitet die integrierte Pfadplanung strukturiert und effizient. Der Mäher wählt dabei ein systematisches Streifenmuster und fährt anschließend parallele Bahnen mit leichter Überlappung. Ausgelassen hat der GX-600 im Test dabei nichts. Das Wendemanöver an Rasenkanten klappt zudem tadellos. Nach der Arbeit fand unser Testexemplar gut heim – und das, obwohl wir die Station testweise alles andere als optimal positioniert haben. Einziger Nachteil: Der Rückweg erfolgt immer wieder am Rand der Mähfläche entlang und dauert so unter Umständen länger als nötig.
Der Ecovacs Goat GX-600 verfügt über ein schwimmendes Mähdeck und leistet gute Arbeit | TechStage.de
Etwas schade finden wir, dass der Roboter in der App keine Karte und auch keinen Mähfortschritt darstellt. Das können zwar auch Einhell Freelexo Cam 500 (Testbericht), Worx Vision (Testbericht) und Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos (Testbericht) nicht, die mähen aber auch nach dem Chaosprinzip. Ein weiterer Nachteil: Der Ecovacs GX-600 kann zwar auch andere Rasenflächen als die einmal angelernte mähen, will dafür aber zum neuen Arbeitsort getragen werden. Das Husqvarna-Modell fährt selbstständig per angelerntem Pfad zu anderen Flächen, der Worx Vision kann das immerhin (zumindest theoretisch …) mittels einer veralteten RFID-Scheibe im Boden. Mehr dazu gibt es im jeweiligen Testbericht.
Dank des schwimmend gelagerten Mähwerks passt sich die Mähscheibe flexibel an Bodenunebenheiten an. Das Schnittbild war in unserem Test gleichmäßig und ohne vergessene Stellen. Die Schnitthöhe lässt sich über ein Drehrad am Gehäuse in 5-Millimeter-Schritten von 30 bis 60 Millimeter einstellen. Eine elektronische Verstellung per App wie bei manchen Konkurrenzmodellen gibt es nicht. Auch die Ausrichtung der Bahnen darf der Nutzer nicht vorgeben, das macht der Mäher eigenständig. In der Praxis ist beides aber verschmerzbar.
Wie gut ist die Objekterkennung des Ecovacs GX-600?
Die Kamera an der Front in Kombination mit einem ToF-Sensor (Time of Flight, Entfernungsmesser) und KI-Algorithmen dient nicht nur der Flächenerkennung, sondern auch als Sicherheitsfeature. Zusammengefasst unter dem Begriff AIVI 3D werden bewegliche und statische Objekte wie Spielzeuge, Tiere oder Gartenmöbel zuverlässig erkannt und umfahren.
Unsere Igel-Attrappe wurde wie bei den G1-Modellen verlässlich umkurvt. Wie immer gilt aber: Auch wenn die Sicherheitsfunktionen zuverlässig arbeiten, sollte der Mäher nicht unbeaufsichtigt in der Nähe von spielenden Kindern oder Haustieren und ebenfalls nicht in der Dämmerung oder Nacht eingesetzt werden.
Wie lang hält der Akku des Ecovacs GX-600?
Der Akku im Ecovacs Goat GX-600 hat eine Kapazität von 4000 Milliamperestunden. Das ist nicht übermäßig viel, entsprechend muss der Mäher etwa alle 80 Quadratmeter zurück zum Laden. Da das Nachladen einige Stunden dauert, benötigt der GX-600 für die namensgebenden 600 Quadratmeter Maximalfläche tatsächlich etwa zwei Tage.
Preis & Alternativen: Was kostet der Ecovacs GX-600?
Mit einer unverbindlichen Preisempfehlung von 1299 Euro gehört der Ecovacs Goat GX-600 preislich zu den günstigeren Mährobotern ohne Begrenzungsdraht, allerdings ist er für vergleichsweise kleine Flächen ausgelegt und bietet weniger Funktionen als andere Modelle. Positiv: Ecovacs gewährt 3 Jahre Garantie auf den Mäher sowie 2 Jahre auf den Akku. Der Ecovacs Goat GX-600 kostet zum Testzeitpunkt 1299 Euro bei Amazon. Inzwischen ist das Modell allerdings ausverkauft. Sein Nachfolger ist der Ecovacs Goat O500 Panorama, der gerade für 800 Euro im Angebot ist.
Direkte Alternativen sind die bereits angesprochenen Modelle Einhell Freelexo Cam 500 (Testbericht) und Worx Vision (Testbericht) – beide benötigen keine relevante Einrichtung und erkennen über ihre Kameras die Rasenfläche selbstständig. Etwas mehr für sogar weniger Geld oder gleiches können die beiden Segway-Modelle Navimow i105E und i108E (Testbericht). Hier haben Nutzer deutlich mehr Eingriffsmöglichkeiten, müssen dafür im Gegenzug bei der Ersteinrichtung einmalig die Mähfläche mit Smartphone und Mähroboter abfahren.
Fazit
Der Ecovacs Goat GX-600 richtet sich an Besitzer möglichst übersichtlicher Gärten mit klaren Grenzen an den Rändern und nur einer einzelnen Rasenfläche. Ohne deutliche Grenzen kann sich der Mäher, der sich ausschließlich mittels seiner Kamera orientiert, theoretisch ins Beet verirren, auch wenn das in unserem Test bei nicht gerade optimalen Bedingungen nicht passiert ist. Einfacher (und dafür besser) geht es derzeit nicht: Station aufstellen, Roboter mit der App verbinden und schon geht es los mit der ersten Maht – schöne neue (kabellose) Zukunft!
Dafür haben Nutzer aber auch keine Eingriffsmöglichkeiten, wenn der GX-600 nicht das macht, was er von ihm erwartet. Eine Mähkarte zeigt der Roboter in der App nicht an, entsprechend auch keinen Mähfortschritt. Und auch, wenn der GX erstaunlich nah an Grenzen heranfährt, geht das von Hand angelernt besser. Dann kann der Mäher etwa so befehligt werden, dass er halb auf der Terrasse, halb auf dem Rasen fährt, um auch die Ränder komplett zu erwischen. Auch unter Sträucher will der GX-600 nicht fahren, stattdessen sieht er herabhängende Blätter als Hindernis. Außerdem bieten viele Konkurrenten die Option, mehrere Rasenflächen selbstständig zu mähen. Das kann der GX nur, wenn er händisch zu weiteren Grünflächen getragen wird.
Mammotion Luba AWD
Mammotion Luba AWD
ab 2199 EUR
Inzwischen gibt es einige Mähroboter ohne Begrenzungskabel, einige sind ziemlich gut. Der Luba AWD soll der Beste sein – aber stimmt das auch? Das zeigt der Test.
VORTEILE
- sehr schnell dank doppeltem Schnittteller
- toller Funktionsumfang der App
- starker Vierradantrieb, trotzdem keine Schädigung des Rasens
- guter Empfang per RTK
NACHTEILE
- App könnte intuitiver sein, derzeit kein Randschnitt von Aussparungen
Mammotion Luba AWD 3000 im Test
Inzwischen gibt es einige Mähroboter ohne Begrenzungskabel, einige sind ziemlich gut. Der Luba AWD soll der Beste sein – aber stimmt das auch? Das zeigt der Test.
Mähroboter ohne Begrenzungsdraht beseitigen das typische Problem des Kabel-Verlegens und sollen so das Leben erleichtern. Dabei werden Probleme, die drahtgebundene Rasenroboter nicht haben, gerne mal verschwiegen. Gemeint sind fehlende Software-Features wie die Anpassbarkeit der Mähkarte oder Probleme bei GPS-Empfang und Randschnitt. Das zeigen unsere Tests der Mähroboter Ecovacs Goat G1 (Testbericht), Ecoflow Blade (Testbericht), Marotronics Alfred (Testbericht) und Worx Landroid Vision (Testbericht).
Der neue Mammotion Luba AWD 3000 soll alles besser machen, da sind sich diverse Internet-Foren einig und Youtuber schwärmen geradezu von dem chinesischen Mähroboter. Nur die Fähigkeit, dank Vierradantrieb auf der Hochachse zu wenden, sehen manche hier kritisch. Wir wollten wissen, was davon wirklich stimmt und haben den Mähroboter im Design eines Rennwagens ausführlich getestet.
Ein kurzes Wort zu Mammotion. Informationen zum chinesischen Unternehmen sind schwer zu finden. Das Unternehmen wurde erst Anfang 2022 gegründet und besteht nach Angaben des Herstellers aus über 150 Mitarbeitern, die zuvor bei anderen großen Robotik- und UAV-Unternehmen gearbeitet haben sollen. Mammotion scheint ein Nachfolgeunternehmen von Agilex Robotics zu sein, das sich sieben Jahre lang auf Roboter-basierte Chassis-Hardware und Selbstfahr-Algorithmen spezialisiert hatte. Mammotion hält nach eigenen Angaben über 240 Patente auf diesem Gebiet.
Design
Design eines Rennwagens? Tatsächlich sieht nach dem Ecoflow Blade (Testbericht), der eher an einen Mond-Buggy aus einem Sci-Fi-Film erinnert, auch der Mammotion Luba AWD 3000 nicht wie ein typischer Rasenmäher-Roboter aus. Mit etwas Fantasie erinnert er an ein komplett weißes Formel-Fahrzeug – wenn auch an ein etwas pummeliges. Der vordere Bumper ist dabei der Frontspoiler, die Räder vorn und hinten sind freiliegend, im Gegensatz zum Ecoflow Blade ist das Chassis des Wagens aber zwischen den Achsen wie bei einem Auto wieder breit gezogen. An den Vorderrädern sieht man zudem die Federbeine, mit denen der Luba versucht, die Räder möglichst gut auf den Boden zu bekommen – auch in schwierigem Gelände. Dabei handelt es sich aber nicht wie zuerst gedacht um eine Einzelradaufhängung, sondern die Vorderräder hängen an einer starren Achse.
Einen Heckspoiler gibt es nicht, stattdessen findet man einen kleinen Bürzel hinter dem großen, roten Stopp-Button vor, der zentral auf der Oberseite angebracht ist. Darunter verbergen sich geschützt USB-Anschluss, Einsteckplatz für den Betriebsschlüssel, IR-Sensor und die Ladekontakte. Der USB-Port ist dabei nicht für Updates, sondern Fehlersuche und Debugging seitens des Herstellers gedacht. Der IR-Sensor dient zum „Einparken“ in die Ladestation. In der Nähe des Stopp-Buttons gibt es noch einige Bedientasten zum Starten und die Rückkehr zur Ladestation. Die hintere Achse ist nicht gefedert.
Alle Bilder zum Mammotion Luba AWD 3000 im Test
Neben dem Frontbumper gibt es an den Seiten vermeintlich je einen weiteren Stoßfänger, damit der Roboter beim Drehen (was er voreingestellt maximal wie hinterradgetriebene Roboter um die hintere Achse macht) nicht seitliche Hindernisse umrempelt. Klingt logisch, im Test stellte sich aber heraus, dass diese Sensoren offenbar nicht verwendet werden. Hinten gibt es keine Sensoren, wohl aber oben. Denn dort befinden sich noch zwei nach vorn gerichtete Ultraschallsensoren, jeweils einer davon ist seitlich nach schräg vorne ausgerichtet. Die Sensoren sollen dem Luba dazu verhelfen, Hindernisse in seinem Fahrtweg auch ohne Berührung frühzeitig zu erkennen. Kurz vor den Hinterrädern gibt es zudem auf beiden Seiten je ein rotes LED-Licht, das normalerweise aus ist, auf Wunsch durchgehend leuchtet und bei eingeschränkter GPS-Empfang blinkt, wenn der Empfang zu schwach zum Weitermähen ist.
Die Hinterräder der deutschen Version bestehen aus Gummi und weisen ein breites Stollenprofil auf, das sich quer zur Fahrtrichtung erstreckt. Die ebenfalls angetriebenen Vorderräder (AWD – All Wheel Drive – Vierradantrieb) der drei Luba-Modelle AWD 1000, AWD 3000 und AWD 5000 haben vorn stattdessen omnidirektionale Räder aus Kunststoff. Sie bestehen ähnlich wie beim Ecoflow Blade (Testbericht) im Prinzip aus dicken, zu einem Rad geformten Drähten, auf die kleine geriffelte, frei drehbare Rohrstückchen aufgezogen sind. Damit rollen diese Räder beim Geradeausfahren sowohl in Fahrtrichtung als auch beim Drehen um die Hinterachse in eine 90 Grad dazu versetze Richtung – omnidirektional eben.
Kurven fährt der Mammotion Luba AWD 3000 – obwohl er wie ein Auto aussieht – nicht durch Einlenken der Vorderachse, sondern dadurch, dass er wie ein Panzer die Räder einer Seite langsamer als die der anderen Seite bewegt. Wer möchte, kann den Luba über die App so einstellen, dass er beim manuellen Steuern sogar im Stand eine Seite nach vorn und die andere genauso schnell nach hinten antreibt – dann wendet er auf der Stelle oder wie bereits erwähnt um die Hochachse. Voreingestellt dreht er aber im manuellen Betrieb so, dass die Hinterachse gedacht das Zentrum eines Kreises ist und die Vorderräder die Außenlinie eines von oben betrachteten Kreises bilden – so wie zweiradangetriebene Roboter. Im Automatik-Betrieb selbst dreht er tatsächlich gar nicht auf der Stelle, sondern durch wiederholtes vor- und zurücksetzen. Für England gibt es übrigens noch eine Version mit vier Gummirädern. Die weisen dann vorn ein um 45 Grad nach innen gedrehtes Profil auf, hinten ein nach außen gedrehtes im gleichen Winkel. Das soll vermutlich Beschädigung des Rasens bei Hochachswendungen minimieren.
Spannend ist noch ein Blick unter den Luba. Denn hier erwarten den Käufer nicht ein, sondern gleich zwei nebeneinander liegende Mähteller. Die verhelfen den Lubas zu stolzen 40 Zentimeter Schnittbreite – fast doppelt so viel wie bei den meisten Konkurrenten. Damit verspricht der Hersteller eine gemähte Fläche von bis zu 350 m² (500 m² beim AWD 5000) pro Stunde – schneller ist auf dem Papier kein von uns getesteten Mähroboter ohne Begrenzungsdraht. Ebenfalls klasse: Die Schnitthöhe lässt sich sogar von 30 bis 70 Millimeter einstellen. Bei fast allen Konkurrenzprodukten sind nur 30 bis 60 Millimeter möglich. Das geschieht elektronisch in der App und erlaubt dem Rasen im Sommer dank höherer Halmhöhe mehr Wasser zu speichern. Besser ist hier nur der Ecoflow Blade (Testbericht), auf dem Papier kann er sogar eine Maximalhöhe von 80 Millimeter schneiden. Im Test zeigte sich aber schnell, dass die angegebenen 80 Millimeter eher 60 bei der Konkurrenz entsprechen. Dank Vierradantrieb mähen die Lubas auch Hänge bis zu 65 Prozent (33 Grad) Steigung, das 5000er-Modell laut Hersteller sogar bis 75 Prozent oder 37 Grad.
Übrigens: Wem das Weiß des Luba zu schnöde ist, darf auf Aufkleber des Herstellers für schlappe 45 Euro zurückgreifen und so den Racer-Look noch intensivieren. Alternativen bietet unser Artikel Praktisch & kurios: Zubehör für Mähroboter von Rallystreifen bis Roboter-Garage.
Einrichtung
Im Lieferumfang des Mammotion Luba sind die typischen Zutaten enthalten – Roboter, Ladestation, ein zusammenschraubbarer Stab mit Erdspießen zum Befestigen der GPS-Antenne sowie die Antenne selbst. Mit einigen Erdnägeln aus Kunststoff soll die Ladestation am Boden befestigt werden und es gibt sogar Befestigungsmaterial wie Schrauben und Dübel, falls die Antenne nicht wie normalerweise angedacht auf dem Stab direkt an der Ladestation befestigt werden soll, sondern an einer Wand. Dafür legt Mammotion sogar ein eigenes Netzteil samt 10 Meter Verlängerungskabel bei, einen entsprechenden Haken müssen sich Nutzer aber mit dazubestellen. Die anderen bislang von uns getesteten Modelle mit Ausnahme des Marotronics Ardumower (Testbericht) verlangen zwingend eine Installation der RTK-Antenne (Real Time Kinematic) in direkter Nähe zur Ladestation. Beim Luba ist nur auf freien „Blick“ der Antenne in den Himmel zu achten, außerdem darf sie nicht mehr als 120 Meter entfernt vom geplanten Einsatzort des Mähers installiert werden.
Die Ladestation benötigt laut Hersteller 2 Meter freien Platz vor und neben sich, um einen störungsfreien Betrieb zu ermöglichen. Im Test stellte sich aber in erster Linie der freie Platz vor der Station als wichtig heraus. Im Gegensatz zu den anderen von uns getesteten Mährobotern ohne Begrenzungsdraht verlangt der Luba einen hinten eingesteckten Schlüssel, der grob an eine große Sicherung erinnert. Er verbleibt im Roboter, ein Ersatzschlüssel ist im Lieferumfang enthalten.
Mammotion-App
Die Mammotion-App ist ziemlich gut. Die Verbindung des Mähroboters mit dem Smartphone verläuft nach Erstellung des kostenfreien Accounts selbsterklärend und so, wie man es von einem Saugroboter gewohnt ist. Dabei unterstützt die App mit hilfreichen Bildchen bei der richtigen Installation von GPS-Antenne und Ladestation und schon nach kurzer Zeit kann es losgehen.
Der Nutzer landet bei jedem Neustart der App nach kurzem Ladebildschirm auf der Übersichtsseite, auf der der Nutzer im Hochformat alle gekoppelten Lubas und den nächsten zum Gerät gehörigen Mähauftrag findet. Das ist klasse und übersichtlich. Zudem sieht der Nutzer auf einen Blick den Namen des Gerätes samt passender Grafik, den Verbindungsstatus, hat Schnellzugriff auf einige Optionen und kann schnell und einfach verfügbare Updates anstoßen.
Alle Bilder zur App des Mammotion Luba AWD 3000
Für mehr Optionen und Steuerungsmöglichkeiten muss der Nutzer direkt auf das Gerät zugreifen, was nach dem ersten Einrichten der Mähzonen über den großen Button „Karte öffnen“ geschieht. Dann wechselt die App in den Quermodus und es dauert ein paar Augenblicke, in denen die App Karte und Interface lädt. Anschließend wird mittig die Mähkarte gezeigt, am oberen Rand gibt es wieder Hinweise zur Verbindung, ein Klick darauf erlaubt tiefere Einblicke in die Signalstärken von Bluetooth und GPS für Mäher und Antenne.
Zusätzlich zum Ladezustand des Mähers platziert Mammotion ganz oben rechts einen virtuellen Schaltknopf, über den Nutzer in weitere Einstellungen von Roboter und App gelangen. Darunter gibt es einen Button, um die Kartendarstellung auf den Mäher zu zentrieren und am unteren Display-Rand die großen Buttons zum Mähstart und Bearbeiten der Karte. Links gibt es dann noch zwei virtuelle Knöpfe, über die Benachrichtigungen und absolvierte Mähaufgaben eingesehen werden können. Zudem platziert der Hersteller im linken und rechten Display-Bereich noch zwei ausgegraute virtuelle Buttons, über die der Mähroboter manuell gesteuert werden kann. Obwohl sie ausgegraut erscheinen, sind sie immer aktiv und erlauben die manuelle Steuerung des Luba. Das gilt auch dann, wenn der Roboter gerade einen Mähauftrag absolviert oder man beim Vergrößern der Karte mit der Pinch-to-Zoom-Geste aus Versehen auf einen der beiden Joysticks kommt. Das ist nicht ganz optimal gelöst.
Der Button ganz oben rechts erlaubt Einstellungen für App und Roboter. Hier bestimmt der Nutzer etwa, ob er auch später noch Hinweise zur Bedienung erhalten will. Außerdem kann er die Geschwindigkeit des Roboters während der manuellen Steuerung anpassen. Voreingestellt ist hier ein Wert von nicht so langsamen 0,8 Metern pro Sekunde, über einen Schieberegler darf sie in 0,1-Meter-Schritten angepasst werden. Maximal sind 1,2 Meter pro Sekunde möglich (das sind 4,3 Kilometer pro Stunde). Das hat dann fast schon RC-Buggy-Qualitäten, zumindest fährt der Luba dann schneller, als ein Mensch normal geht.
Weitere Anpassungsmöglichkeiten: Die Maßeinheiten dürfen Nutzer von metrisch auf imperial umstellen und die Sprache der App anpassen. Wir haben Deutsch ausgewählt, bis auf wenige englische Worte und einige Hinweistexte ist alles weitgehend ordentlich übersetzt. In den Geräteeinstellungen darf der Besitzer bestimmen, ob der Mäher bei Regen fahren soll, die Karte löschen, die Wendeart des Roboters von „Zero turn“ auf „Multi-point-turn“ bei jedem Bahnende wechseln und die beiden Seitenlampen an- oder ausschalten. Außerdem wählt der Nutzer hier aus, ob der Luba bei der Rückkehr zur Ladestation einen direkten Weg nimmt oder sich an der Grenze der Mähfläche entlanghangelt.
Die App des Mammotion Luba AWD 3000 erlaubt viele Eingriffe in das Verhalten des Mähroboters, ist aber nicht immer sehr intuitiv TechStage.de
Den Funktionsumfang der App finden wir klasse, wir haben keine Funktionen vermisst. Einmal angelegte Mähflächen lassen sich nicht nur löschen oder neu anlegen, sondern auch anpassen. Das klappt wie bei Segway: Einfach im Edit-Modus an die Stelle fahren, an der die Grenze angepasst werden soll, die neue Grenze abfahren und speichern – fertig. Konkurrenten wie Ecovacs und Ecoflow können das bei Veröffentlichung dieses Tests immer noch nicht. Perfekt ist aber nicht alles gelöst. So finden wir die Struktur der App etwas ungeordnet und nicht unbedingt intuitiv. Wer etwa automatische Mähpläne erstellen will, sucht einen entsprechenden Menüpunkt vergeblich. Stattdessen muss der Nutzer zuerst auf den großen Mähen-Button klicken. Dann erscheint ein neues Fenster auf der rechten Seite, in dem wir den Arbeitsmodus einstellen dürfen (mehr dazu im nächsten Kapitel) und das Angaben zur Rasengröße und geschätzten Mähzeit parat hält. Hier dürfen wir dann tatsächlich auch einen Zeitplan erstellen. Das klappt schön detailliert, Nutzer dürfen die Mähhöhe, Tage, Uhrzeit und einiges mehr bestimmen. Aber das Verstecken der Funktion hinter dem Mähen-Button erscheint uns unpraktisch.
Außerdem gab es im Test einige Probleme mit der Darstellung zeitgesteuerter Aufträge: Sie verschwanden vereinzelt, wurden dann aber zur geplanten Uhrzeit doch ausgeführt und waren dann plötzlich auch wieder sichtbar. Zudem fehlte uns im Laufe des Tests immer wieder ein Heimkehr-Knopf – dachten wir. Den gibt es normalerweise unten am Display-Rand, wenn der Mäher automatisch mäht, nicht aber, wenn man den Luba manuell steuert. Wer also einfach mal das Kind im Manne (oder der Frau) herauslassen und aus Spaß mit der erstaunlich hohen Geschwindigkeit des Luba rumcruisen will oder gerade Änderungen an der Mähkarte vorgenommen hat, muss den weißen Flitzer entweder gleich ganz manuell einparken oder die Knöpfe auf dem Roboter benutzen. Erst später sahen wir, dass der Button für die Rückkehr zur Ladestation bei Bedarf auf der rechten Display-Seite eingeblendet wird – das halten wir für inkonsistent und nicht intuitiv. So etwas sind aber eher Kleinigkeiten, die schnell per Firmware-Update behoben werden könnten. Mehr gestört hat uns eine andere Sache, die sich negativ auf die Mähqualität auswirkt – sie betrifft Sperrflächen und ist ebenfalls eine Sache der Software. Mehr dazu im nächsten Abschnitt.
Navigation und Alltag
Die Einrichtung von Mähzonen funktioniert wie bei nahezu allen Konkurrenten ganz einfach: Die App erlaubt das Erstellen von Grenzen, Ausgrenzungen (etwa Beete innerhalb einer Rasenfläche) und Korridoren zum Verbinden von mehreren Mähzonen. Von letzteren versteht sich der AWD3000 im Test auf sechs, der kleinere AWD1000 auf drei und der AWD5000 auf zehn. Um Grenzen und Ausgrenzungen zu erstellen, muss der Nutzer mit dem Luba und dem Smartphone als Fernsteuerung die Grenzen abfahren – fertig. Wichtig ist hierbei wie bei der Konkurrenz und auch schon bei der GPS-Antenne eine gute Verbindung zu den GPS-Satelliten. Schlechte Verbindung zeigt der Luba durch blinkende Positionslampen links und rechts auf dem Chassis an, dann lohnt eine kurze Pause, bis die Verbindung wieder stabil ist. Ansonsten fährt der Mähroboter später ungenau und nicht so, wie der Nutzer es sich vorgestellt hat.
Wurde alles richtig eingerichtet, fährt der Luba AWD3000 nahezu perfekt seine Mähflächen ab. Nach dem Anwählen der zu mähenden Zonen durch einfaches Antippen öffnet sich wieder das zuvor bereits erwähnte Fenster mit Informationen zur Mähfläche und der angedachten Mähzeit. Unter anderem hat der Nutzer hier die Wahl zwischen vier Vorgaben, wie genau der Mäher vorgehen soll. Die Vorgaben heißen „Hohes Gras“, „Konventionell“, „Fein“ und „Anpassen“, sie unterscheiden sich in Bahnenüberlappung, Fahrgeschwindigkeit, der Bypass-Strategie, dem Navigationsmodus, Randmähen und Bahnenwinkel. „Anpassen“ erlaubt dem Nutzer dabei manuellen Zugriff auf all diese Punkte. Wer sich einmal mit den einzelnen Optionen im „Anpassen“-Modus beschäftigt hat, wird die anderen Modi selbsterklärend finden. So senkt „Hohes Gras“ etwa die Fahrgeschwindigkeit, sorgt für mehr Überlappung und deaktiviert die Ultraschallsensoren. „Konventionell“ hingegen setzt auf hohe Geschwindigkeit, einfaches Bahnenziehen und aktive Ultraschallsensoren, während „Fein“ etwa doppeltes Mähen der Fläche längs und quer beinhaltet.
Die spannendsten Punkte sind Randmähen und Bypass-Strategie. Beim Randmähen dürfen Besitzer des Mammotion Luba AWD3000 festlegen, ob und wie oft der Mähroboter vor oder nach dem Mähen der Fläche den Rand mit zunehmendem Abstand zur virtuellen Grenze abfahren soll. Die Konkurrenz fährt grundsätzlich einmal die Grenzen ab. Die Bypass-Strategie erlaubt Einflussnahme darauf, wie vorsichtig der Luba navigiert. Ist sie auf null gesetzt, verlässt sich der Luba ausschließlich auf seinen vorderen Bumper. Entsprechend fährt er mit voller Geschwindigkeit vor Hindernisse und umfährt sie erst dann. Auf Eins nutzt der Mäher seine Ultraschallsensoren, um bei erkannten Hindernissen die Geschwindigkeit zu reduzieren und dann langsam bis zur Bumper-Auslösung oder zur virtuellen Grenze vorzufahren. Das ist hilfreich, wenn etwa Büsche und andere Pflanzen vom Rand aus in die Mähfläche ragen. Der Luba erkennt das zwar, fährt dann aber trotzdem mit verlangsamtem Tempo weiter und mäht so auch unter solchem Überhang. Modus Zwei hingegen sorgt dafür, dass der Rasenroboter überhängende Pflanzen als festes Hindernis ansieht und ohne Berührung umfährt. Solch eine Auswahl fehlt Konkurrenten wie dem Ecovacs Goat G1 (Testbericht), der daher unter in die Mähfläche ragendem Bewuchs nicht mäht.
Und wie verhält sich der Mammotion AWD 3000 nun im Alltag? Perfekt wäre übertrieben, denn auch der weiße Flitzer aus Fernost kann die typischen Probleme von RTK-Mähern nicht ganz eliminieren. So verliert auch er irgendwann eine ausreichende Verbindung zu den Satelliten und wird dann ungenau, wenn er unter dichtem Blattwerk oder an Engstellen zwischen Haus und Büschen mähen soll. Dann hält er inne, bis das Signal wieder hergestellt ist. Das dauert meist kürzer als bei der Konkurrenz. Zuvor toleriert er allerdings ebenfalls eine gewisse Ungenauigkeit. Das kann dann wie bei den Wettbewerbern zu ungewollten Ausflügen mit einem oder zwei Rädern ins Beet führen, obwohl er eigentlich auf den Randsteinen fahren sollte. Aber er macht das noch etwas seltener als unsere bisherige Nummer Eins, der Segway Navimow (Testbericht). Und wegen des Vierradantriebs kann er sich anschließend auch wesentlich häufiger als alle Zweirad-Kontrahenten wieder freifahren. Dabei ramponiert er normalerweise auch weder Rasen noch Beet – auch das ist etwas, was die Wettbewerber nicht von sich behaupten können. Innerhalb der Mähfläche sehen wir ebenfalls das geringste Beschädigungspotenzial des Rasens. Denn dank der vier angetriebenen Räder gibt es selbst bei feuchtem Gras selten durchdrehende Räder – und wenn, dann immer nur sehr kurz. Und wer Angst vor den Wendemanövern des Luba hat, darf beruhigt sein. Der Roboter kann zwar theoretisch auf der Hochachse wenden, tut das aber im Betrieb nicht. Stattdessen setzt er bei jeder engeren Drehung mehrfach vor und zurück – ähnlich wie eine Mehrpunktwendung beim Auto.
Die Navigation ist also nahezu optimal, der Luba fährt schnurgerade, sich überlappende Bahnen, deren Ausrichtung noch dazu in 10-Grad-Schritten bestimmt werden dürfen. Dabei mäht der Luba AWD 3000 mit enorm kräftigem Motor, der weder bei dichtem Gras noch anderem Bewuchs nennenswert an Kraft verliert. Das kann auch ein Verdienst des 10-Ah-Akkus sein, den AWD5000 und AWD3000 haben, der AWD1000 bietet nur einen Kraftspender mit 4,5 Ah. Das anschließende Schnittbild ist klasse, Rasenhalme werden sauber und gleichmäßig geschnitten und nicht gerupft. Auch am Rand bleibt wenig stehen. Ganz randlos mäht zwar auch der Luba nicht, etwa 5 Zentimeter fehlen im Schnitt bis ganz nach außen. Das schafft aber derzeit kein Mähroboter ohne Begrenzungsdraht. Stark ist dafür das Manövrieren am Hang selbst bei feuchtem Gras. Dank des Vierradantriebs rutscht der Luba AWD 3000 nicht unkontrolliert herum und hat fast immer Grip. Das macht derzeit niemand in dieser Preisklasse besser.
Mammotion Luba AWD 3000 - die breite Schnittbreite dank zweier Mähteller sorgt für hohe Arbeitsgeschwindigkeit TechStage.de
Einen kleinen Preis müssen Besitzer des Mammotion-Mähroboters aber für die hohe Schnittbreite dank zweier Mähteller und den kräftigen Motor bezahlen: Der Luba AWD 3000 ist zwar nicht laut, aber durchaus vernehmbar. Er produziert dabei ein Geräusch wie ein elektrischer Handmäher – als ein konstantes Rauschen, nur eben leiser. Mammotion spricht von bis zu 60 Dezibel, wir haben auf Rasen rund 53 Dezibel in einem Meter Abstand gemessen. Tatsächlich steigt der Geräuschpegel auf hartem Untergrund – etwa, wenn der Luba zwischen zwei Zonen einen Steinweg befährt – hörbar an. Modelle wie Segway Navimow (Testbericht) und Worx Landroid Vision (Testbericht) sind hier klar leiser. Wie die genannten Modelle piepst der Luba übrigens nur, um sich zu verständigen. Sprachausgabe gibt es nicht.
Die größte Fehlstelle der aktuellen Software (und es kamen im Test gleich zwei Updates herein) ist jedoch das Abfahren von Rändern bei Ausgrenzungen. Denn das macht der Luba schlicht und ergreifend nicht. Stattdessen hält er mit den Mähbahnen den gleichen Abstand wie bei Außengrenzen, die er dort aber zuvor abgefahren ist. Als Resultat bleibt bei Abgrenzungen innerhalb einer Mähfläche immer deutlich zu viel Rasen stehen, hier sollte Mammotion schnellstens nachbessern! Ebenfalls Luft nach oben hat der Luba beim Ausweichen von Hindernissen, wenn der Bumper ausgelöst wurde. Er folgt anschließend immer dem gleichen Muster und umfährt das scheinbare Hindernis mit rund einem Meter Abstand im Quadrat – selbst, wenn er einfach nur einen Zentimeter zu weit an eine Wand herangefahren ist. Und eine andere Sache stört uns und die betrifft leider Hard- und nicht leicht anpassbare Software: Im Laufe des Betriebs setzt sich feiner Grünschnitt zwischen Mähteller und Klingen, sodass die nicht mehr abklappen, sobald sie auf etwas Hartes treffen, sondern starr nach außen gerichtet verbleiben. Das lässt sich derzeit nur durch regelmäßige Reinigung beheben, hier ist die Konkurrenz weniger wartungsintensiv. das Schnittbild hat das aber nicht beeinflusst.
Toll ist wiederum die Mähgeschwindigkeit und Flächenleistung pro Stunde. Für den AWD 3000 gibt Mammotion 350 m² pro Stunde an, beim AWD5000 sind es angeblich sogar 500 m². So schnell ist keiner der von uns bislang getesteten Mähroboter ohne Begrenzungsdraht. Ein Teil des Geheimnisses dürfte die hohe Schnittbreite sein. Mit diesem Speed schaffte der Luba beim uns im Test bei einer Rasenfläche von rund 450 m² verteilt auf fünf Zonen in etwa 1,5 Stunden bei einfachen Bahnen. Unter drei Stunden waren es bei einem Schachbrettmuster. Dabei nutzt der Luba auch nahezu seine komplette Akkukapazität aus und fährt dann mit 20 Prozent Restleistung zurück zur Ladestation. Dort lädt er dann rund zwei Stunden und würde anschließend bei 85 Prozent Akkuleistung wieder selbstständig losfahren, wenn noch mehr zu mähen wäre.
Hinten gibt es breite Gummireifen mit Profil (Bild), vorne omnidirektionale Räder aus Kunststoff TechStage.de
Zum Thema Sicherheit gilt das Gleiche, was auch für andere Mähroboter gilt: Eigentlich nicht unbeaufsichtigt fahren lassen, schon gar nicht nachts oder in der Dämmerung. Denn natürlich stoppt der Luba, wenn er angehoben wird. Allerdings setzt er den Betrieb fort, sobald man ihn wieder absetzt. Bei Auslösung des Bumpers stoppt er ebenfalls und weicht aus. Bei Igel, Schlange, Kröte oder gar einem Kinderarm, der unter den Mäher gerät, kann das aber unter Umständen nicht reichen! Gegen Diebstahl soll eine Echtzeit-Diebstahlüberwachung per GPS zum Einsatz kommen und den Nutzer per App warnen, wenn der Roboter aus dem Bereich der Mähflächen entfernt wird. Im Test hat das allerdings nicht funktioniert und es ist uns auch schleierhaft, wie das ohne GSM-Modul klappen soll. Wir konnten den Roboter aus dem laufenden Betrieb per Stopp-Taste in den Kofferraum unseres Autos laden und einfach wegfahren. Eine Benachrichtigung beim ersten Verlassen der Mähzone oder später eine Diebstahl-Message bekamen wir nicht.
Preis und Garantie
Mammotion bietet die Luba-Modelle seit Neuestem auch bei Amazon an und hat inzwischen bereits die Modelle für 2025 vorgestellt, die man an einem x in der Produktbezeichnung erkennt. Tests der neuen Reihe folgen in Kürze. Das von uns getestete 2024er-Modell Luba AWD 3000 gibt es nun reduziert zum Preis von 2209 Euro.
Im Shop des Herstellers sind nur noch die 2025er-Modelle zu folgenden Preisen verfügbar:
Ein Problem könnte es allerdings im Garantiefall (Mammotion bietet zwei Jahre) geben, andere Medien berichten sogar, dass Nutzer für eventuelle Schadensfälle durch ihren Luba persönlich haftbar gemacht werden könnten. Grund ist das Vertriebsmodell von Mammotion. Denn während alle anderen von uns bislang getesteten Hersteller ihre Geräte offiziell in Deutschland verkaufen oder – wie im Falle von Segway – einen Generalimporteur haben, der dann als Inverkehrbringer fungiert, ist das bei Mammotion anders. Denn auch wenn die Website des Herstellers groß mit „Mammotion Germany“ überschrieben und auf Deutsch ist, findet sich dort kein Impressum. Zwar sehen wir hier kein Haftungsproblem im Sach- oder Personenschadensfall, aber für Kontaktanfragen und Problemlösungen sind dort nur eine chinesische Telefonnummer und mehrere E-Mail-Adressen zu finden. Das sollten Kaufinteressenten im Hinterkopf behalten. Sie sind hier auf den Goodwill des chinesischen Herstellers angewiesen, rechtlich bleibt europäischen Nutzern keinerlei Handhabe.
Update: Seit dem Verkauf durch Amazon sehen wir kein großes Problem mehr.
Update 2: Auf Anfrage einer aufmerksamen Leserin teilte Amazon mit, dass Amazon nur als Verkaufsplattform auftritt und Verkäufer weiterhin Mammotion ist. Zwar ist hier in den ersten 30 Tagen dank Unterstützung seitens Amazon bei Nichtgefallen oder sonstigen Problemen mit dem Mäher nicht mit Schwierigkeiten bei der (Rück)abwicklung zu rechnen. Danach bleibt aber weiterhin nur Hersteller Mammotion direkt in China bei Defekt oder anderen Problemen.
Fazit
Der Mammotion Luba AWD 3000 gehört zweifellos zu den besten Mährobotern ohne Begrenzungsdraht. Das liegt am tollen Gesamtpaket, den die Modelle bei angemessenem Preis bieten. Zwar kann der weiße Flitzer die typischen RTK-Probleme nicht ganz beseitigen, löst sie aber etwas insgesamt besser als die Konkurrenz – kein anderes Modell hat so starken GPS-Empfang. Hinzu kommt tolle Hardware mit hoher Schnittbreite und kraftvollem Mähantrieb, starkem Vierradantrieb und toller Software. Die benötigt zwar noch etwas Feinschliff bei der Benutzerführung und derzeit fehlt ein gezielter Randschnitt bei Ausgrenzungen, der Rest funktioniert aber schon jetzt richtig gut.
Ein echter Leisetreter ist der Luba aber nicht und auch eine Benachrichtigung bei Diebstahl haben wir nicht bekommen. Zudem bleibt das Problem, dass der Hersteller ausschließlich in China sitzt. Davon abgesehen sind die Lubas aber ein beeindruckendes Stück Technik. In unserer Themenwelt Mähroboter haben wir neben kabelgebundenen Geräten zuletzt auch viele Modelle ohne Begrenzungsdraht getestet. Größter Konkurrent für die Lubas ist unserer Meinung nach aktuell der Segway Navimov (Testbericht). Das spiegelt sich auch in unserer Topliste zu Mährobotern ohne Begrenzungsdraht wider. Was solche Modelle generell können sollte und welche es noch gibt, verrät unser Ratgeber Husqvarna, Ecovacs & Co.: Das können Mähroboter ohne Begrenzungsdraht.
Ecovacs Goat G1 800
Ecovacs Goat G1 800
ab 789 EUR
2023 kam der Mähroboter Ecovacs Goat G1 mit Navigationsbaken auf den Markt, ein Jahr später folgt nun der Goat G1 800. Wir klären im Test, was sich beim neuen Modell verändert hat.
VORTEILE
- mäht und navigiert smart und gut
- kommt ohne GPS und Begrenzungsdraht aus
- grundsätzlich gute App
NACHTEILE
- immer noch keine Anpassung der Mähkarte möglich
- keine Weiterentwicklung zum Vorjahresmodell
Auch ohne GPS – Ecovacs Goat G1 800 im Test: Mähroboter ohne Begrenzungsdraht
2023 kam der Mähroboter Ecovacs Goat G1 mit Navigationsbaken auf den Markt, ein Jahr später folgt nun der Goat G1 800. Wir klären im Test, was sich beim neuen Modell verändert hat.
Der Rasenroboter Ecovacs Goat G1 (Testbericht) aus dem vergangenen Jahr hat absolut seine Qualitäten. Er mäht ohne lästiges Verlegen von Begrenzungsdraht, lässt sich als mobile Überwachungskamera einsetzen und schlägt bei Erkennen einer Person Alarm. Außerdem sorgte seine Navigation per Signalbaken dafür, dass er auch dort mähen kann, wo GPS-Mäher Probleme bekommen. Zumindest in der Theorie, denn in der Praxis benötigen Gärten, in denen schlechter GPS-Empfang aufgrund von Bäumen oder Gebäuden herrscht, eine recht hohe Anzahl dieser Signalbaken. Das geht schnell ins Geld. Zudem störte uns, dass es in der App zum Mähroboter keine Möglichkeit gab, eine einmal eingerichtete Mähzone später erneut anzupassen.
Rund ein Jahr später bringt der Hersteller neue Modelle auf den Markt, nämlich Goat G1 800 und Goat G1 2000. Später folgt noch einmal ein Modell (GX 600), das mit besonders einfacher Einrichtung und Handhabung punkten soll – ähnlich wie Worx Vision (Testbericht) und Einhell Freelexo Cam 500 (Testbericht). Wir wollten im Test wissen, wie sich das neue Modell G1 800 im Vergleich zum Vorgänger schlägt.
Was sind die Highlights beim Ecovacs Goat G1 800?
- kein Begrenzungsdraht nötig
- übersichtliche App
- gehört zu den günstigeren Modellen
- mäht gut
Die UVP des Herstellers für den Ecovacs Goat G1 800 liegt bei 1099 Euro, das ist auch der aktuelle Straßenpreis.
Wie sieht der Ecovacs Goat G1 800 aus?
Machen wir es kurz: Der neue Goat G1 800 sieht genauso wie der „Vorgänger“ aus. Entsprechend gibt es wieder eine nach vorn gerichtete Weitwinkelkamera, vorn oben eine kugelförmige Rundumkamera, dahinter unter einer Abdeckung ein Bedienfeld, die obligatorische rote Stopptaste und eine Stummelantenne.
Neu ist die Farbe: Zwar gibt es das Modell auch wieder in Weiß, wahlweise aber in einem hellen Grauton. Bei der weißen Version ist Dunkelgrau statt Schwarz die Kontrastfarbe und im Gegensatz zum Modell aus 2023 sind die „Felgen“ der hinteren großen Antriebsräder nun in Weiß statt Schwarz gehalten. Der Rest ist gleich, auch an der ordentlichen Verarbeitung hat sich nichts geändert. Mehr Informationen zum Design verrät unser Test zum Ecovacs Goat G1 (Testbericht).
Wie funktioniert die App beim Goat G1 800?
Die Einrichtung erfolgt genauso wie beim Vorjahresmodell, die App führt den Nutzer Schritt für Schritt durch Installation und Positionierung von Ladestation und Signalbaken. Tipps und Einschränkungen bei der Positionierung und Kopplung der Navigationssender haben wir im Test des Goat G1 (Testbericht) ausführlich gegeben, an denen hat sich nichts geändert. Das gilt auch für die App, die weiterhin mit einer für unseren Geschmack unnötigen Zweiteilung des Hauptmenüs daherkommt, wie wir an dieser Stelle des Testberichts ausführlich dargelegt haben.
Anschließend geht es ans Anlernen der Testfläche, an deren Anschluss auch beim 800er-Modell eine selbstständige Erkundungsfahrt des Mähroboters folgt. Wie das genau funktioniert, haben wir bereits hier detailliert erklärt. Unterschiede in der Funktion des Rasenroboters gibt es so gut wie gar nicht, außer dass er nun 800 m² statt 1600 m² in zwei Tagen mähen kann.
Während es in den meisten Punkten gut ist, dass sich so gut wie nichts verändert hat, stört uns das bei einem Punkt ganz enorm. Denn wie beim Vorgänger dürfen Nutzer auch beim neuen Modell nicht nachträglich die Mähkarte anpassen, sondern müssen sie stattdessen löschen und komplett neu anlernen. Das gilt auch für den Fall, dass jemand für besseren Empfang nachträglich weitere Navigationssignale anlernen möchte – das klappt ebenfalls nur mit Löschen und neu Anlernen. Was 2023 schon gestört hat, da es auch da einige Konkurrenten wie Mammotion Luba (Testbericht) oder Segway Navimow (Testbericht) beherrscht haben, ist 2024 erst recht nicht nachvollziehbar und einfach ärgerlich.
Wie gut ist der Ecovacs Goat G1 800 im Alltag?
Das ändert aber nichts daran, dass Nutzer des G1 800 im Alltag zufrieden sein dürften. Denn dort zieht der Roboter wie der Vorgänger zuverlässig und exakt seine Bahnen, unterbricht bei Regen die Aufgabe und fährt nach Abschluss wieder zum Laden zurück zur Station. Hauptunterschied zum G1 aus dem Vorjahr ist hier wohl die Ladestation, die zwar (bis auf die Farbe) genauso aussieht, nun aber ohne die bewegliche Bürste auskommen muss, die beim ersten G1 vor jeder Fahrt durch mechanische Bewegung die obere 360-Grad-Kamera säuberte. Beim G1 800 ist die Bürste zwar noch da, aber unbeweglich.
Außerdem haben wir den Eindruck, dass das 800er-Modell insgesamt etwas lauter ist. Das betrifft mechanische Klappergeräusche, aber vor allem den Antriebsmotor bei Fahrt. Das Schneidwerk ist hingegen kaum hörbar. Ein großer Vorteil des Goat G1 800 ist nach wie vor der Umstand, dass er auch dort mähen kann, wo GPS-gesteuerte Modell entweder aufgeben oder ungenau werden. Sofern genügend Signalbaken aufgestellt sind, um eine gute Netzabdeckung zu gewährleisten, zieht der G1 auch in schwieriger Umgebung verlässlich seine Bahnen. Das kann aber teuer werden, schließlich kostet jede Bake knapp 100 Euro extra.
Weitere Informationen haben wir ausführlich im Test des Ecovacs Goat G1 (Testbericht) zusammengetragen.
Preis
Der Ecovacs Goat G1 800 ist ziemlich neu und daher ist der Preis zum Testzeitpunkt bisher nicht unter die UVP von 1099 Euro gefallen. Bei Amazon ist er schon jetzt ein Verkaufsschlager.
Fazit
Der Ecovacs Goat G1 800 ist etwas seltsam. Denn letztlich handelt es sich um den G1 (Testbericht) aus dem Vorjahr mit abgespeckter Mähgröße, wodurch er nur noch für 800 m² Rasen gedacht ist. Das ist grundsätzlich nicht schlecht, denn schon der erste G1 hat im Test überzeugen können und nicht jeder hat eine Grünfläche jenseits der 1000 m². Außerdem machen andere Anbieter das ähnlich und bringen das gleiche Modell in verschiedenen Ausführungen für unterschiedliche Rasengrößen. Bei der Konkurrenz kommen die dann aber mehr oder weniger zeitgleich auf den Markt – bei Ecovacs erst nach einem Jahr.
Das weckt die Hoffnung, dass es eine Weiterentwicklung gibt, doch die fehlt leider. Besonders, dass nachträglich immer noch keine Anpassung der Mähkarte oder ein nachträgliches Hinzufügen von Signalbaken möglich ist, finden wir stark kritikwürdig. Und dann wäre da noch der Preis. Den „alten“ G1 gab es immer wieder für 1399 Euro – das sind „nur“ 300 Euro mehr für doppelte Mähleistung. Das ändert nichts daran, dass auch der G1 800 ein guter Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht ist, der nicht auf ein oft zu schwaches GPS-Signal angewiesen ist. Aber hier müssen Nutzer genau hinschauen – oder gleich zur Konkurrenz greifen.
Einhell Freelexo Cam 500
Der Billigheimer
Einhell Freelexo Cam 500
ab 574.01 EUR
Mähroboter ohne Begrenzungsdraht sind teuer – eigentlich. Der Einhell Freelexo Cam 500 kostet in der UVP 1000 Euro und im freien Handel inzwischen deutlich weniger, aber kann der auch was?
VORTEILE
- extrem einfache Bedienung
- fehlerfrei im Test dank guter Kameraerkennung
- günstig für einen Mähroboter ohne Begrenzungskabel
NACHTEILE
- keine App, dadurch wenig Komfort
- kein Randschnitt
- fehlen von Funktionen
Einhell Freelexo Cam 500 im Test: Der günstigste Mähroboter ohne Begrenzungskabel
Mähroboter ohne Begrenzungsdraht sind teuer – eigentlich. Der Einhell Freelexo Cam 500 kostet in der UVP 1000 Euro und im freien Handel inzwischen deutlich weniger, aber kann der auch was?
Keine Frage: Mähroboter ohne Begrenzungskabel (Themenwelt) machen gerade bei der Einrichtung, aber auch später im laufenden Betrieb das Leben des Nutzers in vielen Bereichen deutlich einfacher. Aber sie sind dafür leider auch deutlich teurer als kabelgebundene Modelle – zu teuer vielleicht, wenn man neutral auf das Preis-Leistungs-Verhältnis schaut. Denn Kantenschnitt ist bei allen Modellen ein großes Thema, vor allem beim Worx Landroid Vision (Testbericht), außerdem gibt es unter Bäumen und Sträuchern und nahe am Haus unter Umständen Probleme mit der GPS-Genauigkeit. Tatsächlich tun sich die eigentlich viel schlaueren Boliden zudem gerade in engen, verwinkelten Gärten schwerer als ihre dummen Pendants mit Begrenzungsdraht.
Zumindest der Preis als Kritikpunkt geht beim Einhell Freelexo Cam 500 allerdings unter, zumindest fast. Denn mit einem Straßenpreis, der inzwischen unter der 900-Euro-Marke angekommen, ist der Rasenroboter ohne Begrenzungskabel kaum teurer als Markengeräte, die sich am vergrabenen Kupfer entlanghangeln. Dabei verlässt sich der Freelexo Cam dem Namen entsprechend hauptsächlich auf eine nach vorn gerichtete Kamera, benötigt aber zusätzlich doch einen Draht – wenn auch einen kurzen. Was genau das bedeutet und wie sich der Rasenmähroboter im Alltag schlägt, erläutern wir im Test.
Design
Der Freelexo Cam 500 kommt deutlich weniger wuchtig und auffällig als etwa der Mammotion Luba AWD 3000 (Testbericht) daher. Tatsächlich gehört er zu den optisch kleinsten und schmalsten Modellen ohne Begrenzungskabel und sein gesamter Auftritt ist eher konventionell ausgerichtet. Am auffälligsten sind hier noch die rot-schwarze Farbgebung, der Kamerabuckel vorn und die beiden Ultraschallsensoren, die seitlich auf der vorderen Oberseite hervorstehen. Ansonsten gibt es im Gegensatz zu Luba und Ecoflow Blade (Testbericht) ein geschlossenes Gehäuse mit darin integrierten Hauptantriebsrädern hinten und zwei Stützrädern vorn. Letztere bemerken etwa, wenn der Mäher angehoben wird und schalten dann das Schneidwerk aus.
Ansonsten installiert Einhell oben, wie gesetzlich vorgeschrieben, einen roten Notstopp-Knopf und davor die Abdeckung für das Bedienpanel. Geschickt: Die Abdeckung lässt sich nur öffnen, indem man die Stopp-Taste drückt. So ist sichergestellt, dass der Mäher deaktiviert ist, bevor Einstellungen wie die manuelle Höhenverstellung des Schneidwerks (20 bis 60 Millimeter) getätigt werden können. Hinten oben positioniert der Hersteller den Zugang für den wechselbaren Akku. Einhell setzt dabei auf seine Power-X-Change-Akkus, die auch in den Akku-betriebenen Gartenwerkzeugen des Herstellers und dem E-Scooter Elmoto Kick (Testbericht) Verwendung finden. Ein Akku mit 3,0 Ah ist im Lieferumfang enthalten, es passen aber auch stärkere. Damit sollte der Roboter dann auch größere Rasenflächen als die eigentlich angedachten 500 Quadratmeter mähen können.
Auffällig ist das weit nach unten gezogene Chassis des Freelexo Cam 500. Das dürfte zwar die Sicherheit erhöhen, da der Mäher auch niedrige Hindernisse mit dem Frontbumper berührt und umdreht oder den Mähvorgang abbricht, statt sie zu überfahren. Allerdings kann das auch zu Problemen bei unebenem Rasen führen. Insgesamt ist der Einhell Freelexo Cam 500 weniger spektakulär und hochwertig als seine kabellose Konkurrenz, wirkt aber trotzdem nicht billig. Grenzwertig finden wir dabei allerdings das einfache Folien-Feld für die Bedienung.
Einhell Freelexo Cam 500 im Test: Günstiger Mähroboter ohne Megrenzungsdraht im Test
Einrichtung
Ein großer Punkt, der bei allen anderen bislang von uns getesteten Mährobotern ohne Begrenzungsdraht erläutert werden musste, fällt beim Einhell Freelexo Cam 500 weg: die App. Denn der Roboter nimmt weder Verbindung zum heimischen WLAN-Netzwerk noch per Bluetooth zum Smartphones des Besitzers auf. Oder um es noch deutlicher zu machen: Es gibt keine App, der Roboter kann nur am Gerät bedient werden. Zur Einrichtung muss lediglich die Ladestation samt einer kleinen Kabelschleife installiert werden, schon kann es losgehen.
Die Ladestation benötigt vor und hinter sich wenigstens 1 Meter freie Bahn. Das Kabel muss rechteckig oder quadratisch so verlegt werden, dass es einen Flächeninhalt von 5 m² nicht unterschreitet. Am einfachsten ist es, das komplette Kabel aus dem Lieferumfang dafür zu verwenden, ohne es zu kürzen. Bei uns kam solch ein Quadrat mit knapp 3 Metern Kantenlänge heraus. Der Roboter benötigt dieses per Kabel eingefasste Feld für die exakte Rückkehr zur Ladestation. Die grobe Position der Station findet er anhand eingebauter GPS-Sensoren. Sobald er den Draht lokalisiert hat, fährt er daran bis in die Ladeposition weiter. Die eingebaute GPS-Antenne ist übrigens auch der Grund, warum die Station nicht nah an einem Haus oder runter einer Überdachung stehen soll. Zum Testen der fehlerfreien Rückkehr sollte der Roboter innerhalb der Schleife positioniert und per Tastenbefehl zur Station zurückgeschickt werden. Die Station selbst gibt per LED Auskunft darüber, ob eine Schleife angeschlossen ist. Eine LED am Roboter zeigt, ob die Positionierung des Roboters ausreichend genau ist. Laut Anleitung soll es wenige Minuten dauern, bis die GPS-Verbindung stark genug ist. Bei uns dauerte das wesentlich länger, hielt dann aber konstant an.
Sind Station sowie Schleife installiert und der Roboter geladen, kann es losgehen. Bei der ersten Fahrt überprüft der Roboter ohne laufendes Schnittwerk die Mähfläche. Dabei fährt er 200 Punkte an den Rändern ab, was theoretisch bis zu einer Stunde dauern kann. Sollte das nicht reichen, setzt der Freelexo Cam 500 seine Erkundung fort. Im Test klappte das problemlos, obwohl das Mähgebiet auf rund der Hälfte der Rasengrenzen keine eindeutige Begrenzung wie Randsteine aufwies – mehr dazu später.
Navigation und Alltag
Der Hinweis, dass der Einhell Freelexo Cam 500 keinerlei App-Steuerung bietet, deutet es schon an: Der Roboter bietet weniger Komfort als andere, besticht im Gegenzug aber mit seiner einfachen Bedienung. Denn ein Anlernen der Mähfläche erfolgt hier automatisch, außer der korrekten Platzierung der Ladestation samt Rückkehrschleife gibt es für den Nutzer nichts zu tun. Da ist es umso erstaunlicher, dass Einhell den Nutzer mit einem Handbuch erschlägt, das grundsätzlich bis ins Detail erklärt, was der Nutzer alles beachten muss und was der Roboter alles kann oder auch nicht. An anderer Stelle lässt man den Besitzer aber ratlos zurück. Gemeint ist ein essenzieller Bedienschritt, der jedes Mal erfolgen muss, sobald der Nutzer eine Eingabe am Roboter vornehmen will: die Eingabe des Sicherheitscodes als Diebstahlsicherung.
Denn hier erklärt das Benutzerhandbuch nur lapidar „Geben Sie […] die PIN langsam nacheinander ein und bestätigen Sie die Eingabe mit der Taste OK (Standard-PIN: 1-2-3-4)“. Was simpel klingt und es bei Vorhandensein eines Ziffernblocks auch wäre, ist beim Blick auf das einfache Bedienfeld des Einhell-Mähroboters aber maximal verwirrend. Denn die einzigen Tasten, die überhaupt Ziffern aufweisen, sind die Wahltasten für die Arbeitszeit pro Tag – und die sind mit 4H, 6H, 8H und 10H beschriftet. Wir vermuteten (davon ausgehend, dass eine PIN wie bei der Konkurrenz aus vier Ziffern zwischen 1 und 0 besteht) dann, dass diese vier Tasten vielleicht für die Eingabe vorgesehen wären, indem man die erste für den Code 1-2-3-4 1x drückt, die zweite 2x und so weiter. Das brachte aber keinen Erfolg. Letztlich gab erst ein sehr gutes Video von Einhell auf Youtube Aufschluss: Tatsächlich besteht die PIN lediglich aus vier Ziffern zwischen 1 und 4, wobei die Taste 4H für 1, 6H für 2 usw. steht – darauf muss man erst mal kommen! Hier spart Einhell schlichtweg am falschen Ende, denn einerseits wird (auch durch das an dieser Stelle mangelhafte Nutzerhandbuch) die Bedienung unnötig verkompliziert, außerdem sinkt die Kombinationsmöglichkeit für einen Dieb von 10.000 möglichen PIN-Kombinationen auf gerade einmal 256!
Der Rest der Bedienung gibt weniger Rätsel auf, nur für Sonderfälle ist ein Blick ins Handbuch nötig. Das gilt etwa dann, wenn der Freelexo Cam 500 nicht täglich fahren soll, sondern nur jeden zweiten Tag. Hierfür muss dann nämlich die jeweilige Zeitauswahl 6 Sekunden gehalten statt kurz gedrückt werden. Andere Zeitsteuerungsmöglichkeiten gibt es nicht. Oder wenn andere, mit dem Hauptrasen nicht zusammenhängende Flächen gemäht werden sollen. Dann muss der Nutzer den Roboter manuell auf die Zweitfläche tragen und zum Start des Mähvorgangs die Start-Taste 6 Sekunden drücken. Dadurch versucht der Mäher nicht vergeblich, zur Ladestation zurückzukehren, zudem erklärt das auch die Beschriftung der Taste, die vollständig Start A/B (A/B für Mähzone A und B) lautet. Die eigentliche Mähzeit ergibt sich übrigens simpel aus dem Start, den der Nutzer manuell auslöst. Am nächsten Tag fährt der Freelexo Cam 500 einfach zur gleichen Zeit wieder los, sofern der Regensensor das nicht verhindert. Letzterer lässt sich übrigens in keiner Weise konfigurieren oder gar abschalten.
Die Bedienung klappte (abgesehen von der etwas billigen Folien-„Tastatur“, die kaum erfühlen lässt, ob eine Eingabe erkannt wurde) im Test reibungslos und das gilt auch für den Rasenschnitt generell. Der Einhell Freelexo Cam 500 verhält sich dabei grundsätzlich wie der Großteil der Mähroboter mit Kabelbegrenzung. Entsprechend fährt der Bot, bis er auf ein Hindernis trifft, hält dann an, dreht in eine zufällige Richtung und fährt wieder bis zu einem weiteren Hindernis. Parallele Bahnen wie unsere aktuellen Topmodelle ohne Begrenzungsdraht, nämlich Mammotion Luba AWD (Testbericht) und Segway Navimow (Testbericht), fährt der Freelexo Cam dabei nicht, sondern er erreicht nach dem Chaosprinzip alle Stellen der Mähfläche. Damit erinnert er stark an den Worx Landroid Vision (Testbericht), der ebenfalls ohne Begrenzungskabel auskommt und per Kamera navigiert. Die funktioniert bei Einhell ähnlich wie bei Worx und beobachtet den Bereich direkt vor dem Roboter. Anhand der Bilder erkennt der Freelexo Cam, ob es sich um Rasen, andere Untergründe oder Hindernisse handelt. Das klappte im Test weitgehend fehlerfrei, allerdings zeigten sich leichte Probleme mit Schatten. Zeichnete sich solch eine Verdunklung hart auf dem Grün ab, stockte der Mäher jedes Mal und dreht in vielen Fällen wie vor einem physischen Hindernis ab. Dramatisch ist das nicht, bei uns führte das zumindest nicht dazu, dass der Mäher nicht mehr zur Ladestation zurückkehren konnte. Generell fanden wir allerdings, dass das „Stocken“ bei Schatten oder auch an Grenzen oder Hindernissen etwas lange dauert – ganz so, als fehle es hier etwas an Rechenpower.
Kommen wir zu den eingangs angedeuteten Voraussetzungen des Gartens, die das Handbuch zwar fordert, unser Testgrundstück aber nicht überall bereitstellt. Zum Glück sind die offensichtlich auch nicht wirklich zwingend – denn wer hat schon 30 Zentimeter breite Abgrenzungen (aka Randsteine) in seinem Garten? Bei uns reichten dem Freelexo Cam 500 rund 12,5 Zentimeter breite Rasensteine und dichter Bewuchs an den anderen Rändern. Von denen hält sich der Roboter dank der Ultraschallsensoren nämlich etwa 30 Zentimeter fern und stoppt so vor Büschen und größeren Pflanzen – und leider auch vor in den Rasen ragendem Blattwerk. Neben dieser kleineren Einschränkung gibt es aber auch eine deutlich größere: den Randschnitt. Denn nicht nur bei Hinderniserkennung per Ultraschall bleibt der automatische Rasenmäher weit vom Rand entfernt stehen und dreht ab, sondern auch bei flachen Randsteinen. Hier sind es zwar keine 30 Zentimeter, dennoch bleibt auch hier ein Randstreifen von rund 10 bis 20 Zentimeter unangetastet. Immerhin: Im Gegensatz zu Worx (Stichwort „Cut to Edge“) verspricht Einhell erst gar keinen Randschnitt.
Ansonsten fällt die vergleichsweise hohe Lautstärke des Einhell Freelexo Cam 500 auf. Zu hören sind auch auf mehrere Meter Entfernung sowohl Antriebs- als auch Schneidwerkmotor. Das ist zwar alles im Rahmen, sodass sich Nachbarn noch nicht gestört fühlen dürften, allerdings gehört das Einhell-Modell zu den lauteren Vertretern seiner Art. Ein weiterer Nachteil: Mangels App fehlen Hinweise, falls es ein Problem des Mähers gibt. Festgefahren hat sich das Gerät aber während des Tests gar nicht, schließlich hält es sich weit genug vom Rand, aber auch von Hindernissen fern. Allerdings kommen mangels jedweder Art von kabelloses Verbindung Updates nur manuell per USB-Stick auf den Roboter. Das wirkt etwas altbacken und auch die Platzierung eines USB-Ports überrascht. Denn der befindet sich unter dem Mäher – in direkter Nähe zum Haupt- Ein/Aus-Schalter. Ansonsten haben wir in puncto Sicherheit keine Probleme festgestellt. Der Roboter erkennt Tennisball-große Hindernisse zuverlässig, dreht bei Kontakt mit dem Frontbumper ab und stellt bei Anheben (egal ob vorn oder seitlich) den Betrieb umgehen ein. Und selbst, wenn Nutzer den Freelexo Cam 500 entgegen aller Warnungen vor Verletzungspotenzial bei dämmerungs- oder nachtaktiven Tieren fahren lassen wollten, klappt das wegen der hauptsächlich auf Sicht basierten Navigationsart nur bei ausreichendem Licht, also tagsüber.
Übrigens: Bei der Rückkehr zur Ladestation erstellt der Roboter nach Angaben aus dem Handbuch für sich eine Karte der Mähfläche, um zur Ladestation zurückkehren zu können. Dafür kommt auch wieder das GPS-Modul des Gerätes zum Einsatz. Tatsächlich funktionierte das im Testzeitraum zuverlässig, wenn auch – wie schon die eigentliche Navigation – nicht immer auf schnellstem Wege. Weiter als 1000 Meter darf sich das Gerät laut Handbuch nicht von der Station entfernen. Die eingangs beschriebenen, weit herunterreichenden Schürzen des Chassis sorgten bei uns trotz unebenem Rasen nicht für nennenswerte Probleme. Nur zwei oder dreimal hinderten sie den Roboter an einer Drehung. Dabei dauerte es recht lang, bis das Gerät die auf der Stelle drehenden Räder erkannte und einen neuen Ansatz suchte. Insgesamt kam es dadurch aber nur zu minimaler Beschädigung des Rasens.
Der mitgelieferte Akku reichte für rund 2,5 Stunden Laufzeit, bevor der Roboter zur Station zurückkehrte. Nach dem Laden vervollständigt er das eingestellte Zeitfenster seiner Arbeitszeit.
Preis
Der Einhell Freelexo Cam 500 kostete zum Testzeitpunkt um 875 Euro.
Fazit
Ist der Einhell Freelexo Cam 500 wegen des niedrigen Preises die beste Wahl für Interessenten an einem Mähroboter ohne Begrenzungskabel? Sicherlich nicht. Denn so einfach das Gerät bei Installation und Handhabung auch sein mag, so wenig komfortabel ist das Fehlen einer App im Alltag. Das gilt für die Bedienung an sich, aber auch für dadurch fehlende Features. Denn beim Einhell-Gerät verzichten Nutzer auf automatisches Mähen mehrerer Zonen, Bahnenziehen, die Programmierung von Zeitplänen, Randschnitt, einfache OTA-Updates und einiges mehr.
Zusammengefasst bedeutet das: Der Einhell Freelexo Cam 500 kann am wenigsten von allen Mährobotern ohne Begrenzungsdraht, dafür kostet er aber auch am wenigsten und machte im Test die wenigsten Probleme. Wer ein sehr einfaches Grundstück mit nur einer zusammenhängenden Rasenfläche hat, auf einen Begrenzungsdraht verzichten will, auf Komfort nach der Installation verzichten und regelmäßigem manuellem Randschnitt leben kann, wird mit dem Einhell-Gerät vermutlich trotzdem glücklich. Der Wechselakku, der auch in andere Power-X-Change-Geräte des Herstellers passt, ist ein weiteres Argument dafür.
Wer mehr zum Thema Mähroboter ohne Begrenzungsdraht erfahren will, sollte einen Blick in unseren Ratgeber zum Thema werfen. Zubehör und andere hilfreiche Ausstattung für Roboter mit und ohne Kabel bietet unser Ratgeber Praktisch und kurios: Zubehör für Mähroboter – von Rallystreifen bis Roboter-Garage.
Worx Landroid Vision
Worx Landroid Vision
ab 959 EUR
Mähroboter ohne Begrenzungsdraht sind der absolute Trend seit 2023 und den will auch Worx nicht verschlafen. Darüber wurde offenbar die Entwicklungszeit des neuen Landroid Vision knapp und Kundenbeschwerden häufen sich. Doch es ist nicht alles schlecht.
VORTEILE
- schickes, wertiges Design
- sehr leise
- fährt sich nicht fest, keine durchdrehenden Räder
- gute Hinderniserkennung
- sehr gutes Schnittbild
NACHTEILE
- miese App
- Verbindungsprobleme mit Zeitverzögerungen
- Schlechter Randschnitt trotz „Cut to Edge“
- Kein Bahnenschnitt
- Wenig Features im Vergleich zur Konkurrenz
- Zonenmanagement im Alltag nur bedingt zu gebrauchen
Mähroboter Worx Landroid Vision im Test: Einfach ohne Begrenzungskabel mähen
Mähroboter ohne Begrenzungsdraht sind der absolute Trend seit 2023 und den will auch Worx nicht verschlafen. Darüber wurde offenbar die Entwicklungszeit des neuen Landroid Vision knapp und Kundenbeschwerden häufen sich. Doch es ist nicht alles schlecht.
Inzwischen haben wir mehrere Mähroboter der neuen Gattung getestet, die ohne Begrenzungskabel auskommen. Da wäre etwa der Segway Navimow (Testbericht), der wie Ecoflow Blade (Testbericht) und Marotronics Alfred (Testbericht) per GPS und RTK (Real Time Kinematic) navigiert. Oder der Ecovacs Goat G1 (Testbericht), der auf UWB-Beacons (Ultra Wide Band) im Garten setzt, um die Störanfälligkeit und die daraus resultierenden Ungenauigkeiten eines RTK-Systems zu minimieren. Und dann gibt es neben den alten Rasensensoren noch eine weitere Art der Navigation, die das Verlegen eines Begrenzungskabels überflüssig machen soll und auf die auch der Worx Landroid Vision setzt: eine KI-gestützte Kamera. Der Hersteller verspricht, dass der Nutzer quasi keine Arbeit in Form von Einrichtung des Gerätes hat – angeblich muss er den Mäher einfach auf den Rasen setzen und schon geht es los. Wir haben uns im Test angeschaut, wie gut das funktioniert.
Design und Verarbeitung
Eins muss man Worx lassen: Der Landroid Vision wirkt bullig und modern, irgendwie wie eine Mischung aus Landwirtschaftsmaschine und Radpanzer aus einem Sifi-Film. Etwas aufgelockert wird das Ganze durch die orange-schwarze Farbmischung und einige Akzente in gebürstetem Aluminium – schick! Aus Alu sind dabei etwa der seitlich hinten links angebrachte Tragegriff, die massive Einfassung des hinteren Stützrades und die Halterung für die Kamera. Vorn ragen seitlich große Stollenräder fast bis zur Gehäuse-Oberkante auf und neben dem Kameraarm erinnern zwei Kunststoff-Spoiler wieder an Film-Requisiten aus einem Film, der in der Zukunft spielt. Das kräftige Orange gefällt uns wesentlich besser als der etwas blasse Farbton des Segway Navimow, dessen rundliches Design zudem weit weniger modern wirkt.
Zum Aussehen eines Fahrzeugs passen auch die beiden vorderen „Scheinwerfer“, bei denen es sich allerdings um die beiden Ladekontakte handelt, über die der Roboter in der Basisstation Strom bezieht. Licht gibt es auf Wunsch übrigens trotzdem, das muss allerdings zusätzlich gekauft werden. Damit soll der Vision auch bei Dunkelheit mähen können und trotzdem keine Gefahr für nachtaktive Tiere darstellen. Denn ohne ausreichende Beleuchtung sieht die Kamera nichts mehr und der Landroid Vision stellt den Dienst ein. Wenn übrigens vorhin die Rede von einem Stützrad war, so war das eine Untertreibung. Tatsächlich handelt es sich eher um eine Stützwalze, die an einen Autoreifen samt Profil erinnert – nicht ganz so groß natürlich, aber in Relation ziemlich breit. Das alles wirkt ziemlich robust und langlebig.
Oben auf dem Gerät installiert Worx wie von anderen Modellen gewohnt eine große rote Stopp-Taste, darüber einen Jogdial (drehbares Wahlrad mit Druckfunktion) sowie ein kleines Display. Mittels Jogdial und Display ist die Steuerung des Roboters auch direkt vor Ort möglich – und oft nötig, mehr dazu im weiteren Verlauf des Tests. Der Drehknopf aus Metall und Kunststoff fühlt sich dabei weitestgehend wertig und ausreichend präzise an, allerdings ist bei Nutzung immer ein gewisses Kratzen und Knirschen einer unter Spannung stehenden Feder zu hören. Neben Display, Stopp-Knopf und Steuerrad gibt es zudem noch einen Deckel für das Akkufach, das je nach Version des Vision (es gibt die Modelle M600, M800, L1300 und L1600, die Zahl steht für die Rasengröße) Power-Share-Akkus mit 20V und 2 Ah (nur M600) oder 4 Ah verwendet. Wer stärkere Akkus besitzt, kann diese ebenfalls verwenden. Für Nutzer von Akku-Gartengeräten des Herstellers ist das durchaus ein netter Mehrwert. Das Find-My-Landroid-Modul, mit dessen Hilfe ein gestohlener Landroid Vision per GPS und mobiler Datenübertragung wiedergefunden werden kann, wird vorn unter einem der erwähnten „Spoiler“ eingesetzt. Es muss wie schon die Lampe hinzugekauft werden - bei dem Preis des Vision ist das doch zumindest etwas störend.
Eine Besonderheit wartet unter dem Mähroboter. Denn während auf dessen rechter Seite groß „Cut to Edge“ zu lesen ist, ist das Mähwerk mit dem vergleichsweise kleinen Mähteller (je nach Modell 18 bis 22 cm) samt drei Klingen zwar leicht nach rechts versetzt, aber längst nicht ganz am Rand. Dabei suggeriert „Cut to Edge“ genau das – einen perfekten Randschnitt. Bei den kabelgebundenen Landroid-Modellen mit dieser Funktion klappt das tatsächlich ziemlich gut, sofern der Begrenzungsdraht richtig installiert ist. Und wie soll das beim neuen Landroid Vision gehen?
Verbindungsaufnahme mit dem Smartphone
Die Verbindungsaufnahme mit unserem ersten Testmodell gestaltete sich schwierig bis unmöglich und wirft viele Fragen auf. Denn während Neulinge auf dem Gebiet der Rasenroboter wie Ecovacs, Ecoflow und Segway mit toller App samt zahlreichen Funktionen, toller Visualisierung, hilfreichen Bildern und sogar Animationen für eine einfache Einrichtung glänzen, spart sich Worx viele Worte und Erklärungen. Stattdessen wechselt die App nach dem entsprechenden Button zum Anlernen eines neuen Gerätes einfach in einen Scanmodus. Damit soll der winzige QR-Code im Inneren der Akkuabdeckung anvisiert werden, was entgegen der Darstellung in der App auch im Querformat funktioniert – anders kommt man mit größeren Smartphones auch gar nicht nah genug an den kleinen Pixel-Haufen heran. Was die App will, verrät sie aber nur indirekt, und zwar nur dann, wenn man auf den kleinen „Wo finde ich den QR-Code“-Button klickt. Dann kommt der Hinweis, dass der sich „je nach Modell“ auf dem Etikett auf der Rückseite oder „unter der Haube“ des Mähroboters befindet. Warum je nach Modell? Bei anderen Herstellern bekommt man präzise Anweisungen – warum nicht bei Worx? Ganz einfach: Weil die App mit nur minimalen Änderungen auch für die kabelgebundenen Mäher des Herstellers zuständig ist – und das merkt man an allen Ecken und Enden.
Unser erstes Testgerät wollte so oder so keine richtige Verbindung herstellen und schaffte dabei trotzdem das eigentlich Unmögliche. Denn die App konnte uns nach der angeblich erfolgreichen Verbindung zwar mitteilen, dass es ein Firmware-Update gibt (schon besser als zu Beginn unserer Tests vor einigen Wochen), aber unter dem Okay-Button versteckt sich nicht etwa der Go-Befehl zum Updaten, sondern ein Link, der in einen Hilfebereich führt. Dort wird dann noch einmal Schritt für Schritt erklärt, wie man den Mäher mit dem Smartphone verbindet, um ein Update machen zu können – angefangen damit, den QR-Code einzuscannen. Waren wir da nicht gerade? Und woher wusste die App, dass es ein Update für den Mäher gibt, wenn doch jetzt wieder das WLAN-Icon ein Ausrufezeichen zeigt und es nun doch keine Verbindung mehr gibt? Fragen über Fragen, die wir mit einem zweiten Testgerät beantworten wollten, das uns Hersteller Positec dankenswerterweise auch zur Verfügung stellte.
Damit klappte die Verbindungsaufnahme tatsächlich recht reibungslos. Nach dem Scannen des Codes folgt die Frage, ob der Nutzer seinen neu erstandenen Rasenhelfer per WLAN oder QR-Code anlernen möchte. Was nach dem Einscannen eines QR-Codes vor wenigen Sekunden irgendwie seltsam anmutet, ist vorerst ohnehin egal. Denn als Nächstes kommt in beiden Fällen die Frage nach dem Passwort des vom Smartphone gerade verwendeten WLANs. Außerdem folgt in beiden Fällen darauf eine immerhin in einfachen Worten plus Bildern verständlich ausgedrückte Anweisung, was man bei Mäher und App zu tun hat. Am Mäher soll man nämlich App Link starten und das dann auf dem Smartphone bestätigen – und schon soll der Mäher verbunden sein. Wählte der Nutzer zuvor den QR-Code, führt das dazu, dass auf dem Smartphone-Display zusätzlich noch ein QR-Code angezeigt wird, den die Kamera des Mähers dann einscannt. Warum es zwei weitgehend identische Wege gibt, verschweigt die App.
Die Verbindung klappt tatsächlich ziemlich direkt. Allerdings benötigte auch das zweite Testgerät zwei unaufgeforderte Neustarts während der Einrichtung, obwohl das Modell ja gerade erst gestartet wurde. Erst danach funktionierte der Vision zumindest zeitweise fehlerfrei. Wer ein modernes WLAN-Mesh-Netzwerk hat, das gleichzeitig 2,4 und 5 GHz aussendet, sollte das am besten ändern – obwohl sich der Mäher laut Handbuch eigentlich mit 2,4 und 5 GHz verbinden kann. Nur offenbar nicht beides gleichzeitig. Stattdessen verlangte der Vision bei uns für die erste Verbindung ein reines 2,4-GHz-Netz. Später konnten wir den Roboter dann auf unser gemischtes Netzwerk umlernen – warum nicht gleich? Ganz problemlos lief es aber auch dann nicht, es kam zu Verzögerungen bei der Übertragung von Befehlen und Pushnachrichten. Das blieb leider auch so, nachdem wir den Roboter wieder zurück ins 2,4-GHz-Netz brachten – ärgerlich! An der Abdeckung des WLANs kann das nicht gelegen haben. An der Ladestation, die durch nur 5 Meter und eine Wand vom nächsten Mesh-Router getrennt stand, lieferte ein Speed-Test auf einem Smartphone immer noch knapp 30 Mbit/s im Up- und Downsream. Der Roboter zeigte dabei in der App aber meist nur mittelmäßigen Empfang an.
Die App
Nach der Verbindungsaufnahme landet man in der gleichen App, die auch Nutzer anderer Landroid-Modelle mit App-Steuerung kennen und die - vorsichtig ausgedrückt - grafisch sparsam und bestenfalls zweckmäßig daherkommt. Immerhin gibt es hier das schon auf dem Roboter zu findende Corporate Design in Schwarz und Orange mit einem Bild des Landroid Vision in der Mitte. Eine Karte, die RTK-Mäher an dieser Stelle nach dem ersten Durchgang anzeigen würden, kann der Mäher schließlich nicht erstellen. Spannend am mittigen Bild: Daran visuell angeheftet ist der Begriff „Off Limits“. Angetippt führt der hinterlegte Link zu einer Hilfsseite, die den Besitzer seines neuen, mindestens 1500 Euro teuren, kabellosen Rasenroboters mit folgenden Zeilen begrüßt: „Shortcut verkürzt die Zeit, die Landroid benötigt, um zurück zur Ladestation zu fahren. Dazu müssen Magnetbandstreifen über dem Begrenzungskabel angebracht werden“. Wirklich, Worx? Auf dem Begrenzungskabel?! Und warum Shortcut?
Will man mehr wissen und drückt auf den entsprechenden Knopf, passiert erst einmal gar nichts. Der Nutzer sieht sekundenlang eine weiße Seite. Nach guten sieben oder acht Sekunden ploppt endlich die gesuchte Erklärung zur Off-Limits-Funktion auf. Hinter der verbirgt sich nichts anderes als eine temporäre Abgrenzungsmöglichkeit von bestimmten Bereichen oder Gegenständen in der Mähfläche per Magnetband. Auf der Erklär-Seite gibt es zwar auch nur Bilder von kabelgebundenen Landroid-Mähroboters zu sehen und entsprechend ist die Rede davon, dass man das optionale Off Limits Modul an seinem Mähroboter anbringen kann. Immerhin geht es in den Texten aber wirklich um Off Limits und nicht um die Shortcut-Funktion. Allerdings verbirgt sich hinter dem Jetzt-Kaufen-Link keine Kaufoption, sondern ein Erklärvideo zur Off-Limits-Thematik. Kaufen muss man für die Funktion sowieso nichts, denn im Gegensatz zu Licht und Diebstahlschutz ist der Off-Limits-Sensor samt 2x 5 Meter Magnetband bereits im Liefer- und Funktionsumfang enthalten. Warum das Band in einem hellen Giftgrün statt in einem passenderen, dunkleren Farbton gewählt wurde? Bei so vielen Fehlern in einer App ist das beinahe schon zweitrangig.
Doch zurück zu den Kernfunktionen der App – und die sind gefühlt wild durcheinandergewürfelt, insgesamt aber schnell zusammengefasst. Oben links gibt es das Android-typische Burger-Menü, über das die weiteren Optionen aufgerufen werden. Ganz oben auf der Liste mit elf Menüpunkten gibt es einen Button, um zur Startseite zurückzukehren – auch, wenn man direkt von der Startseite kommt. Der Button macht tatsächlich nichts anderes, als das gerade ausgeklappte Menü wieder zuzuklappen. Unter „Meine Landroids“ wechseln Nutzer zwischen den verschiedenen Geräten hin und her, in unserem Fall gab es hier im Verlauf tatsächlich zwei Vision-Modelle zu bestaunen, auch wenn eins davon eigentlich keine Verbindung zur App aufbauen wollte. Außerdem fügt man hier neue Modelle hinzu. Weiter geht’s mit „Mein Rasen“, wo den Nutzer eine nüchterne Kachel-Ansicht erwartet, von denen der Großteil ausgegraut ist. Nutzbar sind ausschließlich die Kacheln „Rasenfläche“, „Zeitplan“ und „Regenverzögerung“.
Hinter „Rasenfläche“ verbirgt sich ein Menü, in dem die Größe der Rasenfläche eingegeben oder samt Perimeterlänge ermittelt werden kann. Zu letzterem Zweck schreitet der Nutzer mit dem Handy und dessen über die Landroid-App aktivierte Kamera die Grenzen seiner Rasenfläche ab und die App berechnet damit dank GPS im Handy die Rasengröße. Anschließend gibt es sogar eine schematische Darstellung der Rasenfläche, die bei uns durchaus passend erschien. Klasse - schade nur, dass die später nie wieder irgendwo auftaucht. Weitere Bedienfelder: Der Nutzer darf Mähzeitpläne einrichten und in 30-Minuten-Schritten eine Regenverzögerung bis zu 12 Stunden für den Fall einstellen, dass der Worx Landroid Vision über seinen Regensensor Nässe feststellt. Und dann gibt es da noch den kleinen Schiebeknopf in der ausgegrauten Kachel, die mit „Automatischer Zeitplan“ betitelt ist. Obwohl ausgegraut, lässt sich der kleine Knopf tatsächlich aktivieren – und eröffnet plötzlich ganz neue Möglichkeiten.
Denn dann erwachen alle Kacheln zum Leben und der Nutzer darf die Grasarten, die Bodenart, vorhandene Bewässerung und die Düngung des Rasens angeben. Zusammen mit der bereits beschriebenen Größenermittlung der Rasenfläche erstellt der Landroid Vision dann angeblich einen an die genannten Umstände angepassten Mähplan - was ihn aber nicht daran hindert, in der Mittagssonne im Sommer zu mähen. Die Mähhäufigkeit lässt sich dabei in drei Stufen anpassen und anstelle der Kachel mit dem manuellen Mähplan erscheint endlich eine Möglichkeit, dem Mäher Pausen zu verordnen – etwa, wenn er an bestimmten Tagen nicht fahren soll. Außerdem lässt sich hier die Mähzeit auf Tageslichtzeiten beschränken, um nachtaktive Tiere zu schützen – was im Gegensatz zum LED-Licht steht, das Worx separat für den Vision verkauft.
Weitere Menüpunkte betreffen ein Protokoll, bei dem der Mäher – wie übrigens auch bei Pushnachrichten aufs Smartphone – den Nutzer gern mit doppelten und dreifachen Nachrichten vollspammt. Hinzu kommen Statistiken über Betriebszeit, zurückgelegte Entfernung oder Ladezyklen, ein eigener Menüpunkt, in dem man lediglich die Entfernungsmessung von metrischem System auf das imperiale umstellen kann und den Punkt „Einstellungen“. Darunter findet man nicht etwa Optionen wie etwa die zuvor genannte Umstellmöglichkeiten für Maßeinheiten und Ähnliches, sondern darf hier den Namen ändern (warum nicht unter „Meine Landroids“?) und den Standort des Mähers festlegen. Zudem lassen sich hier Benachrichtigungen aktivieren und deaktivieren sowie von „Hinweisen“ auf „Warnungen“ umstellen (was dann auch etwas weniger Spam-Nachrichten zufolge hat). Zusätzlich darf der Nutzer den Mäher daran hindern, Informationen des Bots zu Problemen und Produktverbesserungen an Positec zu senden.
Unter „Geräteinfo“ erhält man dann Hinweise zu Modell, Seriennummer, Mac-Adresse und Firmware-Version (warum nicht unter „Meine Landroids“?), ohne allerdings aktiv nach einem Firmware-Update suchen zu dürfen – warum nicht?! Abschließend gibt es noch den Punkt „Konto“, in dem sich entsprechende Daten wie Kennwort und Mailadresse anpassen lassen, darunter auch die Möglichkeiten, ob der Hersteller dem Nutzer Marketing-Mails und sonstige personalisierte Angebote schicken darf. Bleiben noch diverse Support-Dokumente mit Hinweisen, wie man seinen Landroid (natürlich wieder bezogen auf ALLE Landroid-Modelle, nicht nur auf den Vision…) bedient. Zu guter Letzt gibt es Hinweise zur App selbst inklusive Nutzungsbedingungen (natürlich nur auf Englisch) und Datenschutzvereinbarungen (ebenfalls nur auf Englisch) – beides unseres Wissens seit einem Urteil des Kammergerichtes Berlin im Fall Verbraucherzentralen gegen Whatsapp seit 2016 nicht mehr rechtsgültig, da die Dokumente nicht auf Deutsch vorliegen.
Auch der „Partymodus“ hat uns „richtig gut“ gefallen. Er lässt sich eigentlich aktivieren, wenn man auf der Startseite das kleine Kontextmenü neben den Buttons für Zurück, Start und Stopp anwählt. Eigentlich soll er bestehende Zeitpläne außer Kraft setzen, bis er wieder deaktiviert wird. Bei uns kam nur der Hinweis, dass es dafür ein Update braucht und die Buttons Abbrechen und Update. Ein Klick auf Update bringt uns in den Update-Bereich, wo uns die Meldung erwarte, dass es keine neue Firmware für unseren Mäher gibt. Danke fürs Gespräch…
Festlegen der Mähfläche und Mähbeginn
Kommen wir zu etwas Erfreulichem nach dem ganzen Software-Desaster, schließlich verspricht Worx auf der Themenseite zum Vision: „Stellen Sie den Landroid Vision einfach auf eine beliebige Rasenfläche, drücken Sie den Knopf und sehen Sie ihm bei der Arbeit zu. Kein Begrenzungskabel, keine Antenne, kein Ärger“. Und tatsächlich: Das funktioniert! Der Mäher hält dabei ordentlichen Abstand zu Begrenzungen wie Mauern oder Wegplatten und zieht munter seinen Bahnen. Wobei „Bahnen“ missverständlich ist, denn Bahnen ziehen kann er gar nicht.
So oder so: Eine echte Einrichtung gibt es nicht, da verspricht Worx nicht zu viel. Der größte Aufwand – und der ist minimal – ist das Aufstellen der Ladestation. Die sollte unserer Erfahrung nach am besten parallel zum Rand stehen und dabei gegen den Uhrzeigersinn der Mähfläche aufgestellt sein. Denn dann kann der Vision bei der Rückkehr, bei der er dem Rand der Fläche gegen den Uhrzeigersinn folgt, optimal den QR-Code an der Ladestation sehen und „einparken“.
Navigation und Alltag
Kommen wir zur weiteren guten Nachricht: Im Alltag verhält sich der Worx Landroid Vision in allen Belangen unauffällig. Ist die Ladestation richtig positioniert, fährt der Vision zuverlässig los, mäht ohne Beanstandung und kehrt ebenso verlässlich wieder zurück. Seit dem Update auf die im Test verwendete Firmware (1.2.9+1 - 3.30.0+2) fuhr sich der Roboter nicht ein einziges Mal fest und erledigte seine Aufgaben richtig gut. Im Gegenzug hält er sich aber auch von Hindernissen (echten oder vermeintlichen) recht weit fern, gleiches gilt für Ränder – dazu später mehr.
Durch die Navigation nach dem Chaosprinzip entstehen keine Bahnen, ein sichtbares Schnittmuster gibt es also nicht. Stattdessen fährt er bis zu einem Hindernis oder zum Rand und dreht dann zufällig ab – ganz so, wie der Großteil an kabelgebundenen Mähern. Insgesamt gefiel uns das Schnittbild im Test wohl auch wegen des in der Höhe beweglichen Mähtellers, der Unebenheiten des Rasens ausgleichen soll, sehr gut. Die typischen Probleme von GPS-gesteuerten RTK-Mähern, die selbst unseren derzeitigen Primus Segway Navimow (Testbericht) hin und wieder auf unerwünschte Abwege und zum Festfahren am Rasenrand brachten, gibt es beim Vision nicht. Der erkennt mit der vorderen, nach unten gerichteten Weitwinkelkamera, was sich direkt vor ihm befindet. Dabei unterscheidet er grundsätzlich zwischen „Rasen“ und „nicht Rasen“, eine Künstliche Intelligenz entscheidet, ob der Mäher ausweicht oder weiterfährt. Im Test funktionierte das sehr gut. Schuhe, Wasserschläuche oder Tierstatuetten bemerkte die KI mittels der Kamera rund 40 Zentimeter vor dem Mäher und wich verlässlich und mit knappem, aber ausreichendem Abstand aus. Immer wieder kommt es aber auch vor, dass er auf der Testfläche plötzlich innehielt und dann unvermittelt abdrehte. Oft konnten wir dabei keinen Grund erkennen, bisweilen könnte der Roboter auch seine Liebe zu einzelnen Butterblümchen im Rasen entdeckt haben. Ganz perfekt läuft das zumindest noch nicht, ist in diesem Fall aber auch nicht weiter schlimm. Wie es im Hochsommer mit trockenem Rasen aussieht, ist hingegen fraglich.
Immerhin: Die Probleme der frühen Firmware-Versionen, bei denen der Roboter bei Mähflächen ohne sichtbare Abgrenzung mittels Randsteinen gerne aus seinem Aufgabengebiet ausbüxte, sofern im Beet neben dem Rasen auch Grashalme oder zumindest ähnlich grüne Pflanzen standen, scheinen behoben. Auch kleinere Schadstellen im Rasen ignoriert der Mäher inzwischen, ebenfalls einzelne Blätter. Größere Kahlstellen oder Blatthaufen umfährt er hingegen. Dabei wirkt der Rasenhelfer nie hektisch, das macht etwa der Ecoflow Blade (Testbericht) bisweilen ganz anders. Der versucht bisweilen, sich in schwieriger Umgebung beinahe jähzornig loszureißen. Und er ist lauter. Am lautesten am Landroid Vision ist hingegen das Geräusch der abgeraspelten Grashalme. Der Mäher selbst ist fast gar nicht zu hören – so soll es sein!
Also alles Friede, Freude, Eierkuchen? Mitnichten. Denn zu einem ordentlichen Rasenschnitt gehört auch ein vernünftiger Randschnitt – und davon ist der Vision zwar nicht meilen-, aber zumindest etliche Zentimeter weit entfernt. Wie bereits entfernt ist das Mähwerk von oben betrachtet zwar aus der Mitte nach rechts versetzt, reicht aber nicht bis an den Rand. Rund 5 Zentimeter dürften da schon bauartbedingt fehlen, in denen die Grashalme unberührt stehen bleiben – selbst wenn der Mäher mit den Rädern direkt an ein seitliches Hindernis oder die Rasenkante heranfahren würde. Das – und damit kommen wir zu einem der größten Probleme des Worx Landroid Vision – tut er aber nicht. Stattdessen hält er auch mit der aktuellen Firmware einen Abstand von 5 bis 20 Zentimetern, sodass am Rand immer gut 10 bis 25 Zentimeter Gras unangetastet bleibt. Und das ist schon besser als mit den ersten Firmware-Versionen seit Verkaufsstart. Hier muss Worx noch stark nacharbeiten. Im Optimalfall müsste der Landroid Vision mit dem äußeren Rad Randsteine befahren, um dann einen optimalen Randschnitt hinzubekommen. Zu höheren Hindernissen wird aber auch dann ein Rasenstreifen bleiben – das ist aber auch bei der Konkurrenz so und erfordert regelmäßiges händisches Nacharbeiten der Gartenbesitzer. Bei Worx ärgert das aber irgendwie noch mehr, schließlich wirbt der Hersteller gezielt mit „Cut to Edge“ – und da ist der Landroid Vision wortwörtlich nicht mal nah dran.
Und es gibt noch weitere Einschränkungen. Da der Worx Landroid Vision nicht weiß, wo genau er sich befindet, kann er auch nicht wie die anderen bislang getesteten Mäher ohne Begrenzungsdraht einfach so weitere Mähzonen anfahren. Das wird aber immer dann nötig, wenn es mehrere Rasenflächen auf einem Grundstück gibt, die nicht zusammenhängen. Als Lösung setzt Worx beim Vision dafür auf RFID-Chips, die der Nutzer an der Stelle im Rasen verankern muss, an der der Mäher das Grün verlassen und zum nächsten Teilstück wechseln soll. Zwei der Chips sind im Lieferumfang enthalten und ergeben zusammen immer einen Übergang. Die Chips sehen wie ein – erneut giftgrüner – flacher Reif aus und haben etwa die Größe eines der Antriebsräder des Roboters. Sie werden mit Erdnägeln auf dem Rasen in der Nähe des Randes fixiert. Dort sind sie zumindest die ersten Wochen deutlich sichtbar, später dürften sie zumindest teilweise einwachsen.
Findet der Roboter so einen Chip (dafür einmalig am Mäher Multizone Explore aktivieren) passiert Folgendes: Der Roboter dreht direkt nach dem Überfahren um 90 Grad nach rechts, ignoriert sein eigentliches Bestreben, nur auf Gras zu fahren und überwindet so auch maximal 6 Meter breite Wege. Sobald er wieder Rasen findet, dreht er erneut nach rechts. Anschließend fährt er auf der zweiten Zone den Rand bis zum zweiten RFID-Marker ab und wechselt dort wieder zurück auf die erste Zone. Das klappt übrigens ausschließlich, wenn sich zwei Rasenstücke weitgehend parallel zueinander befinden, da der Mäher außerhalb seiner grünen Arbeitsumgebung stur geradeaus fährt. Und es gibt weitere Tücken bei dieser etwas anachronistisch anmutenden Vorgehensweise. Wie genau der Roboter nach einem Chip abbiegt, lässt sich nur durch Ausprobieren herausfinden. Je länger die zu überwindende Strecke, desto stärker machen sich ein paar Grad Abweichung vom eigentlich angedachten Weg bemerkbar. Dann landet der Bot auch schnell vor einer Wand oder in einem Beet – das gilt für Hin- und auch Rückweg von der zweiten Zone. Wenn man sich dann vor Augen hält, dass der Mäher die Multi-Zonen-Erkundung ausschließlich von der Basisstation aus startet, anschließend gegen den Uhrzeigersinn den kompletten Rand bis zum RFID-Marker abfährt und dann beim geringsten Fehler zur Ladestation zurückgetragen werden will, kann man sich vorstellen, wie nervenaufreibend und zeitaufwendig das Ganze ist.
Zur Verdeutlichung: Auf unserem Testgrundstück wollten wir zwei teilweise parallele Rasenflächen miteinander verbinden. Zone 1 hat aber nur einen kleinen Teil von rund 1,5 Metern wirklich parallel zu Zone 2, sodass es vier Anläufe brauchte, bis der erste Wechsel von Zone 1 in Zone 2 gelang. An dieser Stelle war die mögliche Zufahrt zu Zone 2 rund 3 Meter breit. Jede Anfahrt bis zum ersten Marker dauerte knapp 10 Minuten. Anschließend brauchte es 3 Versuche, bis der Landroid Vision wieder nur fast Zone 1 fand – danach haben wir entnervt aufgegeben. Das potenzielle Erreichen von Zone 1 dauerte mit der Umrundung von Zone 2 jeweils rund 5 Minuten. Bis zum Abbruch der Aktion haben wir also fast 1,5 Stunden den Vision bei Fehlversuchen beobachtet, zurück zur Ladestation getragen und geflucht. Bedeutet im Klartext: Wer nicht einfach nur einen schmalen Weg überbrücken will, der mitten durch den Rasen führt, wird mit der von Worx gebotenen Lösung alles andere als glücklich. In unserem Fall etwa ist wegen dieser rudimentären Zonentechnik eine von drei Teilflächen überhaupt nicht erreichbar. Der Vision ist daher am besten etwas für Besitzer von Gärten mit nach Möglichkeit nur einer Rasenfläche. Das höchste der Gefühle sind zwei von einem geraden Weg getrennte Flächen. Für anforderndere Gärten mit mehr Teilflächen ist der Vision ungeeignet.
Preis und Unterschiede der Versionen
Der Worx Landroid Vision kostet je nach Version ab 1200 Euro bis 2200 Euro. Hauptunterschiede bei den Varianten sind neben den angedachten Mähflächengrößen und den mitgelieferten Akkus die Ladegeräte, die für unterschiedliche Ladegeschwindigkeiten liefern. So lädt das kleinste Modell WR206E (M600) trotz 2-Ah-Akku mit 85 Minuten am längsten, das größte Modell WR216E (L1600) mit nur 45 Minuten trotz 4-Ah-Akku am schnellsten. Die Schnittbreiten unterscheiden sich geringfügig, beim M600 liegt sie mit 18 cm am niedrigsten, die beiden L-Modelle kommen auf 22 cm. Zudem lässt sich bei diesen die Schnitthöhe elektronisch und nicht manuell am Roboter verstellen.
Wer sich lieber auf den guten alten Draht als Eingrenzung verlassen will, sollte sich hier umschauen:
Fazit
Wir haben es bereits erwähnt: Der Worx Landroid Vision ist zu früh auf den Markt gekommen, der Hersteller wollte offensichtlich unbedingt schnell noch mitmischen, bevor alle Interessenten zu Konkurrenzprodukten wechseln. Jetzt reift der Mäher langsam beim Kunden und wenn man in entsprechende Foren schaut, hat sich Positec mit dieser überhasteten Aktion selbst ein Bein gestellt. Denn dort gibt es gehäuft Beschwerden über den Zustand des mindestens 1500 Euro teuren Mäher und schlechten Service sowie Kommunikation seitens des Herstellers. Dass einige Obi-Märkte den Vision noch etliche Tage vor offiziellem Marktstart mit einer unvollständigen Demo-Firmware verkauft haben, hat da sicherlich auch nicht geholfen. Das alles wäre wohl zu verschmerzen, wenn sich in unserem Test nicht nach wie vor bestehende, teils gravierende Probleme gezeigt hätten.
Unser zweites Testgerät verbindet sich zwar problemlos mit dem WLAN und dürfte daher physisch in Ordnung sein, kommt aber mit gemischten Mesh-Netzwerken mit 2,4- und 5 GHz nicht richtig klar. Als Folge gibt es immer etliche Minuten Verzögerung zwischen tatsächlichem Zustand des Bots und Anzeige in der App. Dazu spammt der Bot den Nutzer mit überflüssigen Nachrichten zu - niemand will wissen, dass er gerade in der „Ausgangsposition“ steht, wenn er offensichtlich gerade seit geraumer Zeit in der Ladestation lädt. Die App selbst ist nicht nur an etlichen Stellen fehlerhaft, sondern im Vergleich zur Konkurrenz optisch und auch bei der Funktionalität eine halbe Katastrophe.
Mehrere Zonen lassen sich nur mit großem zeitlichem und nervlichem Aufwand einrichten, in vielen Fällen ist das aufgrund der Gartenbeschaffenheit technisch schlichtweg nicht möglich. Und „Cut to Edge“ ist für den Randschnitt bestenfalls eine Übertreibung, tatsächlich ist das mit dem Vision aber selbst bei perfekter Software nur zum Teil erreichbar. Das macht die Konkurrenz zwar nicht besser, aber die bewirbt auch keine speziellen Randschnittfähigkeiten. Dass der Roboter aufgrund der Navigationsart per Kamera viele Funktionen wie Bahnenziehen, Sperrzonen per App und einiges mehr nicht bietet und nie können wird, sei da nur nebenher erwähnt. Liest man nur bis hier, ist das Wort „Frechheit“ für den Gesamtzustand des Worx Landroid Vision nicht ganz abwegig.
Das Erstaunliche: Wenn der Vision einmal eingerichtet und das Grundstück mit per Randsteinen eingefasster, zusammenhängender Rasenfläche ausgestattet ist, macht er seine Sache richtig gut. Selbst ein schmaler Weg, der zwei Rasenflächen voneinander trennt, ist dann kein Problem. Zur Not dürfen Nutzer temporäre Flächen mit dem Magnetband sperren – echt oldschool, aber wirksam. Und das Tolle daran ist, dass der Nutzer derzeit keinen von uns getesteten Mähroboter ohne Begrenzungsdraht finden wird, der weniger Arbeit bei der Einrichtung braucht. Wenn der Hersteller wenigstens noch das Problem mit dem unzureichenden Randschnitt in den Griff bekommt, ist das genau die Nische, in der der Landroid Vision brilliert: einfachste Einrichtung, zumindest bei einfachen Grundstücken. Dank guter Objekt- und Hinderniserkennung muss man sich dabei auch keine Sorgen um den Gartenschlauch oder Tiere auf dem Rasen machen.
Was moderne Mähroboter ohne Begrenzungsdraht können sollten, zeigen wir in unserem Ratgeber zum Thema. Eine regelmäßig aktualisierte Topliste der besten Mähroboter ohne Begrenzungskabel haben wir ebenfalls bereits erstellt. Wer sich lieber auf einen Draht als Rasengrenze verlassen, aber dennoch nicht selbst mähen will, sollte einen Blick in unseren Ratgeber Husqvarna, Gardena, Stihl: Der beste Mähroboter für jede Rasengröße werfen.
Ecoflow Blade
Ecoflow Blade
Ecoflow machte bislang vor allem auf Powerstations, schickt jetzt aber seinen ersten Mähroboter ins Rennen. Er sieht futuristisch aus, kann im Herbst Laub sammeln und mäht ohne Begrenzungsdraht – ist das die neue Nummer Eins?
VORTEILE
- sehr schnell und für größere Flächen geeignet
- futuristisches Design
- Laubsammler optional erhältlich
- Mähhöhe per App regulierbar
NACHTEILE
- Hinderniserkennung ausbaufähig
- Design mit omnidirektionalen Rädern suboptimal
- fährt sich gern fest und merkt es (derzeit) nicht)
- viel zu teuer!
Ecoflow Blade im Test: Rasanter Mähroboter ohne Begrenzungsdraht mit Laubsammler
Ecoflow machte bislang vor allem auf Powerstations, schickt jetzt aber seinen ersten Mähroboter ins Rennen. Er sieht futuristisch aus, kann im Herbst Laub sammeln und mäht ohne Begrenzungsdraht – ist das die neue Nummer Eins?
Die Powerstations von Ecoflow, etwa die River 2 Max (Testbericht) oder Delta 2 (Testbericht), schneiden in unseren Tests regelmäßig gut ab. Jetzt will der Hersteller auch an anderer Stelle gut abschneiden – und zwar das Gras im Garten. Der neue Ecoflow Blade kommt dafür mit futuristischem Design, das wenig mit bislang verbreiteten Mährobotern gemein hat und will mit seiner derzeit einzigartigen Laubsammel-Funktion weiter punkten. Dazu bietet er als einziger im derzeitigen Vergleichsfeld eine Anschlussmöglichkeit für einen Fangkorb mit rotierender Bürste und damit eine Erweiterung seiner eigentlichen Kernkompetenz, eben dem Rasenschneiden. Hinzu kommen elektronisch per App verstellbare Mähhöhe sowie KI-Kamera, um Hindernissen wie Kleintieren ausweichen zu können und ein einzigartiges Fortbewegungskonzept. Wir haben im Test überprüft, ob das alles so gut ist wie es klingt.
Design und Verarbeitung
Es klang bereits an: Beim Design geht Ecoflow beim Blade ganz andere Wege als die Konkurrenz. Während die nämlich auf geschlossene Chassis mit meist nur sichtbaren, aber nicht aus dem Gehäuse hervorstehenden Antriebsrädern setzen, wählt Ecoflow eher den Look eines Wüsten- oder Mondbuggys aus einem SiFi-Film. Selbst der Ecovacs Goat G1 (Testbericht), dessen Aussehen wir als elegant und modern bezeichneten, sieht dagegen altbacken aus. Statt eines kastenförmigen Chassis setzt Ecoflow auf ein beinahe windschnittiges Design mit schmalem Aufbau, von dem vorn und hinten die beiden Achsen mit den Rädern hervorstehen – eben wie bei einem Buggy oder Rennwagen. Und da wir bereits beim Goat G1 den Hersteller Tesla als Vergleich genannt haben: Die Form mit den lang nach hinten und kurz nach vorn abfallenden Linien erinnern von der Seite gesehen grob an den legendären Cyber Truck des US-Autobauers – im Gegensatz dazu ist der Blade aber seit dem 26. April in Deutschland erhältlich.
In das schmale Chassis aus silbergrauem und schwarzem Kunststoff integriert Ecofloweine rote Stopp-Taste für Notfälle, das schnittig designte Oberteil des Gehäuses lässt sich abnehmen. Hier installiert der Hersteller eine blaue LED-Anzeige zum Akkustand, einen Powerknopf sowie einen Anschluss zu Diagnose- und Update-Zwecken. Den dürften Nutzer aber nie brauchen, im Normalbetrieb kommen Updates Over the Air (OTA), also kabellos auf den Roboter. Unterhalb des Notfallschalters positionieren die Entwickler drei physische Taster, mit deren Hilfe der Blade gestartet, gestoppt und zur Ladestation zurückgeschickt werden kann. Wiederum darunter befindet sich ein per Schutzkappe verschlossener Anschluss für externe Gerätschaften wie den bereits angedeuteten Fangkorb für Laub.
Die beiden Achsen vorn und hinten sind massiv aus Metall gefertigt, das wirkt sehr langlebig. Die hintere Achse kann sich seitlich zum Torso des Mähers verdrehen, wodurch die mit kräftigen Stollen ausgestatteten hinteren Antriebsräder auch auf unebenem Grund gute Bodenhaftung behalten sollen. Die vordere Achse ist starr installiert und kommt zudem mit einer Besonderheit: Die Vorderräder sind nicht wie bei anderen Mährobotern Stützräder, die sich in alle Richtungen mitdrehen können, sondern sie sind starr installiert. Das ist zudem in einem gegensätzlichen Winkel von je 45 Grad zur Fahrtrichtung geschehen, sodass die Anordnung von oben gesehen an einen pfeilförmigen Schneepflug erinnert. Tatsächlich werden die Vorderräder damit bei einfacher Geradeausfahrt mehr geschoben als gerollt. Um den Widerstand dabei zu verringern, ist jedes der beiden Vorderräder grundsätzlich wie ein dicker Draht konzipiert, auf dem zusätzlich kleine frei drehbare Rohrstücke aufgereiht sind. Damit könnte eines dieser Räder theoretisch geradeaus und im 90-Grad-Winkel dazu rollen – Ecoflow nennt sie omnidirektionale Räder und wählt mit 45 Grad den Mittelweg. Warum das nicht optimal funktioniert, erklären wir später.
Alle Bilder zum Mähroboter Ecoflow Blade ohne Begrenzungsdraht
In der Front des Chassis installiert Ecovacs seine X-Vision genannte Technik zur Objekterkennung. Sie besteht aus einem Abtast-Laser (Light Detection and Ranging - Lidar), RTK-Sensoren (Real Time Kinematic) zur Präzisierung der empfangenen GPS-Daten sowie eine KI-unterstützte Kamera. Ein weiterer Punkt, warum der Blade wie aus einem SiFi-Film wirkt: Er hat vorne oben verschiedenfarbige LED-Streifen, ebenso hinten. Damit gibt er unterschiedliche Zustände wie Betriebsbereitschaft oder schlechten GPS-Empfang visuell an – zusätzlich zur Sprachansage. Auch die Ladestation, die wesentlich einfacher als beim Ecovacs Goat G1 (Testbericht) ausfällt, kommt mit bunten LEDs. Das sieht schick aus, wir gehen im weiteren Verlauf des Tests allerdings noch auf die Nachteile dieser Illumination ein.
Unter dem Chassis platziert Ecoflow den Mähteller mit den drei Klingen, der von einer schwarzen Metallschürze geschützt und von zwei deutlich sichtbaren Scharnieren auf Position gehalten wird. Mittels eines Elektromotors und der Scharniere darf der Nutzer die Mähhöhe und damit die genaue Position des Tellers über der Grasnarbe in der App zwischen 2 und 8 Zentimeter bestimmen. Insgesamt macht der Ecovacs Blade eine gute, wenngleich auch eigenwillige Figur beim Thema Design.
Inbetriebnahme
Für den Test hatten wir verschiedene Versionen einer Beta-App, deren Funktionsumfang aber weitestgehend mit der seit dem 26. April verfügbaren „normalen“ App ist. Die Inbetriebnahme erfolgt fast noch einfacher und genauso gut wie beim Ecovacs Goat G1 (Testbericht), die App führt Schritt für Schritt in Bild und Text durch den Installationsprozess. Dazu gehört eine Aufnahme der Verbindung via Bluetooth, später wird das entsprechende WLAN-Netzwerk hinzugenommen. Nach der Platzierung der Ladestation erklärt die Software, wie die GPS-Antenne zusammenzubauen und zu platzieren ist. Im Gegensatz zum Goat gibt es keine mehrfachen Beacons, sondern nur diese eine rund 1,5 Meter hohe Antenne, die mittels eines langen Kabels mit der Ladestation verbunden ist und somit keine Batterien benötigt. Das Einscannen mehrerer Teile entfällt damit komplett. Wegen der großen Länge des Stromkabels für die Station dürfte es wenig Probleme mit dem Aufstellort geben. Nur zu nah an einer Hauswand oder anderen hohen Objekten sollten Station und Antenne nicht stehen, da das GPS-Signal negativ beeinflusst werden könnte. Bei der Installation wird die Empfangsstärke der Antenne angezeigt und abschließend getestet.
Festlegen der Mähfläche
Nachdem die Verbindung hergestellt ist, kann es auch schon losgehen. Zuerst muss die Mähfläche festgelegt werden. Das funktioniert wie bei allen bislang von uns getesteten GPS-Mähern: Der Nutzer steuert den Blade mittels eines virtuellen Joysticks auf dem Smartphone-Display einmal rings um das zu mähende Areal, bestätigt nach der Rückkehr zum Ausgangspunkt die Beendigung der Aufgabe und die App berechnet die Größe der Fläche sowie die Ausrichtung der Mähbahnen. Dabei sollte ein Abstand von rund 10 Zentimeter zum tatsächlichen Rand der Mähfläche eingehalten werden, damit sich der Mähroboter nicht festfährt. Eine Anpassung der Ausrichtung ist derzeit nicht möglich. Ähnlich lassen sich Aussparungen wie Beete in der Rasenfläche ausschließen – einfach in das Flächenmanagement im Menü wechseln und auf Bereich hinzufügen klicken. Anschließend wählt der Nutzer, ob er eine neue Fläche hinzufügen, eine Fläche ausschließen oder einen Korridor erstellen will. Denn im Gegensatz zum Ecovacs Goat G1 (Testbericht) beherrscht der Blade von Beginn an ein Flächenmanagement, etwa um nicht immer den kompletten Rasen, sondern nur bestimmte Teile davon mähen zu können. Diese Teilstücke müssen einzeln angelegt werden und lassen sich dann durch einen Korridor miteinander verbinden. Der muss mindestens 1,5 Meter lang sein und ist eher eine Art Richtschnur, an der sich der Ecoflow Blade zur nächsten Teilfläche hangelt. Das funktionierte im Test sehr gut, der Mäher kam dabei besser mit schmalen Übergängen als das Konkurrenzprodukt von Ecovacs zurecht. Auch hier verlangt der Hersteller offiziell aber eine Durchgangsbreite von 1 Meter. Sind alle Flächen ein- oder ausgeschlossen, ist der Blade mähbereit – eine Erkundungstour wie beim Goat G1 gibt es nicht.
Ecoflow App
Wie erwähnt standen uns für den Test diverse Beta-Versionen der Ecoflow-App zur Verfügung, daher kam es am Anfang immer wieder zu Problemen bei der Verbindung zum Mäher oder zur GPS-Antenne. Manche Dinge funktionierten nicht wie gedacht und es wurde etwa keine Mähkarte gefunden, wenn man sich außerhalb der Bluetooth-, aber in WLAN-Reichweite befand. Dabei sollte eine Steuerung des Blade im WLAN oder von unterwegs genauso funktionieren und mittels der eingebautem eSIM (E-Netz) funktionierte das auch tatsächlich problemlos. Inzwischen gibt es diese Probleme nicht mehr.
Davon abgesehen machte die App aber einen ordentlichen, aufgeräumten Eindruck. In der Mitte wird auch hier die Mähkarte angezeigt, die im Betrieb auch den Mähfortschritt übersichtlich darstellt. Darüber gibt es eine Statusansicht in Textform sowie die Akkuanzeige in Prozent. Noch weiter oben erscheint der Name des Mähers sowie die Verbindungsart als Symbol – Bluetooth, WLAN oder 4G. Auch die GPS-Nutzung wird hier mittels eines kleinen blauen Pfeils angezeigt. Wird das Signal schwächer, wechselt der Pfeil zu orange oder gar rot. Rechts daneben gibt es Zugriff auf das WLAN-Netzwerk und Zugang zum Hauptmenü. Unterhalb der Kartendarstellung ist erstaunlich viel Platz, nur zwei kleine Symbole gibt es hier auf der rechten Seite: Zeitsteuerung und die sogenannten Arbeitseinstellungen. Damit ist nicht die Motivation des Mähroboters gemeint, sondern der Nutzer hat hier Zugriff auf die Mähggeschwindigkeit in drei Stufen sowie die elektronisch verstellbare Mähhöhe. Ganz unten gibt es abschließend zwei große Buttons zum Starten/Stoppen und Unterbrechen des Mähvorgangs.
Insgesamt ist die Ecoflow-App sehr gut zu bedienen, aber einfacher als das Gegenstück von Ecovacs. Das liegt daran, dass einige Features fehlen, die der Konkurrent bietet. Da wäre etwa der Regensensor – er existiert und wird bei etwas mehr als Nieselregen auch verlässlich ausgelöst und bringt den Blade dazu, zur Ladestation zurückzukehren. Einstellungen gibt es dafür aber kaum und im Gegensatz zum Goat, der durch direkte Eingabe am Mäher zur Aufnahme der Mähtätigkeit auch bei Nässe bewegt werden kann, weigert der Blade sich dann beharrlich, weiterzuarbeiten. Der Menüpunkt Betriebsvoreinstellungen -> Regenverzögerung erlaubt zwar eben jene Eingabe in Stunden und Minuten, aber deaktivieren lässt sich der Sensor nicht. Diese Angabe dient lediglich dazu, die Wiederaufnahme nach Abtrocknen des Sensors zeitlich einzuordnen.
Auch eine Tierschutzzeit gibt es nicht, dafür muss die Zeitsteuerung herhalten, die etwas verwirrend aufgebaut ist. Denn einmal gibt es eine mit einer gelben Uhr symbolisierte Mähaufgabe, die zu einer bestimmten Zeit an beliebigen Tagen gestartet werden kann. Dabei können auch einzelne Zonen ausgewählt werden – etwa Monatgs und Freitags Zone 1, Dienstags und Samstags Zone 2. Eine unterschiedliche Einstellung für die Mähhöhe ist allerdings nicht möglich, die wird in der Zeitsteuerung global gewählt. Gleiches gilt für eine der drei Geschwindigkeitsstufen, mit denen der Mäher sein Werk verrichtet. Eine Endzeit gibt es nicht, hier kommt eine Schätzung der App zum Tragen, wie lange der Mäher voraussichtlich brauchen wird. Zusätzlich gibt es aber auch noch eine andere Einstellungsart, die mit einem Mond-Symbol dargestellt wird. Hier ist die Einstellung einer Start- und Endzeit möglich – alle anderen Einstellungen sind identisch. Immerhin könnte man so dem Blade mitteilen, dass er nachts keinesfalls fahren soll.
Ansonsten gibt es kaum noch spannende Features. Familienmitgliedern kann der Zugriff auf den Mäher erlaubt werden, es gibt eine manuelle Steuerung (ebenfalls ohne aktives Mähwerk), eine Zusammenfassung der abgeschlossenen Aufgaben oder die Möglichkeit, die LED-Beleuchtung abzuschalten. Wichtig ist die Lokalisierungsmöglichkeit des Blade. Hier bekommt der Nutzer den Standort des Mähers auf einer Karte angezeigt, sofern der mindestens noch im 4G-Netz ist. Per Google Maps kann sich der Besitzer im Falle eines Diebstahls sogar direkt zum Standort des Mähers navigieren lassen, außerdem kann er den Roboter hier auch als gestohlen melden und so deaktivieren.
Was fehlt in der App? Zwar kann der Ecoflow Blade weitere Mähbereiche hinzulernen, bestehende können aber wie schon beim Ecovacs Goat G1 (Testbericht) nicht korrigiert werden. Bei Goat klappt sogar beides nicht – der größte Kritikpunkt bei dem Konkurrenzmodell. Allerdings gibt es insgesamt auch nur mickrige zwei Bereiche - also eine Hauptmähfläche und eine weitere - das ist viel zu wenig! Wie auch beim Goat fehlt dem Blade zudem ein Nachtmodus. Wegen der Menge an LED-Beleuchtung (2x vorn, 1x hinten am Roboter plus 1x an der Station) sieht der Garten nachts wie eine Disco aus, das muss doch nicht sein. Ein Kantenmodus lässt sich nicht für Geld und gute Worte aktivieren, nur die automatisch absolvierte Anzahl der Umrundungen der Rasenfläche nach erfolgreicher Rasenschur darf angepasst werden. Auch eine Ausrichtung der Mährichtung fehlt. Sie wird von der App berechnet und fällt gern bei verschiedenen Mähzonen unterschiedlich aus. Weitere Probleme sprechen wir im nächsten Abschnitt an.
Navigation und Alltag
Nach anfänglichen Problemen wegen unausgereifter Soft- und Firmware von Roboter und App war fast wöchentlich eine Besserung zu erkennen – das macht Hoffnung für die Zukunft, dass fehlende, wichtige Funktionen zeitnah nachgeliefert werden. Allerdings gab es auch zuletzt noch Kritikpunkte, die das Gefühl bestärken, der Blade sei zu früh auf den Markt gekommen. Und vielleicht sogar generell zu schnell entwickelt worden. Grundsätzlich verrichtet der Blade seine Arbeit ordentlich. Er navigiert überwiegend sicher und hat dabei eine stabile Verbindung zu den GPS-Satelliten sowie zum Smartphone. Das war beim Marotronics Alfred (Testbericht) leider ganz anders, soll sich aber inzwischen gebessert haben. Allerdings erscheint uns die Gesamtkonstruktion nur bedingt sinnvoll.
Sicher, der Blade sieht viel schnittiger und moderner als nahezu jeder derzeit auf dem Markt befindliche Rasenroboter aus. Aber die Form sollte der Funktion folgen – beim Blade ist das andersherum. So kam es immer wieder mal vor, dass sich der Mähroboter mit den ausgestellten Hinterrädern an der Stange einer Wetterstation festhakte, die mitten in der Rasenfläche steckt. Zwar wurde das später seltener, da die Hinderniserkennung verbessert wurde, ganz abgeschaltet wurde das bislang aber nicht. Ein Roboter mit in sich geschlossenem Chassis hätte dieses Problem erst gar nicht, außerdem haben diese Geräte oftmals das Gehäuse als Bumper und somit letzten Annäherungssensor. Den gibt es beim Blade schlichtweg nicht.
Und dann die Konstruktion der Räder. Klar: Große Räder sorgen normalerweise dafür, dass der Roboter geländegängiger wird – was zu begrüßen ist, denn wessen Rasen eben wie ein Golfplatz ist, der werfe den ersten Halm! Allerdings sorgt die seltsame 45-Grad-Stellung dafür, dass der Roboter einerseits Probleme hat, schräg auf eine Erhöhung wie etwa eine Rasenkante aufzufahren, da er daran einfach immer wieder abgleitet. Selbst im normalen Mähbetrieb mitten auf dem Rasen sorgt das bei einem normal-huckeligen Grün dafür, dass der Mäher keine einzige gerade Bahn hinbekommt. Stattdessen ist das beim Blade immer ein ständiges Gegenlenken: Huckel rechts des Fahrweges und er driftet nach links ab. Huckel links und er schweift nach rechts ab. Zusammen mit der hohen Geschwindigkeit des Mähers, der geduckten Form und dem ständigen Hin- und Hergewackel erinnert der Blade an einen angreifenden Waran – oder einen Besoffenen. Dadurch ist auch das eigentliche Schnittbild hinterher nie so akkurat, wie man es sich wünschen würde und von der Konkurrenz kennt.
Nicht zuletzt bleibt die elektronische Verstellung der Mähteller-Höhe ein Problem. Im Test zeigte sich schnell, dass der Mähteller nicht richtig starr, sondern weich in den einstellbaren Höhen verankert ist. Das führt dazu, dass er bei kleinen Schlaglöchern im Rasen nach unten federt und so die eingestellte Höhe unterschreitet. Das ist im Betrieb schön durch ein kurzzeitig intensiveres Schnittgeräusch zu hören. Zudem scheint die Schnitthöhe selbst auf den maximalen 80 Millimeter bestenfalls genauso hoch zu sein, wie beim Ecovacs Goat G1 bei dessen maximal 60 Millimeter. Das alles führt dazu, das böse Zungen den Blade durchaus nicht ganz zu Unrecht als Flawed Concept bezeichnen könnten.
Hinzu kommen etliche Probleme durch nicht ausgereifte Software, die wie erwähnt den Eindruck erwecken, der Blade hätte noch mehr Zeit gebraucht. So ist etwa die Mähhöhe bei verschiedenen Starts unterschiedlich gewesen, obwohl in der App nichts anderes eingestellt wurde. Eine erneute Bestätigung der Schnitthöhe (in unserem Fall 80 Millimeter) brachte nichts. Erst, nachdem die Höhe auf einen deutlich niedrigeren Wert gesenkt, gespeichert und dann wieder auf 80 Millimeter erhöht wurde, hob der Roboter den Mähteller höher als zuvor. Gerade im Hochsommer kann das schnell dazu führen, dass der Rasen in der Mittagssonne verbrennt, wenn er zu kurz geschoren wird. Zudem funktionierte die Hinderniserkennung entgegen dem Goat G1 mittels der Frontsensoren bis zuletzt nicht fehlerfrei – besser als am Anfang, aber eben nicht zu 100 Prozent verlässlich. Und wenn das Hindernis (etwa die bereits erwähnte Stange) erkannt wurde, weicht der Blade ihm sehr großzügig aus – gut 1 m² blieb um die Stange unbearbeitet. Hier ist noch einiges an Potenzial vorhanden.
Ein weiteres Problem könnte man auf das Wetter schieben. Während des mehrwöchigen Tests regnete es immer wieder und der Boden war oft weich und tief. Daher setzten sich die groben Stollen der Antriebsräder schnell zu und der Mäher verlor den Grip. Als Resultat fuhr er sich immer wieder mal fest – oft auch in den gleichen Löchern, die er an früheren Tagen gegraben hatte. Das deutet darauf hin, dass der Mäher einerseits sehr exakt fährt, andererseits so aber auch die Gefahr von permanenten Fahrspuren verstärkt. Hier fehlt es noch an Feintuning. Denn statt rechtzeitig zu merken, dass er zwar fahren will, sich aber nicht bewegt, grub sich der Blade gern bis zur halben Radtiefe ein. Was das für den Rasen bedeutet, dürfte klar sein. Man könnte das wie gesagt auf das Wetter schieben – der gleichzeitig getestete Ecovacs Goat G1 (Testbericht) hatte allerdings keines dieser Probleme oder sie waren deutlich schwächer ausgeprägt. Daher dürfte es sich auch hier wieder um ein konstruktionsbedingtes Problem handeln. Zudem verklumpte unter dem Mähteller des Blade auch deutlich mehr nasser Grasschnitt als beim Konkurrenten.
Was fährt der Mäher auch bei so einem Wetter – könnte man fragen. Tatsächlich sollte der Mäher aber genau das können, denn ansonsten wäre ein anders, vielversprechendes Feature nämlich völlig überflüssig: der Fangkorb, mit dem der Blade Laub aufsammeln können soll. Denn das dürfte hauptsächlich im Herbst hilfreich sein und in dieser Jahreszeit ist es draußen bekanntlich auch nicht gerade staubtrocken. Wir haben den optional erhältlichen Fangkorb kurz ausprobiert. Der Blade wird dadurch etwas unbeweglicher, hat damit aber keine großen Probleme. Mangels Laub konnten wir die eigentliche Funktionalität allerdings leider nicht testen. Schade – genau das ist nämlich eine Sache, die den Ecoflow Blade einzigartig auf dem Markt macht. Alle anderen Mähroboter können nur mähen. Eine Sache störte uns außerdem: Der Roboter erkennt nur hinten frühzeitig, wenn er angehoben wird. Bei Drehungen auf der Stelle, bei denen die Vorderräder verkannten, kann er sich aber selbständig vorn um etwa 30 oder 40 Grad seitlich anheben und gibt dann den Blick auf die wirbelnden Messer preis – dass der Blade das nicht als Anheben erkennt, finden wir potenziell gefährlich!
Das klingt jetzt alles insgesamt nicht wirklich gut, aber es ist längst nicht alles schlecht. Tatsächlich bietet der Rasenroboter durchaus einige Vorteile. Denn einerseits dürften die meisten der angesprochenen Probleme durch kommende Updates abgestellt werden können und mit der Laubsammel-Funktion bietet der Roboter schon jetzt einen echten Mehrwert. Und da ist mehr. So ist die Geschwindigkeit des Blade bislang von keinem Konkurrenzprodukt erreicht. Das bedeutet, dass der Blade in kürzerer Zeit mehr Fläche mähen kann, womit auch die realistisch machbare Mähfläche pro Tag deutlich höher als etwa beim Ecovacs Goat G1 ist. Gleichzeitig erhöht sich dadurch aber auch die Lautstärke von etwa 45 auf 55 Dezibel – soweit wir das bestimmen konnten. Wie schwierig eine Messung im Freien ist, haben wir bereits im Test des Ecovacs Goat G1 beschrieben.
Ein weiterer Vorteil des Blade ist die eingebaute eSIM. Sie ist für das erste Jahr für den Käufer des Mähers kostenfrei und voll nutzbar. Dabei dient sie einerseits der Steuerung von unterwegs auch außerhalb des WLANs, dem Übermittels von Fehlerprotokollen an den Hersteller und als Diebstahlschutz. Da es keinen Sicherheits-PIN-Code gibt, wird hierüber wie weiter oben beschrieben der Roboter geortet und bei Diebstahl deaktiviert. Nach dem ersten Jahr bleiben die wesentlichen Funktionen der eSIM erhalten, allerdings entfallen alle Live-Services wie etwa die Positionserkennung auf dem eigenen Grundstück. Wer das weiter nutzen will, muss über die App die Funktion kostenpflichtig wieder herstellen. Das soll knapp 30 Euro pro Jahr oder umgerechnet etwa 2,5 Euro pro Monat kosten.
Dafür verspricht Ecoflow für den Blade auf seiner Website einige Service-Extras, die es so bei der Konkurrenz nur bedingt gibt. Dazu gehören bis zu 4 Jahre Garantie (3 Jahre Standard +1 Jahr nach Kontaktaufnahme mit Ecoflow per Whatsapp) und ein kostenloses Service-Team mit Vor-Ort-Austausch aller im Lieferumfang enthaltenen Komponenten wie GPS-Antenne, Kabel oder Ladestation im Fall eines Defekts.
Akku
Der Akku im Ecoflow Blade liefert 298 Wh und soll für eine Dauerbetriebszeit von 240 Minuten reichen. Danach geht es etwas mehr als 2 Stunden zum Nachladen. Im schnellen Modus schaffte der Mäher im Test gute 400 m² am Stück und musste dann nachladen. Damit erscheint eine Tagesleistung von um 1200 m² reine Rasenfläche realistisch.
Preis
Satte 2999 Euro UVP verlangt Ecoflow für den Blade, hinzu kommen 799 Euro für den Fangbehälter und Laubsammler. Im Paket spart der Kunde in der UVP knapp 100 Euro.
Zum Prime Day 2023 gibt es den Ecoflow Blade für 2399 Euro. Weitere gute Angebote zeigen unsere Prime-Day-Deals.
Fazit
Der Ecoflow Blade hat tolle Ansätze, aber er hätte noch etwas mehr Entwicklungszeit gebraucht – in allen Stadien der Entwicklung. Dann wäre er vielleicht nicht mit den seltsamen „omnidirektionalen Vorderrädern“ gebaut worden und das hätte ihm und den Nutzern das Leben leichter gemacht. Während sich das nun nicht mehr ändern lässt und im Alltag zum Glück auch kein unüberwindbares Hindernis darstellt, ist die Software die nächste Baustelle. Sie unterstreicht den Eindruck, der Blade hätte noch einige Wochen oder Monate für Feintuning gebraucht. Denn auch wenn er auf dem Papier dank des Zonenmanagements und dem nachträglichen Hinzufügen von Mähflächen durchaus wichtige Funktionen bietet, die der Ecovacs Goat G1 (Testbericht) derzeit noch nicht hat, ist der Blade das weniger runde Paket. Seine Hinderniserkennung ist klar schlechter, sie ist einfach zu unzuverlässig. Und die Räder graben sich zumindest bei Nässe trotz des grobstolligen Profils der Antriebsräder gerne ein – der Blade merkt das erst, wenn er einen halben Pool gebuddelt hat.
Dafür ist er enorm schnell und schafft klar mehr Fläche pro Tag, was ihn auch für größere Rasenflächen (Rasenfläche =/ Grundstück!) geeignet macht. Und er hat mit dem Laubsammler sowie dem entsprechenden Anschluss dafür eine Zusatzfunktion, die in Zukunft theoretisch sogar noch erweitert werden könnte. Das ist einzigartig auf dem Markt für Privatanwender. Hinzu kommt eine eingebaute eSIM, über die das Gerät auch außerhalb der WLAN-Reichweite erreichbar ist und die im Falle eines Diebstahls genaue Ortung des Blade erlaubt – sofern er eingeschaltet bleibt. Das alles ist klasse, aber der Preis von satten 3000 Euro plus Fangkorb steht derzeit in keinem Verhältnis zum Nutzen – vor allem nicht, wenn man das mit teils deutlich günstigere Konkurrenzprodukten vergleicht.
Der im Fazit verlinkte Ecovacs Goat erscheint zum jetzigen Zeitpunkt – auch wenn er ebenfalls nicht perfekt ist – als die bessere Wahl, sofern man ohne die Laubsammelfunktion auskommen kann. Generell Angaben zu Mährobotern ohne Begrenzungsdraht geben wir in unserem entsprechenden Ratgeber. Hilfreiches Zubehör für Rasenroboter haben wir in einem weiteren Ratgeber zusammengestellt.
Mammotion Yuka 1500 / 2000
Testsieger
Mammotion Yuka 1500 / 2000
ab 1699 EUR
Nach Luba und Luba 2 hat Mammotion nun den Yuka auf den Markt gebracht. Er ist günstiger und kommt auf Wunsch mit einem praktischen Sammelbehälter zum Kunden. Wie gut er wirklich ist, zeigen wir im Test.
VORTEILE
- Navigation per RTK und Kamera
- kein Begrenzungsdraht nötig
- sehr umfangreiche App
- gute Positionierung und Navigation
- ordentliche Hindernisvermeidung
- optionaler Sammelbehälter
- fast so gut wie Luba 2, aber günstiger
NACHTEILE
- mit Sammelbehälter (Kehrmaschinen-Kit) stark eingeschränkte Steigfähigkeit
- schwer
Mammotion Yuka im Test: Toller Mähroboter ohne Begrenzungsdraht mit Sammler
Nach Luba und Luba 2 hat Mammotion nun den Yuka auf den Markt gebracht. Er ist günstiger und kommt auf Wunsch mit einem praktischen Sammelbehälter zum Kunden. Wie gut er wirklich ist, zeigen wir im Test.
Update: Inzwischen konnten wir auch das Kehrmaschinen-Kit (Fangkorb) ausführlich testen. Der entsprechende Bereich wurde ergänzt.
Der Hersteller Mammotion hat mit seinen Mährobotern ohne Begrenzungsdraht Luba (Testbericht) und Luba 2 (Testbericht) bereits unter Beweis gestellt, dass man auch als recht junges Start-up Roboter bauen kann, die die etablierte Konkurrenz das Fürchten lehren. Nicht ohne Grund ist der Mammotion Luba 2 zum Testzeitpunkt unangefochtene Nummer Eins in unserer Bestenliste für Mähroboter ohne Begrenzungsdraht (Topliste). Neben dem hohen Gewicht drückt aber vor allem der nicht zu vernachlässigende Preis auf Gemüt und Bankkonto von Interessenten der Luba-Modelle. Mit dem neuen Mammotion Yuka ist das zumindest etwas anders. Zudem bringt der neue Roboter auf Wunsch einen Sammelbehälter mit, mit dem er Laub, Tannenzapfen und andere kleine Dinge vom Rasen aufsammeln, sie an eine in der App bestimmte Stelle bringen und dort ausleeren kann. Dafür ist der Yuka nur für Flächen von 1500 oder 2000 Quadratmeter ausgelegt und ist nicht nur äußerlich im Vergleich zu den Luba-Modellen verändert. Was das genau bedeutet, klären wir im Test.
Was sind die Highlights des Mammotion Yuka?
- Kommt ohne Begrenzungsdraht aus
- Navigiert per GPS und Kamera
- Objekterkennung mit Kamera
- Scheibenwischer vor Kameras
- Breite Schnittfläche
- Umfangreiche App
- Optionaler Sammelbehälter (Kehrmaschinen-Kit)
- Günstiger als Luba-Modelle
Den Mammotion Yuka gibt es als Yuka 1500 und Yuka 2000. Die Modelle kosten zum Testzeitpunkt 1499 Euro und 1799 Euro, der Sammelbehälter (Kehrmaschinen-Kit) kostet 700 Euro extra.
Wie ist das Design des Mammotion Yuka?
Die Luba-Mähroboter von Mammotion sind für ihr auffälliges Design bekannt, das an kleine, ferngesteuerte Rennautos erinnert. Auch einige technische Ansätze, die in RC-Cars wiederzufinden sind, wurden anfangs von der Konkurrenz belächelt, stellten sich im Alltag aber schnell als funktional und hilfreich heraus. So sorgt die Federung der Vorderachse wirklich für ordentliche Geländegängigkeit und der Vierradantrieb mit der Möglichkeit zum Wenden auf der Stelle ist zumindest auf vollem, trockenem Grün mehr Vor- als Nachteil. Im Gegensatz zur Rennwagen-Optik der anderen Modelle setzt Mammotion beim Yuka auf ein völlig neues Design.
Tatsächlich orientiert sich der Yuka – scherzhaft gesagt – in unseren Augen an einer ganz neuen Dimension. Denn uns erinnert die grobe Form des Mähroboters von oben betrachtet an ein Raumschiff der Galaxy- oder Intrepid-Klasse aus Star Trek, namentlich an die USS Enterprise oder die USS Voyager. Dabei entspricht der weiterhin weiße vordere Korpus der Untertassensektion, während die hinteren ausgestellten Antriebsräder die Warp-Gondeln darstellen. So oder so: Der Mammotion Yuka sieht schnittig und schick aus. Den „Frontspoiler“, der bei den Luba-Modellen den Frontbumper darstellt, gibt es nicht mehr. Stattdessen dient die „Untertassensektion“ nun komplett als Bumper und der Roboter erkennt so nicht nur, wenn er frontal anstößt, sondern auch seitlich. Leider ist er wieder recht schwer. Immerhin wiegt er mit jetzt „nur noch“ 15,6 kg rund 3 kg weniger als die Luba-Modelle und mangels Vierrad-Antriebs setzt er dem Rasen dadurch etwas weniger zu. Schwerer als viele Kontrahenten ist er damit aber immer noch.
Kein AWD (All Wheel Drive) mehr? Richtig, denn angetrieben sind jetzt nur noch die hinteren großen Räder aus Kunststoff mit starkem Profil. Vorn und vom Chassis verdeckt installiert Mammotion hingegen nur noch ein einzelnes, um 360 Grad schwenkbares Stützrad, sodass der Yuka jetzt wie der Großteil der Konkurrenz recht herkömmlich fährt. Anders ist auch die Art der Verstellung der Mähhöhe. Denn die lässt sich jetzt nicht mehr elektronisch per App verstellen, sondern nur noch mechanisch oben auf dem Roboter. Der einstellbare Bereich variiert dabei jetzt von 20 bis 90 mm, beim Luba 2 (Testbericht) ist bei 70 mm Schluss. Dafür durften Nutzer dort auch Halbzentimeter-Schritte wählen, beim Yuka nur noch volle Zentimeter. Immerhin klappt die Einstellung einfach und man braucht weder Kraft noch ist sie hakelig: einfach den Drehknopf drücken und dann drehen.
Und es gibt noch weitere Unterschiede. Bei den Luba-Modellen gab es vereinzelt Beschwerden über die schnell verschmutzenden Kameras, Mammotion installiert daher beim Yuka nun einen Scheibenwischer vor den Linsen. Nutzer können den per App manuell auslösen. Außerdem gibt es eine weitere Kamera. Die ist oben auf dem Roboter installiert und schaut nach schräg oben und hinten, um Hindernisse beim Zurücksetzen erkennen zu können. Andere Form, andere Ladestation. Die verfügt nun über zwei große Metallkontakte, die sich beim Andocken in den Roboter bohren. Da er die entsprechenden Gegenstücke vorn trägt, fährt er entsprechend vorwärts in die Ladestation. Bei den Lubas ist das andersherum. Die RTK-Antenne ist die gleiche wie beim Luba 2, entsprechend gibt es wieder ein zusätzliches Netzteil, damit sie auch abseits der Ladestation installiert werden kann und die Reichweite soll bis zu 5 km betragen.
Eine Neuerung am Yuka ist die Möglichkeit, einen Fangkorp, den sogenannten Sweeper, hinten an ihm zu befestigen. Damit soll der Roboter später Gras, Blätter und anderen leichten „Abfall“ von der Rasenfläche aufsammeln und an frei definierbaren Orten wieder abliefern können. Der Korb mit eigenem Zusatzakku wird über eine Kabelverbindung mit dem Roboter verbunden. Der hat dafür hinten oben eine Buchse, die bei unserem Testgerät mit einer nicht übermäßig fest sitzenden Gummiabdeckung gegen Feuchtigkeit verschlossen ist.
Wie gut ist die App des Mammotion Yuka?
Der Mammotion Yuka verbindet sich über die gleiche App, über die sich auch die Lubas steuern lassen. Entsprechend profitieren auch hier Kunden von den umfangreichen Funktionen der Lubas und der guten Übersicht der App. Unterschiede in der Steuerung kommen von den Unterschieden der Roboter: Da beim Yuka die Mähhöhe nicht mehr elektronisch eingestellt wird, entfällt der entsprechende Punkt, dafür gibt es jetzt weitere Einstellmöglichkeiten für den Sweeper genannten Sammelbehälter. Dazu gehören für die Mähkarte die Option, Ausleer-Punkte für gesammelte Abfälle zu definieren und beim Mähen, die Option „Gras sammeln“ zu aktivieren oder zu deaktivieren. Neu ist in der First-Person-Sicht durch die Kamera des Yuka zudem die Option, den Scheibenwischer vor den Kameralinsen manuell auslösen zu können. Der Rest ist gleich – und zwar gleich gut.
Dank der vielen Einstellungen, wie er etwa mit Hindernissen umgehen soll, schlägt er sich auf Wunsch wie die Lubas „ins Gebüsch“ („langsamer Touch“), während weniger kontaktfreudigere Optionen („Weniger/keine Berührung“) ihn dazu bringen, sich überwiegend auf Ultraschall und Kamera bei der Navigation zu verlassen. Dann werden etwa in die Rasenfläche ragende Äste als Hindernis erkannt und umfahren. Mehr Informationen dazu geben wir in unserem Test des Mammotion Luba 2 (Testbericht). So wie dort per Update gibt es beim Yuka übrigens direkt bei Auslieferung die Option, sogenannte Pattern in den Rasen zu mähen. Diese vordefinierten Muster und die Buchstaben des Alphabets benötigen allerdings viel Platz, wie wir bereits in einem Update im Luba-2-Test bemerkt haben. Die maximal anlernbaren Grüßen der Rasenflächen betragen bei den Modellen Yuka 1500 und 2000 übrigens 1800 und 2400 m².
Wie gut navigiert und mäht der Mammotion Yuka?
Der Mammotion Yuka nutz viel Technik des Luba 2 und hat zusätzlich einen Scheibenwischer vor den Kameras | TechStage.de
Der Mammotion Yuka navigiert genauso gut und präzise wie die Luba-2-Modelle, deren Technik er weitestgehend teilt. Hauptunterschiede betreffen abgesehen vom Sweeper die Mähbreite, die mit etwa 32 cm schmaler ist, die namensgebenden Rasengrößen sowie die machbaren Steigungen. Die liegen bei den Yuka-Modellen bei 45 statt 80 Prozent, mit angeschnalltem Kehrmaschinen-Kit sind es sogar nur 18 Prozent (10 Grad). Generell kann sich ein Luba 2 deutlich besser auf schiefen Ebenen halten, da er nicht nur mit allen vier Rädern „fest auf dem Boden steht“, sondern sie auch angetrieben sind und so ebenfalls Drehungen und Kurvenfahrten dienen. Dreht der Yuka an einem Hang, wird er während der Drehung schnell ungewollt aus der Bahn gezogen, sobald das Gewicht, das auf der ungelenkten vorderen Stützrolle lastet, den Hang hinab ins Rollen kommt. Dann muss der Yuka erst immer sein eigenes Gewicht einfangen und neu ausrichten, bevor er weiter seine Bahnen ziehen kann. Der Luba 2 ist für steile Hügel und abschüssige Gelände zweifelsfrei die bessere Wahl, da er nicht nur mit mehr Steigung klarkommt, sondern an der Schräge sicherer fährt.
Davon abgesehen ist der Mammotion Yuka aber gerade für engere, verwinkelte und einfach feinere Gärten mit wenig Steigung die bessere Wahl. Denn dank des auf zwei Rädern reduzierten Antriebs und des etwas niedrigeren Gewichts schadet er bei Drehungen der Grasnarbe weniger. Das gilt zumindest, solange er nicht mit dem Stützrad irgendwo hängen bleibt und das in den ersten Sekunden nicht bemerkt. Dann drehen die hinteren Antriebsräder nämlich durch und versuchen, den Roboter auf den geplanten Weg zu bringen. Dabei schiebt sich der Yuka hinten gern mit durchdrehenden Rädern seitlich weg und reißt dabei wie der Luba 2 den Rasen auf – übel, aber das machen andere Mäher auch. Wer einen halbwegs ebenen Rasen hat, wird davon aber normalerweise verschont bleiben.
Stattdessen profitiert er eher vom „Ganzkörper-Bumper“, der auch bei Drehungen an der Seite auslöst. Alles andere ist genau wie beim Luba 2. Das betrifft etwa die stabile Ortung seiner Position, die nur bei dichter Wolkendecke und zusätzlich unter Sträuchern mal für kurze Zeit zum Problem werden kann. Hinzu kommen der Diebstahlschutz mittels eingebautem 4G-Modul (SIM-Karte muss selbst beschafft werden!) und die Erkennung sowie das Umfahren von Hindernissen wie Tieren, Gartenschläuchen oder Werkzeugen auf dem Grün. Mehr dazu haben wir im Test des Mammotion Luba 2 (Testbericht) ausgeführt. Wie immer der Hinweis: Mähroboter sollten zum Schutz für Tiere nicht unbeaufsichtigt und nicht nachts oder in der Morgen- oder Abenddämmerung fahren!
Wie gut sammelt der Mammotion Yuka mit dem Kehrmaschinen-Kit Laub und Gras?
Wir hatten es bereits erwähnt: Einer der großen Unterschiede zum Rest der Mähroboter ohne Begrenzungsdraht ist der mit Kehrmaschinen-Kit bezeichnete Fangkorb, mit dem der Mäher Gras, Laub und sonstige leichte Grünabfälle sammeln können soll. Das bot bislang nur der Ecoflow Blade (Testbericht), der allerdings seinerzeit nur bedingt überzeugte und inzwischen nicht mehr produziert wird. Anschließend darf der Nutzer in der App einen oder mehrere Ablageorte definieren, an denen der Bot den Fangkorb immer wieder leeren soll. Neben der Rasengröße, für die Yuka 1500 und Yuka 2000 gedacht sind, unterscheiden die beiden Modelle sich übrigens durch die anlernbaren Mäh- und Kehrzonen, die beim 2000er-Modell 20 statt 10 und 100 statt 50 betragen.
Das Kehrmaschinen-Kit besteht aus mehreren Teilen, die nach Lieferung ziemlich einfach innerhalb weniger Minuten zusammengebaut werden. Die beigefügte Anleitung ist dabei sehr hilfreich, benötigtes Werkzeug ist dabei. Neben dem Zusammensetzen des Fangkorbs muss auch Hand an den Yuka gelegt werden. Denn im Lieferumfang des Kehrmaschinen-Kits befindet sich ein Zusatzakku, der in den Roboter eingebaut werden muss. Dafür wird eine Abdeckung hinten unten am Mäher entfernt, der Zusatzakku mit den passenden Steckern verbunden und alles wieder zusammengebaut. Der Zusatzakku sorgt dafür, dass die motorisch betriebene Sammelrolle des Fangkorbs nicht an der Akkulaufzeit des Roboters zehrt. Entsprechend konnten wir mit angelegtem Kehrmaschinen-Kit keine Verschlechterung der Laufzeit des Yuka ausmachen.
Das Kehrmaschinen-Kit besteht aus zwei Teilen. Eines enthält die Technik samt motorisierter Sammelwalze, daran angehängt wird der eigentliche Fangkorb, den der Roboter später automatisch ausleeren kann. Die weiße Kunststoffabdeckung über der Kamera des Roboters wird gegen ein 1,5 Kg schweres Gewicht getauscht, damit der Roboter wegen des weit hinten überhängenden Kehrmaschinen-Kits vorn nicht zu leicht wird. Abschließend wird das Kabel des Fangkorbs mit dem Roboter verbunden.
Die Technik wird sehr einfach von oben hinten an Roboter und Hinterachse arretiert, sodass der Yuka in wenigen Sekunden vom bloßen Mäher zum Mäher und Sammler umgerüstet werden kann. Der Fangkorb selbst wird genauso einfach hinten an den Technikrucksack angehängt.
Mit dem Kehrmaschinen-Kit bieten sich in der App neue Optionen – die sind zwar auch ohne angelegte Fangkorb-Technik anwählbar, werden dann aber ignoriert. Dazu gehört das Feature, dass der Roboter nun "Gras sammeln" soll, das Intervall für das Ausleeren des Fangkorbs sowie das Anlegen von Ausleerorten. Die dürfen sich auch außerhalb der eigentlichen Mähkarte befinden und werden dann per Pfad angegliedert. So muss der Rasenabfall nicht auf, sondern kann auch neben der Wiese abgeladen werden. Tipp: immer mehrere Ablageorte einrichten, damit der Yuka nicht immer den gleichen Weg zum einzigen Sammelort fahren muss. Das spart Zeit und verhindert, dass sich wegen der häufigen Fahrt auf genau der gleichen Bahn Spuren im Gras bilden. Das Intervall ist ab Werk 10 m² eingestellt – das war uns zu häufig. Zu groß sollten die Flächen bis zum nächsten Leeren aber auch nicht werden, da der Fangkorb viel schneller gefüllt ist, als man zuvor glaubt. 15 bis 20 m² stellte sich im Test als guter Kompromiss heraus.
Anschließend fährt der Yuka in den eingestellten Intervallen zu den Ablageplätzen, dreht sich, öffnet automatisch wie ein Müll-LKW den Fangkorb nach oben und schüttelt den Rasenabfall aus. Das klappt zuverlässig immer wieder, allerdings kann es an anderer Stelle Probleme geben. So schwenkt der Yuka mit angelegtem Fangkorb mit dem Heck nun deutlich weiter aus, sodass er mit dem Kehrmaschinen-Kit beim Drehen immer mal wieder mehr oder weniger stark in Büsche oder vor Hauswände drückt. Das kann dann problematisch werden, wenn sich das Netzgewebe des Fangkorbs in Dornen oder Ästen verhakt, sodass er dann abgerissen wird. Dabei ging er im Test zwar nicht kaputt, musste aber 2x in mehreren Wochen anschließend gesucht werden. Außerdem ist die Lautstärke des Fangkorbs erwähnenswert. Durch das "Schlagen" der einzelnen Gummilamellen auf das Gras in sehr hoher Folge ist der Betrieb des Kehrmaschinen-Kits deutlich lauter als der eigentliche Mäher. Das geht zwar durchaus noch und vermutlich wird niemand dabei von "Lärm" sprechen, aber auf Sonntagsfahren mit Kehrmaschinen-Kit würden wir zum Erhalt des Nachbarschaftsfriedens eher verzichten.
Ansonsten macht das Kehrmaschinen-Kit seine Sache sehr gut. Dinge, die klein und leicht genug sind, um physikalisch in den Fangkorb befördert zu werden, landen normalerweise auch dort. Dank schwimmender Aufhängung der Motorwalze kommt diese eigentlich immer auf den Boden und ist gleichbleibend effektiv. Wir empfehlen, den Yuka mit Kehrmaschinen-Kit langsam und am besten im Schachbrettmuster fahren zu lassen. So erwischt er das Maximum an Abfällen – und das ist erstaunlich viel. Mit der beschriebenen Methode benötigt der Yuka mit angelegtem Fangkorb zwar einen ganzen Tag für rund 600 m² Rasenflächen, sammelt aber auch einen großen Haufen von (unkomprimiert) sicherlich um 40 Liter an abgestorbenem Rasenschnitt, Blättern und sonstigen Grünabfällen auf. Ein- oder zweimal im Monat finden wir die Nutzung des Kehrmaschinen-Kits absolut sinnvoll.
Wie gut ist der Akku des Mammotion Yuka?
Mit dem Akku des von uns getesteten Yuka 1500 schaffte der Roboter im Test bei uns knapp 400 m² mit einer Randfahrt, bevor es zurück zum Laden geht. In der Station verharrt der Mäher dann rund 2 Stunden, bevor er seine Arbeit fortsetzt. Durch das Kehrmaschinen-Kit ändert sich das nicht gravierend. Wegen der neuen Ladestation mit den beiden Ladedornen, die sich bei Einfahrt des Roboters in dessen Front „bohren“, ist es besonders wichtig, dass die Station auf ebenem Boden steht. Bei uns kam es anfangs vor, dass der Yuka nicht andocken konnte, sondern vor der Station stehenblieb. Später, eventuell auch durch ein Update, kam das nicht mehr vor.
Preis
Regulär kosten die Versionen Yuka 1500 und Yuka 2000 in der UVP des Herstellers 1699 und 1999 Euro. Wer das Kehrmaschinen-Kit will, zahlt etwa 700 Euro extra. Derzeit kosten die Modelle beim Hersteller und bei Amazon 1499 Euro (Yuka 1500) und 1799 Euro.
Fazit
Der Mammotion Yuka ist ein toller Mähroboter ohne Begrenzungsdraht, der in Gärten ohne besondere Steigungen sogar der bessere (weil günstigere) Luba 2 ist. Das Design ist funktional und modern, die Navigation dank RTK und Kameras präzise und effizient. Letztere helfen auch dabei, Objekte und Tiere zu umfahren, statt sie zu überfahren. Hinzu kommt der optionale Laubsammler (Kehrmaschinen-Kit), der richtig gut funktioniert und für gelegentliche Fahrten einen echten Mehrwert bietet. Er erweitert den praktischen Nutzen des Roboters zusätzlich.
Der aktuelle Preis von 1499 Euro ist in Relation zur Konkurrenz dank toller Funktionen und sehr guter Navigation gerechtfertigt. Das Kehrmaschinen-Kit für 700 Euro finden wir allerdings etwas teuer, auch wenn es gute Arbeit leistet. da waren die Anfangsangebote deutlich attraktiver. Der Mammotion Yuka ist aus den genannten Gründen in seiner Gesamtheit unsere neue Nummer Eins, der Luba 2 (Testbericht) bleibt aber besser, wenn der Garten besonders groß und/oder steil ist.
Ecovacs Goat G1
Ecovacs Goat G1
ab 899 EUR
Das lästige Verlegen des Begrenzungsdrahtes entfällt beim ersten Mähroboter von Ecovacs. Im Test schlägt sich das Modell für ein Erstlingswerk richtig gut, kommt aber nicht ganz ohne Beanstandung aus.
VORTEILE
- sehr gute Navigation und Hinderniserkennung
- perfekte Signalabdeckung dank Beacons
- schnurgerade Bahnen, hohe Verlässlichkeit
- schickes Design
- tolle App
- niedriger Preis (für einen GPS-Mäher)
NACHTEILE
- (derzeit) keine Anpassungsmöglichkeit der Karte!
- Mähzeit mit einer Akkuladung etwas niedrig
- Beacons optisch Geschmackssache
- mehr Beacons erhöhen Kaufpreis beträchtlich + Unterhaltskosten durch Batterien
Mähroboter ohne Begrenzungskabel im Test: Der Ecovacs Goat G1 schneidet gut ab
Das lästige Verlegen des Begrenzungsdrahtes entfällt beim ersten Mähroboter von Ecovacs. Im Test schlägt sich das Modell für ein Erstlingswerk richtig gut, kommt aber nicht ganz ohne Beanstandung aus.
Die neuen Rasenroboter, die ohne Begrenzungsdraht auskommen, sind so etwas wie Tesla bei Autos: Sie bringen frischen Wind in die Branche und bieten Möglichkeiten, die es zuvor nicht gab – etwa OTA-Updates (Over the Air), die neuen Funktionen mitbringen. Doch die neuen Möglichkeiten bringen auch neue Probleme mit sich. Wir klären im Test, welche das (derzeit noch) sind. An anderer Stelle zeigen wir in unserer Bestenliste die derzeitigen Top-Mähroboter.
Aktuell gibt es den Goat G1 für Rasen bis 1600 qm günstiger. Man bekommt ihn aktuell (13.04.) für 1499 Euro statt 1599 Euro.
Design und Verarbeitung
Beim Design des Ecovacs Goat G1 werden Parallelen zu Tesla ersichtlich. Dessen Fahrzeuge beruhen nämlich zweifelsohne auf dem gleichen Grundprinzip für Autos, das schon seit 100 Jahren gilt, erweitern es aber. So hat das Unternehmen von Elon Musk etwa zahlreiche Kameras hinzugefügt und setzt im Innenraum auf ein ziemlich neues, auf Touch-Bedienung über ein riesiges Display basierendes Bedienkonzept. Weiße („vegane“) Lederausstattung mit schwarzen Akzenten gibt es abseits von Tesla bei anderen Herstellern ebenfalls eher in der Luxusklasse. Ecovacs setzt bei seinem Produkt genauso auf eine Mischung aus Bewährtem und Innovation und orientiert sich sogar am gleichen Farbdesign.
Der Goat G1 verwendet ein geschlossenes Chassis, bei dem die Hauptantriebsräder, nicht aber die beiden vorderen Stützräder, zu sehen sind und nichts hervorsteht – ganz wie herkömmliche Rasenroboter. Aber Ecovacs erweitert diese typische Formgebung oben durch einen kantigen Aufsatz, der einerseits die typische Technik wie Kameras beinhaltet, die die Navigation per GPS unterstützt, und andererseits dem Mäher ein futuristisches, technisches Äußeres verleiht. Verstärkt wird dieser Eindruck durch das konsequente Schwarz-Weiß-Design des G1 – das wirkt wie bei Tesla modern, auch wenn es nicht neu ist.
Ecovacs beweist dabei Händchen und hat nicht um jeden Preis Änderungen am bewährten Prinzip von Rasenrobotern vorgenommen, sondern nur da, wo es sinnvoll ist. Denn das geschlossene, tief heruntergezogene Chassis sorgt dafür, dass der Mäher nicht an einzeln aus dem Gehäuse stehenden Elementen wie Rädern hängenbleiben kann und gleichzeitig senkt es die Gefahr, dass der Roboter Gegenstände oder Tiere überfährt. Die wird er in vielen Fällen einfach leicht anrempeln und dann als Hindernisse wahrnehmen, da das Chassis zumindest vorn als letzter Sensor bei Kontakt fungiert, sofern die Kameras potenzielle Probleme nicht schon zuvor erkannt haben.
Während das grundsätzlich noch eher konventionell und daher wenig auffällig wirkt, dürften die meisten Interessenten die kleine Stummelantenne hinten oben links auf dem Mäher schnell als außergewöhnlich erkennen. Denn sieht man die Kameras erst auf den zweiten Blick, zeigt sie zumindest etwas mit der Materie vertrauten Beobachtern, dass der Goat nicht einfach nur stumpf einem Begrenzungsdraht folgt, sondern mehr kann.
Zum Thema Verarbeitung gibt es wenig Negatives zu sagen. Der Kunststoff des Mähers macht einen ordentlichen Eindruck, das gilt für die Ladestation und auch für den Mäher selbst. Insgesamt macht alles einen langlebigen Eindruck. Nicht ganz optimal ist hingegen ein Umstand, der uns im laufenden Betrieb aufgefallen ist: Unter einer von oben zugänglichen Schutzklappe befindet sich ein kleines Monochrom-Display samt Steuerungstasten sowie die manuelle Höhenverstellung für das Schnittwerk – ganz wie bei herkömmlichen Schleifenmähern. Obwohl der Goat G1 wasserfest ist und weder Schaden durch Regen noch einen mäßigen Strahl aus einem Wasserschlauch zum Säubern nimmt, beschlug bei schlechtem Wetter der durchsichtige Kunststoff der Abdeckung, das den Blick auf das Display freigibt. Dabei schien es sich aber in erster Linie um Kondenswasser zu handeln, da das auch vorkam, wenn der Ecovacs-Mähroboter bei Regen unter einer Mähroboter-Garage stand.
Apropos Ladestation: Die kommt mit für einen Mähroboter ungewöhnlicher Form zum Käufer. Bei ihr handelt es sich nicht um eine einfache Lade-, sondern auch um eine Reinigungsstation – entsprechend weist sie eine gewisse Turm-Form auf, unter die der Roboter zumindest mit der vordersten Spitze drunter fährt. Der Grund ist einfach: Da die Kameras (nach vorn gerichtete Fischaugenoptik sowie eine Rundum-Kamera oben auf dem Mäher) für die Navigation essenziell sind, reinigt Ecovacs sie mittels beweglicher Bürsten vor jeder Mähfahrt. Das bietet derzeit kein anderer Hersteller und wirkt nicht nur technisch hochwertig und innovativ, sondern erscheint auch sinnvoll.
Inbetriebnahme mit der App
Bei der App handelt sich dabei um die gleiche, die der Hersteller auch für Sauger wie etwa den Ecovacs X1e Omni (Testbericht) verwendet. Unterschiede wie komplett andere Menüpunkte durch die andere Aufgabenstellung als bei einem Saugroboter werden erst nach dem Einbinden sichtbar. Die App führt den Käufer Schritt für Schritt in Text und Bild durch den Installations- und Verbindungsprozess mit dem Smartphone, Ecovacs bietet hier das Beste, was wir derzeit von GPS-Mähern kennen. Hier wird die langjährige Erfahrung mit Saugrobotern offensichtlich.
Dabei wählt der Hersteller anfangs eine Mischung aus von Schleifenmähern bekannten Schritten. So erfolgt die Wahl von Sprache und Sicherheits-PIN über die Folientasten oben auf dem Roboter, weiteren Schritte erfolgen in der für iOS und Android erhältlichen App auf dem Smartphone. Mittels Telefon und App lässt sich ganz einfach der QR-Code des Bots abscannen, der sich auf der Unterseite der Abdeckung oben auf dem Gehäuse befindet. Wichtig für die Verbindung mit der App ist laut Hersteller aktiviertes Bluetooth und die Nutzung eines auf 2,4 GHz beschränkten WLANs. Im Test funktionierte das aber auch mit einem Netzwerk, das wahlweise 2,4 und 5 GHz verwendet. Im Jahr 2023 dürften Hersteller allerdings langsam endlich mal dazu übergehen, den alles andere als neuen 5-GHz-Standard zu unterstützen!
Die App erklärt dann unter anderem die Installation der Ladestation und der Beacons, die der Mäher zur Navigation benötigt. Die Beacons sind kleine weiße Säulen (im Lieferumfang befinden sich zudem grünliche Aufkleber, falls Nutzern das im Garten auffällige Weiß nicht zusagt), die im Garten aufgestellt werden müssen, um die Navigation mittels GPS-Signal und Kameras zu unterstützen. Zwei der Signalgeber werden mit dem Roboter zusammen verkauft, weitere müssen Nutzer selbst dazukaufen. Das kann bei knapp 100 Euro pro Beacon schnell ins Geld gehen. Auf unserem mehr oder weniger quadratischen Testgrundstück (etwa 1350 m²) mit halbwegs mittig platziertem Haus wurden von einem Online-Tool des Herstellers insgesamt fünf Beacons empfohlen, die – entgegen der App, die wegen des einfachen Schnitts des Grundstücks nur je ein Beacon in den vier Ecken der Gesamtfläche empfiehlt – nicht in den Ecken, sondern scheinbar willkürlich auf dem Grundstück platziert installiert werden sollten. Einen Link zum Tool gab es zum Testzeitpunkt in der App noch nicht, den will Ecovacs an dieser Stelle aber nachliefern. Hier hätte aber auch ein Blick ins dicke und ausführliche Handbuch geholfen, das der Hersteller mitliefert.
Anmerkung: Den Test haben wir wegen Lieferschwierigkeiten der fünften Signalfackel mit vier Beacons durchgeführt. Sobald das Fünfte ankommt, werden wir hier ein kurzes Update einpflegen. Tatsächlich funktionierte die Navigation im Test trotz in der App angezeigter teilweise zu schwacher Signalstärke auf den Mähflächen überwiegend sehr gut. Einen konkreten Hinweis auf ein zu schwaches Signal bekamen wir nur zwei Mal: Einmal fuhr der Roboter – vermutlich wegen kurzzeitigem Verlust eines ausreichenden Signals - um gute 40 Zentimeter aus dem zuvor festgelegten Bereich heraus und stoppte daraufhin den Mähvorgang. Beim anderen Mal mussten wir das nachträgliche Ausklammern eines Beetes aus der Mähfläche neu beginnen, weil die App einen großen Versatz des Mähers zwischen Start- und Endpunkt feststellte, obwohl der Roboter wieder ziemlich exakt an der Ausgangsposition stand.
Tipp: Die Beacons müssen in der App durch Scan mit dem Smartphone angelernt werden. Der Abstand der Beacons zueinander sollte 45 Meter nicht übersteigen. Weitere Einschränkungen sind etwa ein Mindestabstand von 20 Zentimetern zu kleineren und 60 Zentimetern zu größeren Hindernissen, außerdem sollen die Beacons am Rand der Rasenflächen installiert werden. Was die App nicht sagt: Die Beacons sollten sich beim Anlernen am besten in der Nähe der Ladestation befinden. Ansonsten kann es vorkommen, dass man die Signalfackel, die man zuvor mittels des am unteren Ende platzierten Erdgewindes mühsam in den Boden geschraubt hat, wieder entfernen muss, um sie näher an die Station zu bringen. Und: Als größere Hindernisse gelten auch schon große Büsche oder generell viel Bewuchs. Anschließend testet die App, ob die Beacons ordentlich installiert sind – was bei uns trotz später angezeigter schwacher Abdeckung als ausreichend angesehen wurde. Tatsächlich hatten wir später im Test den Eindruck, dass mit das Wichtigste eine möglichst direkte Sichtlinie der Beacons zu weiteren Signalfackeln ist. Das stellt gerade in großen Gärten mit viel alter Flora unter Umständen ein echtes Problem dar, da so viel mehr Beacons hinzugekauft werden müssen, als man auf den ersten Blick denkt. Ist der Roboter geladen und alle Beacons sind positioniert, kann es mit dem Anlernen der Mähfläche losgehen.
Festlegen der Mähfläche
Einer der größten Vorteile der neuen Mähroboter-Generation wie dem Ecovacs Goat G1 ist der Umstand, dass die mühsame Arbeit der Begrenzungsdraht-Installation entfällt. Stattdessen fährt der Nutzer den Roboter wie ein ferngesteuertes Auto mittels eines virtuellen Joysticks auf dem Smartphone-Displays einmal rund um den zu mähenden Bereich. Auch hierbei unterstützt die App vorbildlich durch Text und Bilder. Start und Zielpunkt ist dabei die Ladestation. Die Steuerung ist dabei feinfühliger als beim Marotronics Alfred (Testbericht), außerdem müssen die einzelnen Navigationspunkte der Perimeterlinie nicht manuell durch Tippen in der App gesetzt werden, sondern die Ziege (Goat = engl. für Ziege) erledigt diesen Punkt allein. Bereiche, die vom Mähen ausgeschlossen werden sollen – etwa Beete inmitten einer Rasenfläche – werden auf gleiche Weise exkludiert. Zudem lassen sich später wie bei einem Saugroboter virtuelle Grenzen setzen, wenn einzelne Bereiche des Rasens nicht gemäht werden sollen. Das kann so kein Schleifenmäher. Beim Erstellen der äußeren Begrenzungslinie sollte der Nutzer einen Abstand von rund 10 Zentimeter zur äußeren Rasenkante halten, damit sich der Roboter später nicht an zu hohen oder niedrigen Randsteinen festfahren kann.
Tipp: Die angegebenen 10 Zentimeter sollten nach Möglichkeit nicht unterschritten werden. Nach der ersten Einrichtung gibt es später noch einen Punkt im Menü des Goat G1, mittels dessen Hilfe der Roboter die äußeren Grenzen noch einmal selbständig optimiert. Dabei soll er nach Aussagen von Ecovacs mithilfe der Kameras noch einmal genau checken, ob er die durch den Nutzer gesteckten Grenzen nicht noch besser nutzen kann. In unserem Fall wurden nach der Ersteinrichtung die Grenzlinien allerdings in gefühlt rund 80 Prozent der Fläche einfach nur noch weiter nach außen verschoben, sodass das Gesamtergebnis insgesamt verschlechtert statt verbessert wurde. Beim ersten Versuch haben wir allerdings auch nach dem Motto „der kann zentimetergenau navigieren – dann soll er das auch machen!“ die 10-Zentimeter-Abstandsregel deutlich unterschritten.
Nach dem Erstellen der Mähfläche kehrt der Roboter automatisch in die Ladestation zurück und fährt anschließend auf „Entdeckungstour“, bei der er sich selbst wortwörtlich ein Bild von seiner Umgebung macht. Erst, wenn das erfolgreich abgeschlossen wurde, ist er bereit für den ersten Mähauftrag.
Ecovacs App
Die App orientiert sich insgesamt stark am bisherigen Design für die Saugroboter des Herstellers. Im Wesentlichen wird in der Mitte die Karte der Mähfläche angezeigt samt Hindernissen, Beacons, Aussparungen und Ladestation. Darüber gibt es Zugriff auf die Kameras des Bots, die eine Live-View erlauben, weitere Karteneinstellungen (hier findet man auch die bereits angesprochene Randoptimierung und virtuelle Grenzen) und die eigentlichen weiteren Einstellungen. Am unteren Rand gibt es Einstellfelder, in denen man den Roboter losschicken oder im Betrieb den prozentualen Mähfortschritt, die Akkuanzeige und mehr sehen kann. Hier darf der Nutzer auch zwischen automatischem Mähvorgang, Kantenschnitt (wird auch im Automodus nach erfolgreichem Flächenschnitt absolviert) und manueller Steuerung wählen. Außerdem dürfen hier zeitgesteuerte Mähvorgänge eingerichtet werden.
Bei der Kameraverwendung hat der Nutzer die Wahl zwischen der Rundum- und der nach vorn gerichteten KI-Kamera. Der Aufbau des Bildes dauert je nach WLAN-Stärke im Garten einige Sekunden und wurde bei uns anschließend stabil wiedergegeben. Allerdings scheint die Bildwiederholungsrate dabei nur bei 1 – 2 Bildern pro Sekunde zu liegen. Das Umschalten zwischen Haupt- und KI-Kamera funktionierte bei uns meist nicht. Ebenfalls noch ausbaufähig: Unten links gibt es in der Live-Übertragung einen Button, der nahelegt, dass der Roboter mittels Blick durch die Kamera auch von unterwegs manuell gesteuert werden könne. Das funktioniert allerdings nur per Bluetooth, andernfalls kam bei uns im Test nur eine kurze Fehlermeldung in chinesischen Schriftzeichen – ein Hinweis darauf, dass der Hersteller hier noch etwas Arbeit vor sich hat. Per Bluetooth erscheint uns diese Funktion allerdings als überflüssig, denn wegen der begrenzten Reichweite des Nahbereichsfunk sollte der Mäher dann ohnehin in Sichtweite sein. Wer will, der darf stattdessen einzelne Patrouillenpunkte setzen, die der Mähroboter automatisch abfährt. Auf Wunsch warnt er dabei erkannte Personen im Umkreis von sieben Metern und nimmt sie als Foto auf.
Im eigentlichen, als kleines Zahnrad oben rechts in der App symbolisierten Menü fällt zuerst die Angabe zur Mäh-Effizienz auf – „fein“ und „effizient“ steht hier zur Wahl. Dahinter verbirgt sich nur die Mähgeschwindigkeit, die bei „effizient“ höher ausfällt. Ansonsten gibt es hier weitere Einstellungsmöglichkeiten für den Regensensor, Tierschutz-Zeiten (!), Einstellungen zum „Hindernisvermeidungsmodus“ und einiges mehr. Der Hindernisvermeidungsmodus legt fest, wie groß Hindernisse sein dürfen, um vom ToF-Sensor (Time-of Flight) auf wenige Zentimeter Entfernung erfasst zu werden, der vorn neben der KI-Kamera positioniert ist. Die Wahl besteht hier zwischen 10, 15 und 20 Zentimetern und sollte bei einmal geschnittenem Rasen zum Schutz von Kleintieren wie Kröten, Katzen und Igeln möglichst niedrig eingestellt werden.
Das soll auch per KI und Kamera klappen. Tatsächlich erkannte die Kamera Hindernisse im Test generell verlässlich, allerdings werden derzeit neben Menschen nur Gartenschläuche, Katzen, Igel und Hunde identifiziert und wirklich als das erkannt, was sie sind. Wie bei Saugrobotern dürfte die Erkennung aber kontinuierlich verbessert und erweitert werden. Für alles andere ist bis dahin eben der ToF-Sensor zuständig. Ab Werk ist diese Erkennung derzeit auch noch abgeschaltet und wird unter der Überschrift „Laborfunktionen“ geführt. Das gilt auch für die Möglichkeit, die Mähscheibe abzuschalten, wenn Menschen im Umkreis von 7 Metern erkannt werden. Unter den „weiteren Einstellungen“ ganz unten kommt man dann zu typischen Punkten wie einem Protokoll bislang ausgeführter Arbeiten, einigen Sicherheitsfunktionen und einer Karte der Netzabdeckung durch die Beacons. Auch eine Überwachung für den Bereich der Ladestation (Ladestationswächter) kann aktiviert werden. Dann warnt der Roboter im Umkreis von 7 Metern als präventiver Diebstahlschutz erkannte Personen, dass sie gerade aufgenommen werden. Warum wir diese grundsätzlich gute Funktion trotzdem abgeschaltet haben, erklären wir später.
Was fehlt, fällt tatsächlich erst nach dem ersten Erstellen einer Mähfläche auf. Nutzer eines Schleifenmähroboters kennen das: Der Begrenzungsdraht wurde verlegt und beim ersten Mähen wird klar, dass er an einer Stelle zu weit nach innen oder außen positioniert wurde. Resultat: Gras bleibt stehen und muss regelmäßig per Hand nachgeschnitten werden oder der Roboter rutscht doch ins Beet und fährt sich fest. Entsprechend heißt es, die Erdnägel des Drahtes wieder lösen und die Führung des Begrenzungskabels anpassen – Problem geklärt. Beim Ecovacs Goat G1 geht das derzeit schlicht und ergreifend nicht. Wer hier nicht die perfekte Fläche abgesteckt hat (und das halten wir für unwahrscheinlich), muss nach derzeitigem Firmware-Stand (1.12.9) die komplette Karte löschen und neu anlegen. Das gilt übrigens auch, wenn eines der Beacons versetzt werden soll. Hier hat der Marotronics Alfred (Testbericht) klar die Nase vorn und auch der Segway Navimow soll das seit einigen Wochen besser machen. Ecovacs erklärte auf Anfrage, dass man im Laufe des Jahres eine Funktion zum Erweitern der Mähfläche nachliefern will. Ob damit auch eine kleinteilige Anpassung bestehender Flächen oder nur das Hinzufügen weiterer Rasenflächen gemeint ist, ließ der Hersteller offen. Ein Zonenmanagement (ähnlich wie die einzelnen Räume bei Saugrobotern) gibt es aktuell ebenfalls nicht.
Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht: Alle Bilder zum Ecovacs Goat G1 im Test
Navigation und Arbeitsalltag
Grundsätzlich hat uns der Ecovacs Goat G1 überzeugt. Er fährt auf freier Rasenfläche schnurrgerade Bahnen, deren Ausrichtung in der App frei bestimmt werden darf. Erkannte Hindernisse wie etwa eine mitten im Rasen steckende Wetterstation mit nur wenige Zentimeter durchmessender Stange erkannte der Roboter zuverlässig, auch ein testweise ausgelegter Gartenschlauch wurde nicht überfahren. Einem weiteren Testgerät wich er zudem immer zuverlässig aus. Im Vergleich zum Marotronics Alfred mit einer einzelnen RTK-Antenne als Referenzsignal ist zudem der Empfang und damit auch die Navigationsgenauigkeit dank der zusätzlichen Beacons auf UBW-Basis in schwieriger Umgebung konstanter. Dadurch verliert die Roboziege weder nah an Hauswänden noch bei dichter Wolkendecke oder unter dichtem Laubwerk die Verbindung – sehr gut!
Die Geschwindigkeit ist im Effizienzmodus sichtbar höher – geschätzt etwa 30 bis 50 Prozent. Gleichzeitig ist allerdings auch die Geräuschemission höher und anders. Generell hört man nicht die Mähscheibe (außer dem typischen, leisen „zwirbeln“, wenn die Halmspitzen abgesenst werden), sondern nur die Motoren, die den Roboter antreiben. Mit höherer Geschwindigkeit wird das Geräusch hochfrequenter und zusätzlich lauter. Generell ist die Arbeitslautstärke aber so niedrig, dass eine normale Nachbarschaft nicht gestört werden sollte. Nur besonders feinfühlige Naturen dürften an diesem Geräusch, das nach wenigen Metern kaum noch zu hören ist, Anstoß nehmen. Wir haben eine Geräuschmessung versucht, allerdings ist das in freier Umgebung gar nicht so einfach. In rund 1,5 Abstand haben wir im langsameren „feinen“ Modus etwa 45 Dezibel gemessen, im „effizienten“ Modus um 50 Dezibel. Allerdings muss dabei gesagt werden, dass schon recht schwacher Wind unser Schalldruckmessgerät locker auf bis zu 60 Dezibel getrieben hat und Vogelzwitschern sogar noch höher kam. Für einen bellenden Nachbarshund oder ein Mopped, das vor dem Haus vorbeifuhr, gilt das erst recht.
Das Hauptproblem ist und bleibt bei Rasenrobotern aber generell der Randbereich und davon ist auch der Goat G1 nicht ganz ausgenommen. Die Navigation erfolgt grundsätzlich zentimetergenau und zuverlässig, wer aber die Karte zu ungenau (oder knapp am Rand) anlegt, muss, Stand heute, alles neu anlernen – das ist höchst unpraktisch. Auch an anderer Stelle muss Ecovacs noch Feintuning betreiben. Ragen etwa Pflanzen in die Mähfläche, werden die wegen der guten Hinderniserkennung dank Kameras(s) als festes Objekt erkannt und der Mäher macht einen Bogen darum. Wo also ein Schleifenmäher oder der handbetriebene Rasenmäher einfach die Äste wegschiebt, wächst beim Goat G1 der Rasen höher und höher, obwohl die eigentlich gesetzte Grenze der Mähfläche längst nicht erreicht wurde. Gleiches gilt für zu hohe Grashalme.
Außerdem fehlt uns ein Nachtmodus – aus zwei Gründen. Einerseits leuchten LEDs an der Ladestation farbig, was nachts einfach stört. Andererseits nervt der Roboter mit minütlichem verbalem Hinweis, dass die Kameraaufnahme aktiviert ist, sofern der Ladestationswächter eingeschaltet wurde - auch, wenn niemand erkannt wird. Da hilft nur das Deaktivieren aller Sprachansagen – oder wie in unserem Fall das Deaktivieren des Wächters-Modus. Der Grund für die nervigen Sprachansagen zur Kamera soll übrigens der Datenschutz sein, aus unserer Sicht hätte man das aber auch sinnvoller umsetzen können – etwa mit entsprechender Ansage nur dann, wenn tatsächlich Menschen erkannt wurden.
Nach Herstellerangaben kann der Goat G1 zudem derzeit keine Korridore durchqueren, die schmaler als 1 Meter sind. Bei uns wurde diese Breite bei Erstellung der Mähfläche mutwillig unterschritten, der Mäher konnte trotzdem beide damit verbundene Rasenflächen erreichen. Grundsätzlich sollte Ecovacs aber generell für eine verlässliche Nutzung von schmalen Korridoren sorgen – denn genau das ist häufig das Nogo bei „dummen“ Schleifenmähern, die ebenfalls teils enorme Durchgangsmindestbreiten von Engstellen fordern.
Übrigens: Für besonders große Gärten, für die die WLAN-Abdeckung nicht reicht, bietet Ecovacs optional ein SIM-Modul an.
Akku
Der eingebaute Akku des Ecovacs Goat G1 reicht im „effizienten“ – also schnelleren – Modus für rund 150 Quadratmeter am Stück, sofern es sich nicht einfach nur um einen simplen, rechteckigen Rasen handelt. Anschließend fährt das Gerät selbstständig zurück zur Ladestation und lädt. Das dauert um vier Stunden. Anschließend setzt die Roboziege ihr Werk fort und erreicht so irgendwann theoretisch die angegebenen 1600 Quadratmeter, die der Hersteller als Obergrenze für die Rasengröße angibt. Da der Mäher so aber etliche Tage (in der eingestellten Tierschutzzeit fährt er zu Recht nicht) brauchen würde, empfehlen wir eher eine deutlich kleinere Rasenfläche. Je nach Verwinkelung der Fläche sollte die dann unserer Meinung nach eher 600 bis 1000 Quadratmeter nicht übersteigen.
Preis
Der Ecovacs Goat G1 kostet in der UVP des Herstellers 1599 Euro. Wer mehr als die im Lieferumfang enthaltenen zwei Beacons benötigt, muss noch einmal knapp 100 Euro pro Stück dazurechnen. Das SIM-Modul kostet ebenfalls extra.
Aktuell gibt es den Goat günstiger. Man bekommt ihn für 1499 Euro statt 1599 Euro.
Fazit
Der Ecovacs Goat G1 (oder doch eher „die“ Goat, weil „Ziege“?!) macht viel mehr richtig, als er falsch macht. Und das Beste daran: Das, was er derzeit falsch macht, sollte sich durch ein paar Software-Updates beheben lassen – Besitzer von Schleifenmäher dürften bei diesen Zeilen mangels ähnlicher Funktionalität laut aufheulen. Zu den größten Problemen des Modells gehört unserer Einschätzung nach eine (derzeit) fehlende Anpassungsmöglichkeit für eine einmal erstellte Mähkarte. Dadurch verliert der GPS-Mäher seinen größten Vorteil – nämlich mehr Komfort bei weniger (Einrichtungs)Arbeit und die Flexibilität, auf Veränderungen im Garten schnell und einfach reagieren zu können.
Hinzu kommen Kleinigkeiten wie ein fehlender Nachtmodus, ständiges Rumgeplärre bei aktiviertem Kameraüberwachungsmodus selbst ohne tatsächliche Erkennung von Personen und für manche vielleicht noch die Möglichkeit, dass die Schnitthöhe nur manuell am Mäher zwischen 20 und 60 Millimeter eingestellt werden darf. Zudem halten wir die angegebene Rasengröße von bis zu 1600 m² für optimistisch. Bleibt noch der Preis, der im Vergleich zu Schleifenmähern hoch ist und durch eventuell benötigte weitere Beacons weiter steigt. Im Vergleich zur aktuellen Konkurrenz halten wir ihn aber für vertretbar – GPS-Mäher sind derzeit einfach noch vielfach Beschäftigungsfeld für Early Adopter und werden erst mit der Zeit günstiger werden. Mit schickem Design, gutem Schnittbild und toller App können wir trotz der angesprochenen Nachteile verstehen, warum der Ecovacs Goat G1 derzeit oftmals ausverkauft ist.
Die Beacons selbst hingegen, die wir anfangs wegen des Batteriebedarfs (3x LR20) pro Jahr als Störfaktor empfunden haben, stellten sich im Alltag als Heil und Verderben für den Goat gleichermaßen heraus. Denn auch wenn das Aussehen natürlich Geschmacksache ist: Uns stört das nicht und die Signalfackeln bringen der Roboziege stattdessen einen spürbaren Vorteil bei der Signalstabilität im Vergleich zu anderen RTK-Mähern ohne Beacons. Allerdings brauchen Besitzer von Gärten mit gewachsenem Pflanzenbewuchs deutlich mehr Beacons, als es auf den ersten Blick scheint, da dieser die Signalstärke spürbar reduziert. Wir empfehlen den Goat daher nur für Besitzer kleinerer, am besten übersichtlicher Gärten - ansonsten wird es teuer!
Ein Wort noch zum Status der Software: Zwar raten wir unseren Lesern generell, sich nicht auf Zukunftsversprechungen von Herstellern zu verlassen, welche Features die irgendwann noch bringen wollen. Bei Ecovacs sind wir aber aus Erfahrung mit den Saugrobotern des Herstellers guter Hoffnung, dass das Unternehmen die wichtigsten Fehlstellen noch ausfüllen wird. Dass der Goat wie Bananen erst beim Kunden reift, muss man nicht gut finden. Leider machen das aber die meisten Hersteller heute so. Wer sich an den genannten Problemen des Mähroboters stört und sich nicht auf Versprechungen verlassen will, sollte mit dem Kauf noch warten. Alle anderen bekommen mit dem „Erstlingswerk“ G1 ein ordentliches Produkt mit einem (für die gebotene Leistung!) guten Preis.
Weitere Informationen zu Mährobotern mit Begrenzungsdraht und ohne Begrenzungskabel (Ratgeber) haben wir in gesonderten Ratgebern zusammengefasst. Außerdem zeigen wir in einem weiteren Artikel, welches Zubehör für Mähroboter sinnvoll ist. In unserer Bestenliste der Mähroboter ohne Begrenzungsdraht stellen wir die Geräte gegenüber.
Wie funktioniert ein Rasenroboter ohne Begrenzungskabel?
Der Begrenzungsdraht wurde bislang bei automatischen Rasenmähern gebraucht, damit sie wussten, welchen Bereich sie nicht verlassen oder welchen sie nicht befahren durften. Das setzte zuvor präzises Verlegen eines Drahtes rings um den zu mähenden Bereich voraus, das je nach Verlegeart auf oder unter dem Rasen und abhängig von der Größe mehrere Stunden dauern kann. Mehr dazu und was generell noch wichtig bei Rasenrobotern ist, haben wir in unserem Ratgeber Husqvarna, Gardena, Stihl: Der beste Mähroboter für jede Rasengröße zusammengefasst.
Die neuesten Rasenmäher-Roboter benötigen dieses Begrenzungskabel nicht mehr. Stattdessen setzen sie in erster Linie auf das globale Ortungssystem GPS sowie bisweilen auf zusätzliche Signalfackeln, Ultraschall, ToF-Sensoren (Time of Flight) und Kameras gepaart mit AI-Technologie (Artificial Intelligence / Künstliche Intelligenz). Damit ist es den Geräten möglich, bis auf wenige Zentimeter genau zu navigieren und zu mähen, ohne ungewollt das Blumenbeet umzupflügen. Hersteller wie Ambrogio setzen außerdem auf Sensoren, mit denen Rasen erkannt wird. Einen Regensensor haben heute fast alle Rasenmäher-Roboter.
Warum benötigt ein Mähroboter Kameras?
Die Kameras in einigen der neuen Rasenroboter erlauben es dem Gerät wortwörtlich, sich ein Bild von seiner Umgebung zu machen. Damit orientiert sich das Gerät und erkennt anhand von KI Hindernisse wie Gartenmöbel, Menschen oder Tiere im Fahrweg. Zusätzlich lassen sich die Kameras bei einigen Modellen auch als bewegliches Sicherheitssystem verwenden. Die Mäher können auf dem Grundstück patrouillierend oder in der Ladestation stehend, erkannte Personen filmen und so potenzielle Diebe abschrecken. Normalerweise sind das Features, die zusätzlich zu einem PIN-Code für Diebstahlschutz sorgen. Auch ein GSM-Modul, also Mobilfunk, gehört bei einigen Herstellern zum Lieferumfang oder sind optional nachrüstbar.
Wofür benötigt ein Rasenmähroboter künstliche Intelligenz?
Die Erkennung von Gegenständen, Personen und der Umgebung geschieht zwar über die erwähnten Kameras, allerdings muss der Roboter das Gesehene auch verstehen. KI sorgt dafür, dass der Mäher die Bilder verarbeitet und etwa seine Fahrtroute bei einem Hindernis umplanen kann, ohne es zuvor anzurempeln oder gar zu überfahren. Das erhöht nicht nur die Autonomie des Roboters, sondern auch den Schutz für Mensch und Tier und ist richtig smart.
Kein Begrenzungskabel, keine Arbeit bei der Installation?
Tatsächlich werden Arbeit und Zeitaufwand für die Ersteinrichtung reduziert, nicht aber komplett negiert. Grundsätzliche Schritte wie der Aufbau und das Aufstellen der Ladestation bleiben gleich, der schweißtreibende und zeitaufwendige Akt des Drahtverlegens entfällt aber. An seine Stelle tritt die Einrichtung und Verbindung mit der App-Funktion des Roboters, die Nutzern eines Saugroboters (Bestenliste) bekannt vorkommen und vor wenig Probleme stellen dürfte. Außerdem wollen meist GPS-Antenne und/oder Signal-Beacons aufgestellt werden – teils in direkter Nähe zur Ladestation, teils im Garten verteilt oder nur grob in der Nähe der Mähfläche.
Anschließend folgt das Erlernen der Mähfläche. Dafür wird der Mäher bei fast allen derzeitig verfügbaren Geräten mit dem Smartphone wie ein ferngesteuertes Auto am Rand der Mähfläche entlang manövriert, bis man wieder am Ausgangspunkt angelangt ist. Dabei sollte man möglichst exakt vorgehen, damit die Messer des Rasenmäher-Roboters auch Halme am Rand erreichen können. Die Roboter erkennen dadurch ihre spätere Arbeitsfläche. Dieser Vorgang dauert – je nach Roboter und Rasengröße sowie Ausgrenzungen von Beeten oder Teichen im Schnitt etwa 20 bis 60 Minuten – das Verlegen von Draht dauert deutlich länger. Inzwischen gibt es auch Modelle, die das Grundstück automatisch erkunden und kartografieren.
Anschließend benötigen manche Modelle eine Erkundungstour ohne Mähvorgang, die dann aber schon selbstständig abläuft. Danach ist der GPS-Mäher betriebsbereit. Geräte, die mittels Kamera oder Sensoren die mehr oder weniger große Rasenfläche erkennen sollen, können mitunter ohne oder mit weiter reduzierter manueller Einrichtung starten – so wird bisweilen kein Begrenzungs-, aber ein Leitdraht verlegt, damit der Roboter zurück zur Ladestation findet. Hier kommt es weniger auf Präzision an, entsprechend ist das einfacher und schneller zu bewerkstelligen, als Begrenzungsdraht exakt zu verlegen.
Einige Mähroboter erlauben auch, eine Karte automatisch zu erstellen. Das funktioniert allerdings nur zufriedenstellend, wenn die zu mähende Rasenfläche wenig komplex ist. In den meisten Fällen bringt ein manuelles Abfahren des Roboters per Smartphone das bessere, weil genauere Ergebnis.
Welche Vorteile bieten Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht?
Neben der Arbeitsersparnis bei der Einrichtung bieten Mähroboter, die ohne Begrenzungskabel auskommen, weitere Vorteile. So fahren sie größtenteils in geraden Bahnen und erzeugen damit ein ordentliches Schnittbild – fast wie auf dem Fußballplatz. Die Ausrichtung der Bahnen darf bei manchen Geräten frei gewählt werden, sodass man etwa exakt parallel zur Hausfront mähen lassen kann. Einige Modelle können sogar Muster in den Rasen schneiden – eher eine Spielerei.
Außerdem lassen sich bei manchen Modellen (bereits jetzt oder zukünftig geplant) einzelne Zonen anlegen, die unterschiedlich hoch oder oft gemäht werden können – ähnlich wie bei Saugrobotern. Zudem sieht man größtenteils dank App-Steuerung genau, wo der Roboter schon war, wie lange er noch benötigt und einiges mehr. Das klappt detaillierter als bei bisherigen Rasenrobotern, da die GPS-gestützten Geräte genau wissen, wo sie sich gerade aufhalten und wo sie schon waren. Zudem erkennen Geräte ohne Begrenzungskabel Hindernisse normalerweise deutlich besser als Rasenmäher-Roboter ohne.
Gibt es Nachteile von Mährobotern ohne Begrenzungskabel?
Derzeit bieten die von uns getesteten oder gerade im Test befindlichen Rasenmäher-Roboter, die ohne Begrenzungsdraht auskommen, zwar einige offensichtliche Vorteile, aber sie sind bislang nicht perfekt. Ein Nachteil ist die Abhängigkeit von einem guten GPS-Signal. Ist der Himmel mit einer dichten Wolkendecke überzogen oder bewegt sich der Roboter unter dichtem Blattwerk von Bäumen oder Sträuchern, kann das GPS-Signal so schwach werden, dass der Roboter aus Sicherheitsgründen seine Arbeit einstellt. Das passiert aber bei den neuesten Modellen selten, zumal sie sich auf weitere Sensoren und oftmals Kameras verlassen können. Kritisch im Hinblick auf Satellitenempfang sind zudem Flächen, die von hohen Gebäuden umgeben sind. Hier reicht schon eine vierstöckige Wohnanlage und auf der anderen Seite ein zweistöckiges Einfamilienhaus, um dem Empfang einen Strich durch die Rechnung zu machen. Ist man davon betroffen, sind Mähroboter, die wie der knapp 800 Euro teure Ecovacs Goat O500 Panorama, der für kleine Gärten gedacht ist und über eine integrierte Kamera kartiert oder das Spitzenmodell für Mähflächen von bis zu 3000 m² mit Doppel-Laser-Navigation Goat A3000 Lidar für knapp 3000 Euro die bessere Wahl. Die Tests der beiden folgen zeitnah.
Ein weiterer großer Nachteil: Derzeit erlaubt kaum ein GPS-Rasenroboter das nachträgliche Anpassen der Mähkarte. Zwar ermöglichen einige Varianten (schon jetzt oder erst für die Zukunft geplant), nachträglich neue Mähbereiche zu erfassen oder Sperrzonen für Beete auch später noch zu erstellen. Eine bereits angelegte Karte zu überarbeiten, funktioniert nach derzeitigem Stand aber nur bei zwei Geräten: Marotronics Alfred (Testbericht) und Segway Navimow (Testbericht). Alle anderen Roboter verlangen vom Kunden das komplett neue Anlernen der Karte, wenn er etwa feststellt, dass sich der Roboter an einer bestimmten Stelle der Karte immer wieder festfährt.
Ein weiterer Nachteil ist der Kantenschnitt – bei GPS-basierten Robotern mehr noch als bei welchen mit Begrenzungsdraht. Denn während Besitzer von Drahtmodellen das Kabel zur Not immer wieder ein paar Zentimeter versetzen können, bis der Roboter die perfekte Kante abfährt, können aktuelle GPS-Mäher das mehrheitlich (noch) nicht. Da sie zentimeter-, aber nicht millimetergenau mähen, sollte lieber immer etwas Gras am Rand stehen bleiben, statt dass der teure Mäher im Teich versinkt oder die Beete ramponiert. Wegen des schwankenden GPS-Empfangs ist die Genauigkeit beim Kantenmähen zudem nicht an allen Tagen gleich. Außerdem lassen die Mäher bei einem Rasen mit höheren Begrenzungssteinen oder Mauern grundsätzlich etwas Rasen stehen, weil die Klingen nicht ganz bis zum Rand reichen. Es ist also wie bei Saugrobotern auch, man muss etwas nacharbeiten, um ein perfektes Ergebnis zu erzielen. Somit wird ein Rasentrimmer auch mit dem besten Mähroboter weiterhin ein nützlicher Helfer bleiben.
Nicht zuletzt bleibt der hohe Preis dieser technisch fortschrittlichen Rasenroboter. Mit 1500 Euro aufwärts sind sie normalerweise um ein Vielfaches teurer als kabelgebundene Mähroboter. Wie immer hat neue Technik ihren Preis, und wie bei Rasenrobotern mit Begrenzungskabeln müssen auch Geräte ohne generell konstruiert sein, um etwa maximale Steigungen zu überwinden. Viele der neuen Modelle haben übrigens Probleme mit engen Passagen und sind daher nur bedingt für enge, kleine Gärten geeignet. All diese Punkte beachten wir in unseren Mähroboter-Tests. Weitere Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht sowie Zubehör für Rasenroboter gibt es unter anderem bei Amazon.
Was sind gute Alternativen?
Viel mehr Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht gibt es nicht. Allen gemein ist allerdings der hohe Preis. Wer das nicht ausgeben will und mit einigen Abstrichen leben kann, der sollte einen Blick auf Mähroboter mit Begrenzungsdraht werfen. Die gehen schon unter 300 Euro los und können je nach Garten sogar nach wie vor die bessere Wahl sein.
Fazit
10 Mähroboter ohne Begrenzungskabel, 4 unterschiedliche Herangehensweisen: Ecovacs, Luba 2, Navimow, Yuka, Roboup und Stiga verlassen sich (teils neben anderen Hilfen) auf GPS und ihr RTK-Kit. Ecovacs, Navimow, Yuka und Luba 2 setzen (zusätzlich) auf Kamera, der Ecovacs Goat-G1 zudem auf Beacons und Goat GX ausschließlich auf seine Kamera. Hinzu kommt der Dreame A1 mit Lidar wie ein Saugroboter – so unterschiedlich wie die Navigationsarten sind auch die Ergebnisse.
Am besten gefallen haben uns das neue Ecovacs-Modell A1600 RTK, Yuka, Stiga, Luba 2 und Segway. Stigas Hardware ist ungeschlagen und bietet den besten (reinen) GPS-Empfang sowie tolle Navigation und Rasenschonung selbst bei Dauerregen. Mammotion kombiniert beste Geländefähigkeit (Luba 2) mit hohem Arbeitstempo mit einer App, die inzwischen top ist. Der AWD-Antrieb des Luba 2 mit Kamera ist allerdings tödlich für das Grün, wenn es länger geregnet hat – also im Frühling oder im Herbst. Besser macht das der Yuka, mit ansonsten allen Vorteilen des Luba 2 plus Laubsammler. Er verzichtet allerdings auf AWD und damit die extreme Steigfähigkeit des Luba 2.
Dreame hat mit dem A1 ein spannendes Erstlingswerk vorgestellt, das selbst in schwieriger Umgebung immer genau weiß, wo es ist. Derzeit ist die Software aber bisher nicht vollständig, und das zu lange Chassis sorgt immer wieder dafür, dass die Räder bei Schwenks durchdrehen. Die Navimows der H- und i-Serie bieten aktuell die insgesamt beste Software und – zumindest auf halbwegs ebenen Grasflächen – gute Hardware. Die neue i-Serie punktet darüber hinaus dank verbessertem EFLS in Kombination mit der jetzt immer vorhandenen Kamera mit einer Navigationsstabilität, die sogar den tollen Stiga in den Schatten stellt und an den Luba 2 herankommt – für deutlich weniger Geld.
Der Ecoflow Blade ist teuer und fuhr sich im Test am häufigsten fest. Auch der optionale Laubsammelbehälter kann daher nicht verhindern, dass wir nicht vollständig überzeugt von dem Modell sind. Enttäuscht sind wir zudem vom Husqvarna Automower 410XE Nera mit Epos. Er hat zwar gute Randschnitteigenschaften und ein tolles Schnittbild, kann aber keine strukturierten Bahnen fahren und die App ist stark verbesserungswürdig. Erstaunlich gut gefallen hat uns der Ecovacs Goat GX-600, der wie der Worx Vision super einfach in Betrieb zu nehmen ist und erstaunlich gut (und in Bahnen!) navigiert. Im Gegenzug fehlen ihm viele spannende Features, was ihn auf einen der hinteren Plätze verweist. Dafür ist das 2025er-Modell Ecovacs Goat A1600 RTK umso überzeugender: Er mäht schnell, präzise und ist dank Schnellladung in 45 Minuten wieder einsatzbereit.
Weiterer Informationen zur Garten- und Rasenpflege zeigen wir in unseren Ratgebern Praktisches Zubehör für Rasenroboter und Hof & Garten vorbereiten für den Winter: Schneefräse, Laubsammler, Astsäge & Co.
Affiliate-Information
Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.