Zahlen, bitte! 921 Einsätze des fliegenden Auges - Das Sofia-Flugzeugteleskop
Das SOFIA-Teleskop, eingebaut in einer Boeing 747SP, hat nach 921 Einsätzen sein Missionsende erreicht. Ein Rückblick auf ein ungewöhnliches Himmelsinstrument.
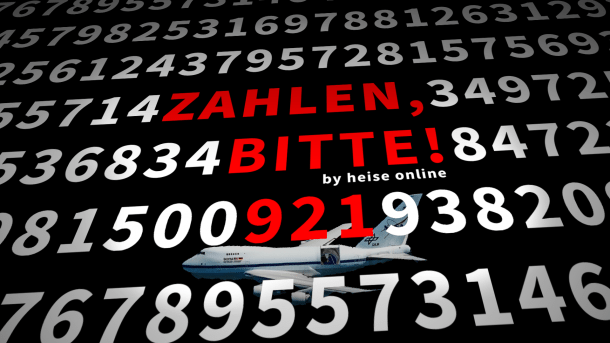
Das Infrarotstrahlen-Teleskop SOFIA (Stratosphären Observatorium für Infrarot-Astronomie), eingebaut in einer Boeing-747SP flog im September 2022 ihre letzte Mission. Das deutsch-amerikanische Joint-Venture zwischen den Raumfahrtorganisationen DLR und NASA ist damit Geschichte. Schuld daran sind wohl die zu hohen Kosten und ein anderes einzigartiges Teleskop. Daher wird es Zeit für einen Rückblick.
Videos by heise
Die Idee klang wie aus einem James-Bond-Film, wurde aber Realität: Ein Infrarotstrahlen-Teleskop eingebaut in eine Boeing 747, die über dem Zielgebiet einfach automatisch eine Luke öffnet und wie ein fliegendes Auge den Weltraum sondiert. SOFIA war eine Gemeinschaftsentwicklung der amerikanischen Weltraumorganisation NASA und der deutschen Luft- und Raumfahrt-Organisation DLR. Es diente der Erforschung der fürs menschliche Auge unsichtbaren Infrarot-Strahlung.
Operationsraum Stratosphäre
Die Plattform für das Teleskop bildete eine gebrauchte Boeing 747SP. SP steht dabei für Special Performance, eine Variante des Jumbojets, die gegenüber der Grundversion (747-200) Vorteile bot. Die Maschine war zwar kürzer, aber konnte durch die starken Triebwerke weiter und höher fliegen. Das kam den Missionszielen entgegen, da die Sternbeobachtung in der Stratosphäre und damit in 12 bis 14 km Höhe stattfinden musste.
(Bild: NASA/DLR)
Erdgebundene Infrarotteleskope haben das Problem, dass der Wasserdampf unterhalb der Troposphäre einen großen Teil der Infrarotstrahlung absorbiert. Selbst die Observatorien die in 4000 Meter Höhe errichtet wurden, konnten nur noch einen Bruchteil der Strahlung messen. Das SOFIA-Teleskop hingegen detektierte in der darüber liegenden Stratosphäre bis zu 99 Prozent der Infrarotstrahlung.
Vorteile gegenüber Satelliten
Spezielle Satelliten, wie das von den Messinstrumenten her zum Teil vergleichbare Herschel-Teleskop, hatten bisher Nachteile gegenüber SOFIA. Zwar ließ sich im All die Infrarotstrahlung noch genauer als durch SOFIA messen, allerdings mit Nachteilen: Die Notwendigkeit, die Messinstrumente auch im Weltraum durch verdampfendes Helium konstant auf etwa -271 °C zu halten, begrenzte die Funktionszeit auf wenige Jahre. Irgendwann war der Helium-Vorrat aufgebraucht und das Herschel-Teleskop wurde nach 3 Jahren und 10 Monaten Einsatzzeit deaktiviert.
Dazu kam: Wartungsmissionen waren aufgrund der Entfernung von 800.000 Kilometer und mehr in der Regel undurchführbar. Selbst beim Hubble-Weltraumteleskop, welches sich in Shuttle-Reichweite befand, stiegen die Kosten einer Wartung schnell auf über 500 Millionen US-Dollar.
Das SOFIA-Teleskop hingegen konnte nahezu jederzeit gewartet werden. Der Einbau in ein handelsübliches Flugzeug erforderte nicht einmal spezielle Start- und Landebahnen, was es sehr mobil machte. Und während ein Satellit durchaus 10 bis 15 Jahre Planungs- und Vorlaufzeit benötigte, war die Planung bei SOFIA viel kürzer und wartungsfreundlicher. Weiterentwicklungen hätten bei SOFIA nach einer Entwicklungszeit von 3 bis 5 Jahren sofort eingebaut werden können.
Leichter und robuster Hauptspiegel
Herzstück des von den deutschen Firmen MT-Aerospace (früher: MAN-Technologie) und Kayser-Threde (Heute OHB) entwickelten SOFIA-Teleskops war der 800 Kilogramm schwere Hauptspiegel mit einem Durchmesser von 2,7 Metern.
(Bild: NASA/DLR)
Das aufgenommene Licht wurde auf einen 35,2 Zentimeter großen Sekundärspiegel aus Silizium-Karbid geworfen, der das gebündelte Licht auf einen 2-Ebenen-Tertiärspiegel reflektierte. Dieser leitete das Licht in die Instrumente. Da es mit einem aufwendigen Puffersystem in Hantelform gelagert und zudem noch die Luft aerodynamisch geschickt an der Öffnung vorbeigeleitet wurde, war das SOFIA-Teleskop unempfindlich gegen äußeren Einflüsse einer solchen Mission. Turbulenzen bis 0,5 g galten für das System unproblematisch. Auch extreme Temperaturschwankungen machten dem System nichts aus.
Wichtige deutsche Instrumente zur Spektralanalyse waren ebenfalls an Bord: Das Heterodyn-Spektrometer GREAT (German Receiver at Terahertz Frequencies) und das Ferninfrarot-Spektrometer FIFI-LS (Far Infrared Field Imaging Line Spectrometer).