"Missing Link": Manipulation, Meinungsfreiheit und Propaganda bei Facebook & Co.
Große Medienhäuser haben sich neben Facebook, Twitter & Co. und Sonderermittlern daran gemacht, Vorwürfe im US-Wahlkampf 2016 aufzuarbeiten. Es geht nicht nur um russische Trollarmeen, sondern auch um Macht und Verantwortung der sozialen Netze.
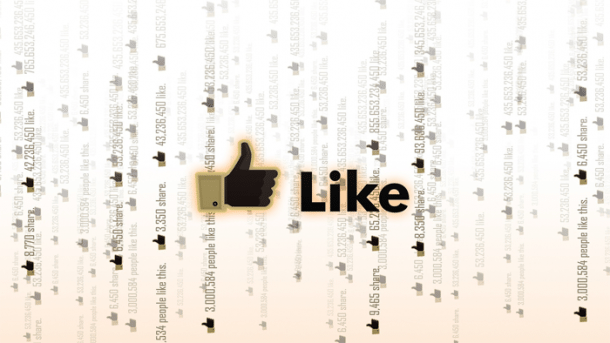
(Bild: ariapsa)
Im November soll die Wahrheit ans Licht kommen. Vertreter von Facebook, Google, Twitter & Co. müssen dann in Anhörungen im US-Kongress Farbe bekennen über mögliche russische Informationsoperationen auf ihren Plattformen im US-Präsidentschaftswahlkampf 2016. Schon vor dem Termin hat sich der neue "Kalte Krieg" im Internet mit den Untersuchungen des Ex-FBI-Chefs Robert Mueller und mehrerer Kongressausschüsse zu möglichen Verbindungen zwischen Donald Trumps Wahlkampfteam und russischen Stellen deutlich verschärft.
Facebook "außer Kontrolle"
So vergeht kaum ein Tag mehr, an dem US-Medien nicht vermeintliche Enthüllungsberichte bringen und dabei vor allem die sozialen Medien im Blick haben. Auch die Financial Times spricht von schweren Bedenken, dass Russland vor allem Facebook in eine "Waffe" verwandelt habe und das "Produkt Mark Zuckerbergs" außer Kontrolle zu geraten drohe.
Prinzipiell sehen sich die Betreiber sozialer Netzwerke selbst eigentlich als neutrale Vermittler von nutzergenerierten Inhalten, die sich aus der Meinungsmache herauszuhalten versuchen. Doch Politiker in immer mehr Ländern betonen, dass mit wachsender Reichweite der übertragenen Botschaften auch eine größere Verantwortung einhergeht. Die bislang propagierte Selbstregulierung reiche da nicht mehr aus. Das Geschäftsmodell der Plattformen, das auf der algorithmischen Einstufung von Inhalten und größtmöglicher Automatisierung beruht, könnte damit ins Wanken geraten.
Zwei Tage nach der US-Wahl, aus der für viele überraschend der Immobilienmogul und Reality-TV-Star Trump als Sieger hervorging, tat Facebook-Gründer Zuckerberg im vorigen November auf einer Konferenz noch seine persönliche Meinung kund, er halte es für eine "verrückte Idee", dass "Fake News" auf der Plattform in irgendeiner Form den Ausgang des Urnengangs beeinflusst haben könnten. Auch weil Falschmeldungen generell nur einen "sehr kleinen Anteil" der dortigen Inhalte ausmachten.
Meinung geändert
Sein Kommentar zur Bundestagswahl ein knappes Jahr später hört sich ganz anders an. "Wir haben daran gearbeitet, die Integrität der deutschen Wahl sicherzustellen", konstatierte der Konzernchef im September. Das klingt in seiner Allgemein- und Vagheit beruhigend und erinnert an die Sprache von Politikern oder Parteien. Hinter der neuen Diktion steckt offenbar eine Kehrtwende um schier 180 Grad.
Erstmals räumte Facebook Ende April öffentlich ein, dass es staatlich unterstützte Versuche gebe, das weltgrößte Online-Netzwerk als Instrument zur Beeinflussung der öffentlichen Meinung zu missbrauchen. Die Sicherheitsabteilung des Konzerns erklärte, dass vor allem mit Hilfe gefälschter Profile bestimmte Meinungen und teils auch falsche Informationen in den Vordergrund gerückt werden sollen. Ziel sei es, konzertiert gewisse Ansichten unters Volk zu bringen, die sonst kaum eine entsprechende Verbreitung fänden. Automatisierte "Social Bots" oder kompromittierte Konten kämen dafür weniger zum Einsatz.
Aus der US-Wahl gelernt?
Das Ausmaß der festgestellten "Informationsoperationen" im US-Wahlkampf sei gemessen an der gesamten Aktivität zu politischen Themen statistisch gesehen "sehr gering" gewesen, hieß es damals. Von weniger als "einem Zehntel eines Prozents" war die Rede. Der Betreiber versicherte trotzdem, dass er mittlerweile konsequent gegen solche unlauteren Aktivitäten vorgehe. So habe er zuletzt in Frankreich vor der dortigen Präsidentschaftswahl rund 30.000 gefälschte Profile enttarnt und dicht gemacht.
Von einer potenziellen russischen Einflussnahme war im Frühjahr den Erklärungen nichts zu vernehmen, obwohl US-Geheimdienste und das FBI zuvor bereits den russischen Präsidenten Wladimir Putin und seine Troll-Fabriken als hauptsächliche Übeltäter ausgemacht hatten. Anfang September ließ Facebook aber durchblicken, dass inzwischen 470 "unauthentische" Konten und Seiten entfernt worden seien, die "wahrscheinlich aus Russland betrieben wurden". Manager deuteten dabei mit dem Finger auf die berühmt-berüchtigte Firma "Internet Research Agency" alias "Bundesnachrichtenagentur" in St. Peterburg, die enge Connections zum Kreml haben soll.
Insgesamt fallen bei Facebook rund eine Millionen Konten pro Tag durch die Prüfung, ob reale Menschen mit richtigem Namen dahinterstehen. Die knapp 500 möglichen "Faker" aus Russland gehen da rein quantitativ fast etwas unter, sind aber ein großer Aufreger in den US-amerikanischen und europäischen Medien.
Die Frage des Geldes
Ähnlich verhält es sich mit den Geldern für Werbung in sozialen Netzwerken, die Kreml-nahe Firmen ausgegeben haben sollen. Dem Vernehmen nach haben die Petersburger Spezialisten für "Internet-Forschung" während und nach dem Wahlkampf für 100.000 US-Dollar rund 3000 Anzeigen auf Facebook gekauft. Die Bundesregierung hat sich die Werbung für die Bundeswehr in Form der Videoserie "Die Rekruten" derweil rund 8 Millionen Euro kosten lassen. Die Summen, die westliche und vor allem US-amerikanische Geheimdienste in mediale Informationsoperationen gegen Russland stecken, sind unbekannt.
Andererseits gilt es bei der Einschätzung der Vorfälle zu berücksichtigen, dass Moskau wohl ein Tabu gebrochen hätte, sollte es sich über Mittelsleute in den demokratischen Urprozess einer fremden Macht eingemischt haben. Zudem sollen insgesamt gut zehn Millionen Nutzer in den USA Werbung auf Facebook gesehen haben, die mit russischen Konten in Verbindung gebracht wird.
Vor allem die New York Times bringt so immer wieder lange Geschichten, in denen sie die potenzielle russische Einflussnahme auf das demokratische Verfahren beleuchtet. Anfang September macht sie etwa gemeinsam mit der kalifornischen IT-Sicherheitsfirma FireEye die Facebook-Profile von "Malevon Redick", "Katherine Fulton" und "Alice Donovan" als virtuelle Heimstätte von mehr oder weniger frei erfundenen Charakteren aus. Diese und eine handvoll ähnlich gestrickte Konteninhaber hätten mit als erste auf die Seite "DCLeaks" verwiesen, auf der als erstes umfangreiches Material aus Hacks des Lagers der Demokraten aufgetaucht war. Alle verdächtigen Profile, die laut FireEye letztlich mit den schon mythischen, in Geheimdienstnähe gerückten "russischen Hackergruppen" APT28 alias Fancy Bear kooperierten, hätten später den Echtheitstest der Plattform nicht überstanden und seien gelöscht worden.
Einmischung per Hashtag
Auf DCLeaks seien der Blogger Guccifer 2.0 und schließlich Wikileaks mit zunehmend spektakulärem Material gefolgt, schreibt die Times. Jeden dieser Schritte hätten nicht nur legitime, sondern auch zweifelhafte Facebook- und Twitter-Nutzer stürmisch begrüßt. Neben Bots seien darunter auch die entdeckten gefälschten Profile gewesen, die sich teils einfach über Seiten wie das russische Angebot buyaccs.com ("Buy Bulk Accounts at Best Prices") für wenig Geld klicken ließen. Der ein oder andere dabei lancierte Hashtag wie #HillaryDown habe es auf Twitter auf die Liste der Trend-Themen geschafft. Am Wahltag selbst habe eine Gruppe von Bots das Stichwort #WarAgainstDemocrats über 1700 mal abgefeuert.
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass Russland mit seinen "Experimenten" auf Facebook und Twitter just die US-Firmen, die im Grundsatz die wichtigsten Instrumente für soziale Medien erfunden hätten, in "Täuschungs- und Propagandamaschinen" verwandelt habe. Ein früherer FBI-Mann, Clinton Watts, stellte zusätzlich die These auf, dass Facebook und vor allem Twitter an einem "Bot-Krebs" litten, der ihre Glaubwürdigkeit unterwandere.
Die New York Times räumt aber auch ein, dass die Wirkung der ausgemachten Kampagnen kaum nachvollziehbar sei. Die Fälschungen dürften nur unwesentlich "zu dem Mordsspektakel echter amerikanischer Stimmen im Tumult vor den Wahlen" beigetragen haben, ist dem Beitrag zu entnehmen. Sie hätten aber dabei geholfen, "ein Feuer aus Ärger und Verdacht in einem polarisierten Land anzufachen". Ein ähnliches Resümee zieht in dem Artikel der Internetforscher Andrew Weisburd: Die Russen waren seiner Ansicht nach zwar involviert, genauso habe es aber viel "organische Unterstützung für Trump" gegeben. Beides auseinanderzuhalten sei überaus schwierig gewesen.
Mit kontroversen Themen Unruhe stiften
Aus "offiziellen Kreisen" Facebooks will die Zeitung Anfang Oktober erfahren haben, dass das soziale Netzwerk mittlerweile von einer "stark koordinierten Desinformationskampagne" auf einigen Gruppen und Seiten ausgehe, die auf die Internet Research Agency zurückgeführt werde. "Die Anzeigen und Konten, die wir gefunden haben, scheinen umstrittene politische Themen rund um das politische Spektrum verbreitert zu haben", erklärte Joel Kaplan, der bei Facebook für die Beziehungen zur Politik zuständig ist, dem Blatt.
Die ungewöhnlichen Stimmen im Wahlkampf hätten sich als US-amerikanische ausgegeben und so getan, als sprächen sie für ähnlich denkende Bürger wie Gegner von Einwanderern, Befürworter von Waffenrechten, Unterstützer für Rechte Homosexueller, schwarze Aktivisten oder sogar Hundeliebhaber, meldet die Times. Solche Gruppen hätten auf Namen gehört wie "Defend the 2nd", "Secured Borders", "LGBT United" oder "Being Patriotic". Teils sei es zunächst wohl darum gegangen, möglichst viele Gleichgesinnte anzuziehen. Laut nicht näher genannten "Russlandexperten" habe Putin aber offenbar darauf gehofft, "das Bild der amerikanischen Demokratie zu schädigen und den internationalen Einfluss der USA zu schmälern".
Eine Woche später legt das Blatt noch einmal nach und wirft einen tieferen Blick auf Hunderte von Facebook-Beiträgen, die der "russischen Penetration" des sozialen Netzwerks erwachsen seien. Vielfach hätten sich die Verfasser dabei "Ideen und Argumente von Amerikanern ausgeliehen, die bereits einen gewissen Widerhall bei Konservativen und Liberalen fanden". Dabei hätten sie – trotz einiger gestelzter, im Umgangsenglisch kaum benutzter Phrasen – ein gewieftes Verständnis der politischen Landschaft in den USA bewiesen.
"Kulturelles Hacking"
Es habe sich dabei um "kulturelles Hacking" gehandelt, zitiert die Times den Forschungsleiter für digitalen Journalismus an der Columbia-Universität, Jonathan Albright. "Sie nutzen Systeme, die bereits auf diesen Plattformen aufgesetzt waren, um das Engagement zu erhöhen. Sie füttern Empörung an, was einfach ist, da die Leute Sachen aufgrund von Ärger und Emotion mit anderen teilen." Facebook habe die fraglichen Seiten und Profile in den vergangenen Wochen alle gelöscht. Viele ihrer Inhalte seien aber mit dem Analyseprogramm CrowdTangle zuvor eingefangen worden, eine Sammlung habe Albright zugänglich gemacht.
Wenn etwa über die Gruppe "Being Patriotic" Hetze gegen Flüchtlinge von mehreren Hunderttausend Nutzern mit Likes, Kommentaren oder Weiterleitungen bedacht worden sei, hat dies laut dem Bericht auch US-Amerikaner wie den republikanischen Aktivisten und Trump-Fan Len Swanson motiviert, diese Äußerungen aufzugreifen und in Kommentaren ebenfalls auf Facebook oder auf LinkedIn weiter zu tragen. Dass er dabei wohl ein "Rad in der russischen Propagandamaschine geworden sei", störe ihn nicht. Der 64-Jährige verwies vielmehr darauf, dass "wir das verdammte Zeug genauso dort drüben machen". Heilige gebe es keine.
Mit dem Hinweis auf den gegenseitigen Informationskrieg wollte es die Zeitung nicht bewenden lassen. Die russische Kampagne sei genau auf die Regeln von Facebook und Co. zugeschnitten gewesen, schreibt sie. Die geteilten Inhalte und Kommentare hätten zwar nicht ausdrücklich zu Gewalt aufgerufen und seien auch nicht direkt diskriminierend gewesen. Sie hätten es aber geschafft, die Nutzer ganz im Interesse der Plattformen am Ball zu halten. Die Russen hätten "Samen und Dünger auf die sozialen Medien geworfen", erläuterte John W. Kelly, Gründer der Analysefirma Graphika. Eine solche Saat wollten sie dann aufgehen sehen und "infiltrieren", um sie weiter "ein wenig formen zu können".
Nicht nur Facebook
Inzwischen soll auch Twitter Hunderte falsche, in Richtung Russland weisende Konten identifiziert haben, obwohl Konzernchef Jack Dorsey wenige Tage zuvor noch das Gegenteil behauptet hatte. Da das soziale Netzwerk weniger Reichweite hat als Facebook, steht es aber nicht im Zentrum der Aufarbeitung. Google gab bekannt, ebenfalls von russischen Auftraggebern finanzierte Werbekampagnen ausfindig gemacht zu haben. Die Inserenten haben laut einem recht vagen Bericht der Washington Post zehntausende US-Dollar für Banner auf der Suchmaschinen sowie YouTube, Gmail und dem Werbenetzwerk DoubleClick ausgegeben. Mit dem überschaubaren Budget sollen gezielt Falschinformationen unter die Nutzer gebracht worden sein, um deren politische Meinung zu beeinflussen.
Microsoft wollte da nicht länger zurückstehen und ließ wenig später durchblicken, Anzeigengeschäfte aus der Wahlkampfzeit 2016 zu überprüfen. Die Redmonder wollen damit herausfinden, ob etwa über ihre Suchmaschine Bing während der heißen Phase Werbung verbreitet wurde, die aus Russland finanziert wurde. Auf solche Auffälligkeiten soll der Konzern hingewiesen worden sein. Details und Quellen? Fehlanzeige.
"Wir brauchen unbedingt eine Untersuchung, was 2016 passierte", betonte der Kolumnist Roger Cohen jüngst bei einem Vortrag über "Weltpolitik, Macht und Meinungsmache in der digitalen Welt" im Telefónica-Basecamp in Berlin. Die sozialen Medien seien heute "überall", während Zeitungsartikel früher deutlich mehr Einfluss gehabt hätten. Heute gebe es in der Presse genauso wie im Privatfernsehen oder im Web nur noch eine "Kakophonie" der Stimmen, echte Debatten seien selten. Die Fragmentierung in den USA werde so immer größer.
Echte Debatten werden seltener
Der alte Hase im Nachrichtengeschäft, der vor der New York Times auch bereits für das Wall Street Journal und Reuters tätig war, gab offen zu, dass die sozialen Netzwerke "unser Geschäftsmodell bedrohen". Fast alle Werbegelder gingen zu Google und Facebook, sodass die Times und andere führende US-Medien sich hätten neu erfinden müssen. Die Kernaufgabe dabei bleibe aber die alte: "die Mächtigen zur Rechenschaft zu ziehen" – auch und gerade wegen der Blüte von "Fake News" im Internet. Denn wenn der Unterschied zwischen Wahrheit und Lüge weiter schwinde, gebe es gar keine Basis für rationalen Diskurs mehr: "Ohne Fakten verbreitet sich Desorientierung", worin Trump ein Meister sei, indem er sich als Stimme eines Teils der Bevölkerung ausgebe.
Das Schulterzucken, mit dem die Pressesprecher des US-Präsidenten auf dessen Lügen wie einen angeblichen Glückwunsch vom mexikanischen Kollegen für eine Rede vor Pfadfindern reagierten, ängstigt Cohen nach eigenem Bekunden am meisten. Eine solche Haltung sei typisch für Autokraten und Diktatoren. Dagegen sei es umso wichtiger, wachsam zu bleiben, ein gewisses Anstandsgefühl zu wahren und die Republik aufrecht zu erhalten. Trump habe die USA zwar noch nicht in eine zweite "Weimarer Republik" verwandelt. Er habe es aber akzeptabler gemacht, "rassistisches Gedankengut zu äußern", uns so ein mittelgroßes Erdbeben "in der freien Welt" ausgelöst.
Cohen philosophierte zugleich über das Wesen sozialer Medien, das es nicht sonderlich einfach mache, "den Müll auszusortieren". "Wir führen immer weiter auseinander laufende Leben", meinte der bekennende Transatlantiker. "Da wird es immer schwerer, sich auf etwas zu fokussieren." Facebook schüre Gefühle der eigenen Ungenügsamkeiten, viele Nutzer fragten sich ständig, ob sie dort ausreichend geliked und beachtet würden. Dies sei eine einzige große Ablenkung von viel wesentlicheren Dingen.
Verbinden und trennen
"Die Technologie ist eine stark verbindende, aber auch eine trennende Macht", weiß Cohen. Der Langzeiteffekt des Internets und der sozialen Medien sei dabei derzeit noch völlig unklar. Offen zutage trete aber, dass diese die Menschen beeinflussten und zwar etwa "wie wir denken, wählen und lieben". Er finde es daher gut, dass Zuckerberg langsam aufwache und nicht nur mehr Aufmerksamkeit darauf lenke, "was Russland getan hat", sondern generell bereit sei, mehr politische Verantwortung für den Kommunikationsaustausch über Facebook zu übernehmen.
Diese Entwicklung zeichnete Anfang Oktober das zur Times gehörende New York Magazine nach. Der "Präsident-Papst-Vizekönig" des größten sozialen Netzwerks mit seinen rund zwei Milliarden Mitgliedern und einem Marktwert von über 500 Milliarden US-Dollar war demnach selbst nicht angemessen auf die Rolle vorbereitet, "die Facebook vergangenes Jahr in der globalen Politik gespielt hat". Zu groß sei der Glaube Zuckerbergs an die eigene Vorstellung gewesen, dass es sich bei dem gigantischen Online-Forum um eine "liberale Institution" im klassischen Sinne handle, auf der jeder frei mitreden können, "solange er kein Foto mit einem Nippel postet".
Mittlerweile habe sich herausgestellt, dass auch im demokratischen Netz "extreme Akteure die Parameter der politischen Konversation bestimmen" könnten. Facebook habe daher eine "geheime Arbeitsgruppe" eingesetzt, um das Problem der Desinformation anzugehen. Zuckerberg selbst habe eingestanden, dass Technologie und Globalisierung nicht nur jahrzehntelang die Menschheit enger verknüpft und produktiver gemacht, sondern auch zu einem großen "Gefühl der Spaltung" beigetragen habe. In einer Art Manifest habe er im Februar dargelegt, dass es der "Fortschritt" von der Menschheit verlange, eine "globale Gemeinschaft" mit "kollektiven Werten" zu bilden, "was erlaubt und verboten sein sollte".
Einfluss ohne Regulierung
Das hört sich wie eine Predigt an und tatsächlich gehören Kirchengemeinden mit zu den bekanntesten Gemeinschaften. Die Werte, auf die Zuckerberg anspielt, bleiben aber verschleiert und letztlich selbstreferenziell, arbeitet der Magazinautor heraus. Der Community-Gründer schreibe als Leitprinzip nur fest, dass "jede Person so wenig wie möglich anstößige Inhalte sehen" und möglichst viel teilen können sollte. Im Kern gehe es also darum, dass die Leute möglichst viel posten sollten. Das propagierte "Wertesystem" ende so in einem Zirkelschluss: "Facebook ist gut, weil es Gemeinschaft schafft; Gemeinschaft ist gut, weil sie Facebook ermöglicht. Die Werte von Facebook sind Facebook."
Das soziale Netzwerk sei viel zu lange damit durchgekommen, "sich in jeder Ecke unserer Leben breitzumachen", ohne dass die Regierung dazwischengetreten wäre, lautet der Tenor des Beitrags. Geschafft habe es dies mit der alten Leier, nur eine "Vermittlungsinstanz" zu sein, über die Informationen von einem zum anderen fließen. Längst habe Facebook aber mindestens eine so große "Aufmerksamkeitsmacht", wie sie die einschaltstarken, aber viel umfangreicher regulierten TV-Sendernetzwerke hätten.
Meinungsbildungsprozesse seien "ohne Intermediäre nicht mehr denkbar", schreiben Konrad Lischka und Christian Stöcker in einer Studie zur "digitalen Öffentlichkeit" für die Bertelsmann-Stiftung. Vor allem algorithmische Prozesse von sozialen Netzwerken und Suchmaschinen beeinflussten bereits für mehr als die Hälfte aller Onliner hierzulande, "wie und welche Angebote redaktioneller Medien sie in der digitalen Sphäre wahrnehmen". Sie beeinflussten den gesellschaftlichen Diskurs, indem sie "Mitteilungen priorisieren und so die Öffentlichkeit strukturieren".
Der Newsfeed als neuer Boulevard
Ein Risiko dabei sei, "dass fälschlicherweise Repräsentativität angenommen oder Popularität unhinterfragt mit Relevanz gleichgesetzt wird". Algorithmen können zudem schon durch Fehler bei der Gestaltung "Relevanz systematisch verzerrt einschätzen". Dazu kämen weitere Faktoren, die möglicherweise Polarisierung beförderten. Dazu gehöre die Tendenz Artikel ungelesen weiterzureichen. Die Plattformen selbst seien darauf ausgerichtet, "schnelles aber unreflektiertes Verhalten" zu fördern; Newsfeeds stellten auf das "möglicherweise Interessante" ab, was sie "mit gewissen Boulevardmedien" gemeinsam hätten. Potenzielle Folgen seien ein "Wahrheitsrelativismus", ein verengtes mediales Weltbild und eine größere Anfälligkeit für Desinformationskampagnen.
Nichts Genaues wissen die Forscher aber auch noch nicht, belassen viele Aussagen im Konjunktiv und stochern bei der Wirkungsforschung rund um die neuen Medien oft im Nebel. Fest steht dagegen laut der aktuellen "Mediengewichtungsstudie" der Landesmedienanstalten, dass das Internet weiter an Bedeutung gewinnt für die Meinungsbildung. In der Altersgruppe der 14- bis 29-Jährigen hat das Netz demnach mit 51,9 Prozent bereits in diesem Bereich mehr Einfluss als das Fernsehen mit 19,2 Prozent.
38,8 Prozent der Bevölkerung informieren sich täglich im Internet über das Zeitgeschehen, geht aus der Untersuchung hervor. Die meisten von ihnen – 21,7 Prozent der Bevölkerung oder 15,1 Millionen Personen über 14 Jahre – holten sich ihr Wissen dabei täglich in den sozialen Medien. 19 Prozent davon vertrauen Informationen auf Facebook & Co. eher als denen in Fernsehen, Radio oder Zeitung. Gleichzeitig geben mit 94 Prozent fast alle Nutzer sozialer Medien an, sich der Gefahr von Fake News bewusst zu sein und darauf zu achten, woher eine Nachricht kommt. Für Siegfried Schneider, den Vorsitzenden der Direktorenkonferenz der Landesmedienanstalten ist damit klar: Wenn zwei von fünf Nutzern glaubten, hier auf sozialen Medien einen guten Überblick über die verschiedenen Standpunkte zu bekommen, "dann zeigt das auch die Verantwortung", die deren Betreibern hätten, "diesen Überblick tatsächlich zu bieten".
Computergestützte Propaganda als Gefahr
Wissenschaftler eines Forschungsprojekts des Internet-Instituts der Universität Oxford haben unlängst dargestellt, dass Social Bots und andere Formen automatisierter politischer Kommunikation in vielen Ländern eine immer wichtigere Rolle gerade im Wahlkampf und in Krisen einnehmen. Soziale Medien würden dabei massiv für die Manipulation der öffentlichen Meinung eingesetzt. Sie warnen: "Computergestützte Propaganda ist zu einer der mächtigsten Waffen gegen die Demokratie geworden."
Die Betreiber sozialer Netzwerke seien zwar in der Regel nicht die Schöpfer der ungebührlichen Meinungsmache, sie böten diesen aber eine Plattform, halten die Forscher fest. Die Portale müssten daher signifikant umgestaltet werden, um die Volksherrschaft lebensfähig zu halten. Denkbar sei dafür etwa, den Wahrheitsgehalt von Nachrichten automatisch oder durch unabhängige Institutionen zu bewerten sowie Filterblasen durch eine breitere gezeigte Meinungsvielfalt entgegenzuwirken.
Schädlich für die Redefreiheit dürfte es sich dagegen erweisen, wenn Deutschland und die EU auf die Rechtsdurchsetzung durch die privaten Netzwerkbetreiber selbst setzen und sie unter unklaren Kriterien zum raschen Löschen verdonnern. Der Menschenrechtskommissar des Europarates, Nils Muižnieks, machte als Beispiel für diese unausgegorene Rundumschlag-Strategie vor Kurzem das umstrittene Netzwerkdurchsetzungsgesetz aus. Bei diesem Modell bleiben ihm zufolge die Rollen und Pflichten der Unternehmer, die Meinungsfreiheit zu schützen und Zensur zu verhindern, viel zu vage. Es daher höchste Zeit, dass die Mitgliedsländer selbst ihren staatlichen Schutzaufgaben nachkämen.
Die US-Politik wird aktiv
In den USA liegen pragmatischere Regulierungsvorschläge auf dem Tisch. Facebook selbst hat angekündigt, dass Werbekunden künftig alle von ihnen geschalteten Anzeigen auflisten müssten. 1000 neue Prüfer sollen zudem einen Blick auf die Bannerinhalte werfen. Adam Schiff, dem führenden Demokraten im Geheimdienstausschuss des Repräsentantenhauses, geht dies nicht weit genug. Er drängt darauf, dass alle Anzeigen auf sozialen Netzwerken einen Hinweis auf den Finanzier und Auftraggeber enthalten. Zu einem gewissen Grad müssten die Betreiber mehr Kontrolle über den gezeigten Content ausüben und sich als "gute Bürger" erweisen, was deren Automatisierungsstreben bislang zuwiderlaufe.
Im Senat sind es die Demokraten Mark Warner und Amy Klobuchar, die Facebook und Co. mit neuen Auflagen einhegen wollen. Dazu gehört der Vorschlag, eine öffentlich einsehbare Datenbank mit allen gekauften politischen Anzeigen einzurichten, für die jemand über 10.000 Euro hingeblättert hat. Der Forscher Tim Wu, der den Begriff Netzneutralität bekannt gemacht hat, geht einen Schritt weiter und empfiehlt ein komplettes Verbot politischer Werbung in sozialen Medien. Zudem müssten für die Betreiber generell vergleichbare Schutzanforderungen gelten wie für Rundfunksender. Das Zaubermittel für angemessene Regeln für große, meinungsstarke Online-Plattformen, die zugleich auch der Meinungsfreiheit Raum lassen und Platz für nachhaltige Debatten schaffen, muss aber wohl noch gefunden werden. (mho)