Studie: Nur wenige Eltern setzen Jugendschutzprogramme ein
Ein Viertel der Erziehungsberechtigten hat einen technischen Filter installiert, der den Nachwuchs vor ungeeigneten Inhalten im Netz bewahren soll. 90 Prozent halten den Jugendschutz für wichtiger als einen leichten Zugriff auf Online-Angebote.
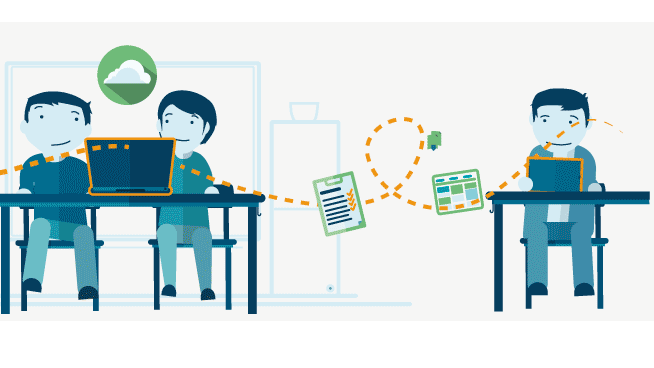
(Bild: fsm.de)
Die Einstellung deutscher Eltern zum Jugendmedienschutz ist widersprüchlich. 73 Prozent der primären Erziehungsberechtigten sorgen sich um die Sicherheit ihrer Kinder beim Surfen im Netz; 94 Prozent sehen sich auch selbst in der Pflicht, ihren Nachwuchs vor negativen Erfahrungen im Netz zu schützen und 90 Prozent stimmen der Aussage zu, dass der Jugendmedienschutz wichtiger sei als ein leichter Zugang zu allen Online-Angeboten. Gleichzeitig haben aber lediglich 25 Prozent der Eltern Jutgendschutzsoftware installiert, das verhindern soll, dass ihre Sprösslinge mit ungeeigneten Angeboten in Berührung kommen.
Die Zahlen stammen aus dem ersten Jugendmedienschutzindex zum "Umgang mit onlinebezogenen Risiken", den das Hans-Bredow-Institut für Medienforschung und das Institut für Medienpädagogik "Jugend Film Fernsehen" (JFF) im Auftrag der Freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter (FSM) erstellt haben, die gerade ihr 20. Jubiläum feiert. Technischer Jugendschutz sei zwar "mittlerweile bekannt", erklärte der Direktor des Hans-Bredow-Instituts, Uwe Hasebrink, am Dienstag zur Präsentation der Ergebnisse in Berlin. Es gebe aber nach wie vor große Unsicherheiten, wie er eingesetzt werden kann.
Mit Filtern allein ins Netz
78 Prozent der hiesigen Eltern halten laut einer repräsentativen GfK-Umfrage in Haushalten mit Kindern und Jugendlichen zwischen 9 und 16 Jahren Jugendschutzeinstellungen in Geräten für sinnvoll, führte Niels Brüggen vom JFF-Institut aus. Bei Jugendlichen liege dieser Anteil bei "etwas über 60 Prozent". Eine Kindersicherung auf einem Gerät wie einem Tablet oder einem Laptop haben aber nur rund 23 Prozent der Eltern installiert. Dazu kommt eine weit verbreitete Überzeugung, dass Heranwachsende technischen Schutz leicht umgehen könnten.
(Bild: heise online / Stefan Krempl)
Viele Eltern meinten auch, sie könnten ihren Nachwuchs mit Filtern allein ins Netz lassen, sagte Brüggen. Diese allein lösten das Problem aber nicht, da es häufig zu "Over- oder Underblocking" komme. Geschützte Bereiche und Suchmaschinen hielten die Eltern generell für sinnvoll, beklagten aber, dass es davon zu wenige gebe. Alterskennzeichen seien genauso wie altersabhängige Zugangsbarrieren in Form festgelegter Uhrzeiten oder der Altersverifikation "weithin akzeptiert". Andererseits gehe die Mehrheit der Befragten davon aus, dass solche Mittel auf Jüngere auch einen "größeren Reiz" auslösen könnten, an die nicht für sie bestimmten Inhalte heranzukommen.
In der Verantwortung für den Jugendmedienschutz sehen nach sich selbst 82 Prozent der Eltern die Behörden, 81 Prozent soziale Netzwerkplattformen, 78 Prozent Anbieter von Inhalten im Internet, 75 Prozent Bild- und Videoplattformen, 74 Prozent Schulen, 72 Prozent die Politik und 69 Prozent App-Stores. Einrichtungen der Selbstkontrolle werden erst weit hinten genannt. Eltern kommen nach ihrer eigener Einschätzung am besten dem Schutzauftrag nach; sozialen Netzwerkplattformen wollen dies 14, der Politik 16 Prozent attestieren.
Irrtümer der Eltern
Über das komplexe System des Jugendmedienschutzes wissen Erziehungsberechtigte im Prinzip Bescheid. So kann ein Großteil die Altersstufen korrekt benennen und sagen, was Werbung für Kinder nicht darf. Auch die grundlegende Funktionsweise von Schutzprogrammen ist angeblich rund 86 Prozent bekannt. Nicht nur bei Details hapert es aber. So meinen viele Eltern, dass das Abrufen des Geburtsdatums ausreichend ist für einen Alters-Check. 41 Prozent denken fälschlicherweise, dass sie sich bei Problemen mit Inhalten im Netz an die Verbraucherzentralen wenden sollten. 38 Prozent verweisen auf die eigentlich zuständigen Internet-Beschwerdestellen. 29 Prozent kennen konkret solche Hotlines, 8 Prozent haben sich bereits an sie gewandt.
Es sind aber gar nicht hauptsächlich ungeeignete Online-Inhalte, die die Befragten sorgen. Im Vordergrund Risiken ihrer Kinder aus dem Kontakt mit anderen Personen, erst dann kämen die Inhalte gefolgt von der Angst vor einer Auswertung persönlicher Daten oder Suchtproblemen. Bei den Heranwachsenden beziehen sich die Sorgen vor allem auf das Verhalten anderer Kinder wie Cybermobbing, die Folgen von Urheberrechtsverletzungen, Technikfallen, Viren oder die mit Medien verbrachte Zeit. (anw)