Herr Voit sucht die Formeln des Lebens
Eberhard Voit macht Biologie berechenbar. Er modelliert und simuliert Zellen, Gene und Bakterien im Computer – und hilft so der Milchindustrie wie der Malariaforschung.
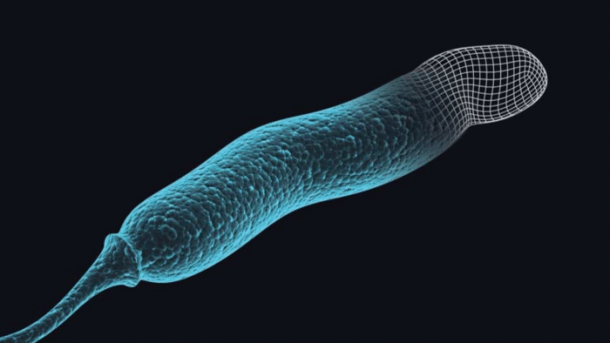
(Bild: Shutterstock)
- Thomas Reintjes
In Köln hat man mir ins Gesicht gesagt: Biologie ist zu kompliziert, um Mathematik zu benutzen." Eberhard Voit erinnert sich daran, wie er belächelt wurde, als er Anfang der 80er-Jahre nach seinem Biologie-Diplom, dem Mathematik-Staatsexamen und der Doktorarbeit in Theoretischer Biologie beide Disziplinen verbinden wollte. Er sei vor die Entscheidung gestellt worden: "Entweder lassen Sie Pflanzen wachsen, gucken sich irgendwelche Tiere an oder machen was mit Zellen – oder Sie werden Mathematiker." Warum er sich damals trotzdem sicher war, dass Formeln auch in der Biologie Platz finden, weiß Voit heute nicht mehr. Es muss eine Mischung aus Sturheit und Intuition gewesen sein.
Auch Biologie ist berechenbar
Jedenfalls ließ er sich nicht beirren: 1981 traf Eberhard Voit bei einem Forschungsaufenthalt an der Universität von Michigan seinen Mentor Michael Savageau. Der glaubte wie Voit fest daran, dass auch die Biologie berechenbar ist. "Das kommt", gab Savageau seinem Post-Doc mit auf den Weg. "Genieß die Zeit, in der noch nicht alle darüber herfallen." Es sollte eine lange Zeit werden. Zu schwach waren die Computer, zu aufwendig die biotechnischen Methoden.
Der Wendepunkt kam mit Beginn des neuen Jahrtausends. Damals wurden Genexpressionsanalysen möglich, die die Aktivität von Genen messen und Zehntausende Datenpunkte gleichzeitig erzeugen. Auf einmal brauchten Biologen Computer, um diese Datenmengen handhaben zu können. "Ab da war mein Leben völlig anders", sagt Eberhard Voit.
Er und seine Disziplin traten aus dem Schatten heraus und waren plötzlich populär. Seither ist der Bedarf, biologische Phänomene in mathematische Modelle zu übertragen, extrem gestiegen. Plötzlich scheint es ein erreichbares Ziel zu sein, Zellen am virtuellen Reißbrett zu designen oder die Wirkung von Medikamenten vorherzusagen.
Zellen am virtuellen Reißbrett zeichnen
Mit seinem Team am Georgia Institute of Technology, wo Voit seit 2004 forscht, konzentriert er sich auf die Modellierung und Simulation kleiner biologischer Systeme. Die Forscher beschäftigen sich mit Bakterien, pflanzlichen Zellen oder Blutkörperchen. Trotzdem gibt es in ihrem Institut keine Petrischalen, Mikroskope und Laborkittel. Die Forschung ist rein digital.
Wo Biochemiker oder Genetiker klassischerweise den Weg über Versuch und Irrtum wählen, setzt Voit auf Rechnerintelligenz. Anhand seiner Modelle ist es möglich, wenig aussichtsreiche Experimente im Vorfeld auszusortieren. Voits Team hat etwa evaluiert, wie sich Rutenhirse gentechnisch verändern ließe, um sie besser als Energiepflanze zur Herstellung von Biokraftstoffen verwenden zu können. "Diesen Prozess mit reinen Experimenten zu optimieren, würde Jahre dauern", so Voit. "Jetzt, wo wir unser Modell haben, können wir das in Minuten machen."
Sogar völlig neue biologische Zusammenhänge kommen auf diese Weise ans Licht. Die Wissenschaftler haben beispielsweise Bakterien untersucht, die bei der Herstellung von Joghurt oder Käse eingesetzt werden. Eigentlich sollten Milchsäurebakterien gut verstanden sein, aber: "Wir haben das beste Wissen eingebaut in die Modelle, und sie klappten nicht." Dass die mathematischen Bakterien nicht so funktionierten wie die biologischen, deutete darauf hin, dass an einer bestimmten Stelle ein bisher unbekannter Regulationsmechanismus zum Einsatz kommen muss. Tatsächlich konnte er später bei Bakterien nachgewiesen werden. Mit diesem Wissen lässt sich künftig möglicherweise die Effizienz erhöhen, mit der die Bakterien Milch in Milchprodukte verwandeln.
Auch die Medizin dürfte solche Verfahren verändern, wie ein Malariaprojekt zeigt, an dem sein Team beteiligt ist: "Wir haben mit mathematischen Methoden festgestellt, dass wahrscheinlich 30- bis 40-mal so viele rote Blutkörperchen vom Körper eliminiert werden wie infiziert sind." Deshalb führe Malaria zu Anämie. Dieses Beispiel zeigt allerdings auch die derzeitigen Grenzen der Methode. Warum der sogenannte Bystander-Effekt so dramatisch ausfällt, konnte Voits Team nicht klären.
Grenzen der computerbasierten Systembiologie
Denn machbar ist bisher nur die Modellierung einzelner Zellen, Stoffwechselvorgänge und Genregulationen. An der Stufe darüber, der Interaktion verschiedener Zellen oder gar Gewebe, scheitert die computerbasierte Systembiologie. Bis sie für sich verbuchen kann, Krankheiten zu heilen, wird es daher noch dauern.
Aber Voit wäre nicht Voit, würde er nicht daran glauben, dass auch dieser Schritt irgendwann gelingt. Auf dem Weg dahin braucht er gute Verbindungen zur klassischen Biologie. Denn diese Forscher mit ihren Brutschränken, Petrischalen und Reagenzgläsern müssen reale Organismen untersuchen und vermessen, damit Voit überhaupt seine Rechenmodelle erstellen kann.
Und sie müssen die Ergebnisse der Simulationen experimentell bestätigen. "Das ist ein kompliziertes Problem", gibt Voit zu. Nicht immer hätten Experimentatoren Verständnis dafür, weil Laborversuche damit aufwendiger werden. Denn die rechnerbasierte Systembiologie funktioniert umso besser, je mehr Daten zur Verfügung stehen. Wenn Bakterien im Labor etwa ein Substrat zu fressen bekommen, dann möchte Voit in möglichst kleinen Zeitschritten wissen, wie die Organismen das Substrat in andere Stoffe umwandeln.
Simulation vor Experiment
In Zukunft aber, ist Voit überzeugt, wird die Systembiologie für jeden Biologen unverzichtbar werden. "Wenn man die Entwicklung der Physik als Beispiel nimmt, dann werden wir in der Biologie auch irgendwann die Theorie ausarbeiten müssen, bevor man die Experimente macht." Wer also künftig Forschungsgelder beantragt, müsste zunächst einmal mit mathematischen Modellen zeigen, dass die Experimente tatsächlich vielversprechend sind. Irgendwann könnte der Großteil biologischer Forschung in der Mathematik stattfinden. Schließlich greift die Natur selbst immer wieder auf entsprechende Formeln zurück.
Das bekannteste Beispiel dafür ist der Code der DNA. Das Erbgutmolekül besteht aus vier verschiedenen sogenannten Basen. Sie sind in Dreiergruppen angeordnet, und jede Dreiergruppe steht für eine bestimmte Aminosäure, den Baustein der Eiweiße – organismenübergreifend. "Wenn wir jetzt ein neues Insekt finden oder ein neues Bakterium oder eine neue Affenart, gucken wir uns die DNA an und können direkt sagen, was für Aminosäuren da codiert sind", sagt Voit.
Ganz so einfach werde es in anderen Fällen zwar nicht werden. "In der Biologie arbeiten so viele Prozesse zusammen, dass wir keine Gesetze haben werden, die so strikt und so rigoros sind wie in der Physik. Aber wir werden hoffentlich Gesetze finden, die 95 Prozent der Zeit richtig sind."
Ans Aufhören denkt Voit nicht, obwohl er im Februar 65 geworden ist. Er freut sich auf die nächste Generation von Forschern, die mit Computern und Videospielen aufgewachsen sei und seine Disziplin auf ein neues Niveau heben könnte. "Es ist der Anfang einer Blütezeit, und ich find das toll, dabei zu sein."
(bsc)