Geizen mit der Glasfaser
Die Deutsche Telekom bietet zwar einen Gigabit-Tarif an. Doch die wenigsten Deutschen können ihn buchen: Es fehlt die Glasfaser-Infrastruktur. Was läuft schief beim Breitbandausbau in Deutschland?
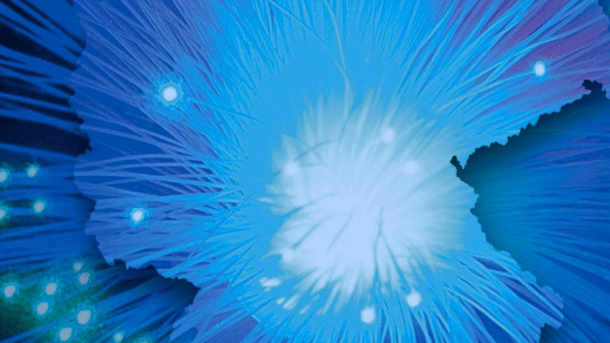
(Bild: Shutterstock)
- Christian J. Meier
"In unserer Gemeinde soll es keine Bürger zweiter Klasse geben", sagt Margit Menrad. Jedes Haus in Icking erhält einen eigenen Glasfaseranschluss, "auch in den entlegenen Ortsteilen", verspricht die Bürgermeisterin. Mehr als die Hälfte der Haushalte surft schon im "Gigabitnetz" – 65-mal schneller, als es der deutsche Durchschnittssurfer tut. Das kleine 3700-Einwohner-Dorf im deutschen Alpenvorland schafft damit, was der große Konzern Telekom bis heute nicht hinbekommt: Eine Glasfaser auch in ländlichen Regionen bis ins Haus zu legen und sie mit schnellem Internet zu versorgen. Und das nicht für 120 Euro im Monat – sondern für 20 Euro im ersten Jahr und 50 Euro ab dem zweiten.
Breitband-Internet auch in ländlichen Regionen
Läge Icking in Schweden, Südkorea oder Japan, wäre Menrads Projekt kein großes Ding – sondern ganz normale Realität. Dort ist blitzschnelles Surfen breit verfügbar und viel günstiger. In Stockholm kostet ein GBit/s rund 20 bis 25 Euro monatlich. Manche Internetanbieter in der schwedischen Hauptstadt schließen gar Deals mit ganzen Wohngebäuden ab, deren Bewohner so für weniger als zehn Euro monatlich blitzschnelles Internet bekommen. In Südkorea ist der Zugang zum Gigabitnetz für 30 Euro monatlich zu haben, in Japan für 40 Euro.
Hierzulande hingegen ist eine Glasfaser bis ins Haus oder in die Wohnung ein knappes Gut. Sie ist für etwa 2,8 Millionen Haushalte verfügbar. Das sind sieben Prozent der Internetanschlüsse, womit Deutschland zu den Schlusslichtern in Europa gehört. Ein Viertel dieser "Fiber to the Home" beziehungsweise "Fiber to the Building" genannten Anschlüsse (FTTH/B) hat die Deutsche Telekom gebaut – der größte Einzelanteil. Den Rest teilen sich die Deutsche Glasfaser und regionale Anbieter wie NetCologne (Köln) oder M-Net (München).
Nur sieben Prozent haben Zugang zur Glasfaser
Die Tatsache ist breit diskutiert – aber eine entscheidende Frage nach wie vor nicht wirklich beantwortet: Was machen andere Nationen besser? Zum Teil sind die Bedingungen für eine flächendeckende Glasfaserversorgung günstiger als hierzulande. Im dicht bevölkerten, großstädtisch geprägten Südkorea reichen weniger Leitungskilometer als in Deutschland mit all seinen Kleinstädten und Dörfern, um möglichst viele Haushalte anzuschließen. Spanien wiederum spannt die Glasfaser über Masten, spart sich also das teure Eingraben und beschleunigt so seinen Ausbau. Dieses oberirdische Kabelgewirr will Deutschland vermeiden.
Doch diese Faktoren sind es längst nicht allein. Sonst hätte das bayerische Icking heute noch kein schnelles Internet. "Der Glasfaserausbau gelingt dort, wo er als Daseinsvorsorge betrachtet wird", sagt Bernd Beckert, Breitbandexperte beim Fraunhofer-Institut für System- und Innovationsforschung in Karlsruhe. Der Wille zur Glasfaser auf nationaler Ebene sei entscheidend, damit Breitband-Subventionen in den Glasfaserausbau fließen. In Schweden beispielsweise beschloss die Regierung schon im Jahr 2000, ein nationales Glasfasernetz aufzubauen. Auf lokaler Ebene dann spielen in diesen Ländern oft gemeindeeigene Stadtwerke eine führende Rolle.
Kommunale Träger treiben den Ausbau voran
Subventionen allein wären jedoch zu wenig. Die zweite Ingredienz für Erfolg sei Wettbewerb, so Beckert. In Schweden ist das sogenannte Open-Access-Modell weit verbreitet, eine Mischung aus staatlicher Daseinsvorsorge und Konkurrenzkampf: Die Kommune baut eine Glasfaserinfrastruktur und vermietet sie an Dienstanbieter, die sie mit Daten bespielen. Bei einer Ware mit gleich bleibender Qualität läuft der Wettbewerb über den Preis, also sinkt dieser. In Stockholm nutzen Hunderte Konkurrenten die von der stadteigenen Firma Stokab gelegten Glasfaser, wie deren Boss Staffan Ingvarsson jüngst berichtete.
So macht es daher auch die Gemeinde Icking: Sie baut das Glasfasernetz für 5,5 Millionen Euro. Derzeit hat es Vodafone gemietet. "Doch es ist auch für andere Anbieter offen", sagt Bürgermeisterin Menrad. Studien aus den USA zeigen, dass allein dadurch die Kosten sinken: In 23 von 40 untersuchten Fällen tendierten gemeindeeigene FTTH/B-Anschlüsse zu günstigeren Preisen als die von privaten Anbietern, wie Forscher der Harvard University herausfanden. In den 17 übrigen Fällen gelang wegen fehlender Daten kein Vergleich.
In Deutschland hingegen nahm eine ganze Folge von Bundesregierungen den Glasfaserausbau nicht sonderlich wichtig. Die alte Große Koalition setzte stattdessen ein bescheidenes Ziel für die Übertragungsgeschwindigkeit: 50 Megabit pro Sekunde (MBps). Vor einem ambitionierteren Ziel sei sie zurückgeschreckt, um nicht "an den Pranger gestellt zu werden", falls dieses nicht erreicht würde, sagt Torsten Gerpott von der Universität Duisburg-Essen. "Daher ging sie nicht über die Breitbandziele der EU-Kommission hinaus", sagt der Professor für Telekommunikationswirtschaft.
Telekom bremst den Glasfaserausbau
Die 50 MBps sind mit den auf der letzten Meile meist schon vorhandenen Kupferleitungen erreichbar. Und die gehören der Deutschen Telekom. Das habe es erlaubt, Subventionen des Bundes im Sinn der Deutschen Telekom in die Netze zu stecken, moniert Gerpott. Tabea Rößner, Grünen-Abgeordnete und Breitbandexpertin ihrer Partei, erkennt darin gar einen Lobbying-Erfolg der Telekom. Diese "bremse" den Glasfaserausbau, um weiter Kupferkabel nutzen zu können.
Der Trumpf der Bonner heißt "Vectoring", eine Art Turbo fürs Kupfernetz. Durch Unterdrücken von Störsignalen erreicht es bis 100 MBps, mit der Nachfolgetechnik "Supervectoring" 250 MBps. Der alten Bundesregierung schien das zu reichen. Sie zog sich darauf zurück, den Breitbandausbau "technologieneutral" zu fördern, wie es aus dem zuständigen Verkehrsministerium hieß.
Der Koalitionsvertrag der neuen Großen Koalition sieht immerhin einen "Netzinfrastrukturwechsel zur Glasfaser" bis 2025 vor; inklusive zwölf Milliarden Euro Förderung für den Netzausbau in ländlichen Räumen. Kritiker bemängelten zwar ein Schlupfloch im Vertrag, denn dort heißt es, die Glasfaser soll "möglichst" bis ins Haus geführt werden. Der designierte Kanzleramtschef Helge Braun (CDU) erklärte in einem ZDF-Interview Anfang März jedoch, man wolle "künftig nur noch Glasfaser" fördern. Die Förderstrategie sei "ein glasklares Nein zum Vectoring". Das zuständige Verkehrsministerium wollte sich zu den Plänen aber bisher nicht äußern.
Vectoring und Supervectoring kommen an ihre Grenzen
Telekom-Sprecher Philipp Blank verteidigt den Kurs. Nur mit Vectoring und Supervectoring lasse sich Breitband rasch und günstig in die Fläche bringen. Denn für FTTH/B "müssten vor jedem Haus in diesem Land die Straßen aufgerissen werden", was lange dauern und 80 Milliarden Euro kosten würde. Nur mittelfristig lasse sich Glasfaser "näher an die Häuser" bringen. Kritiker werfen dem Unternehmen jedoch vor, mit seiner Vectoring-Strategie das Monopol auf der letzten Meile zurückgewinnen zu wollen. Der Zwischenschritt Vectoring "verlängere nur das Leiden", entgegnet Marc Kessler vom Bundesverband Breitbandkommunikation (Breko), dem größten Zusammenschluss von Netzbetreibern, die mit der Telekom konkurrieren.
Denn es ist absehbar, dass die 250 MBps aus dem Supervectoring nicht lange reichen werden. Damit lässt sich der heutige Bedarf zwar decken, etwa um Videos zu streamen. Doch wer im Home-Office arbeiten, Daten in die Cloud auslagern, Videos und Online-Games in immer höherer Auflösung nutzen will, braucht mehr. In weniger als zehn Jahren würden zwölf Millionen deutsche Haushalte ein Gigabit pro Sekunde nachfragen, prognostiziert das Wissenschaftliche Institut für Infrastruktur und Kommunikationsdienste.
In Icking zeichnet sich diese Nachfrage heute schon ab: "Die meisten angeschlossenen Einwohner buchen 500 MBps", sagt Lorenz Pichlbauer von Vodafone, die das Ickinger Netz für ihre Dienste gemietet haben. Für diese Bandbreite taugen nur Glasfaser und Koaxialkabel, wie sie auch für Kabelfernsehen genutzt werden. Nach einem anstehenden Upgrade sollen sogar zehn GBps möglich sein. Doch auch Koaxialkabel dürften absehbar an ihre Grenzen kommen. Vieles spricht dafür, dass die Daten langfristig durch Glasfasern rauschen werden, glaubt Kristof Obermann von der TH Mittelhessen in Gießen. "Nur FTTH/B erfüllt alle Anforderungen an künftige Gigabitnetze", schreibt der Experte für Telekommunikationsnetze der nächsten Generation. Allein schon, weil sie die größte Bandbreite erlauben: In Südkorea gibt es erste Hausanschlüsse mit 50 GBps.
"Die meisten buchen 500 MBps"
Sind dafür tatsächlich 80 Milliarden Euro nötig, wie die Telekom behauptet? Breko-Experte Kessler bezweifelt das. Kosten und Zeitaufwand für FTTH/B ließen sich etwa per "Microtrenching" senken. Dabei wird ein wenige Zentimeter tiefer und breiter Schlitz für die Glasfaser in den Gehweg gefräst. "Auch durch bestehende Abwasserrohre lässt sich die Faser führen", sagt Kessler. Daneben gebe es noch weitere günstige Verfahren.
Ein Bundesgesetz schreibt bereits seit 2016 vor, bestehende Versorgungsnetze für Glasfaser mitzunutzen. Das tun die im Breko organisierten Unternehmen zwar schon, doch sie agieren meist nur lokal. "Wenn sie außerhalb ihrer Reviere aktiv werden wollen, müssen sie mit dem Vectoring konkurrieren, dessen Bandbreite aber den meisten Nutzern noch eine Weile reichen wird", erklärt Fraunhofer-Experte Beckert. So hemmen auffrisierte Kupferleitungen den flächendeckenden Ausbau.
In einem Punkt scheint die neue Bundesregierung jedoch von anderen Ländern gelernt zu haben: Sie will einen diskriminierungsfreien Zugang zum Netz eines Betreibers, also ein Open-Access-Modell wie in Schweden. Die völlige Trennung von Netz und Betrieb wäre nach Ansicht des Breko dafür nicht nötig. Ein Betreiber wie die Telekom könnte auch eigene Dienste anbietet, sollte aber gezwungen werden, sein Netz für Mitbewerber zu öffnen. Der Open-Access-Ansatz soll die Auslastung der Glasfasern erhöhen und den flächendeckenden Ausbau wirtschaftlicher machen.
Open-Access-Modell wie in Schweden
Doch wie auch immer ein künftiges Glasfasernetz reguliert wird: Nach wie vor fehlt es an einem Konsens, diese Infrastruktur zu bauen. Mindestens ebenso aussagekräftig wie die Breitband-Erfolgsrezepte anderer Nationen ist wohl die Gemeinsamkeit jener Länder, die hinterherhinken: Sie haben nach Beobachtungen von Breitbandexperte Beckert immer einen störrischen Platzhirschen wie die Deutsche Telekom oder Openreach in Großbritannien. Aus deren Sicht zahlt sich der Glasfaserausbau nicht aus.
So wie Margit Menrad sehen es noch wenige: "Wir betrachten die Digitalisierung als Daseinsvorsorge wie Kindergarten oder Straßenbau. Bei keinem dieser Projekte fragt man nach der Amortisationszeit, warum dann bei der Datenautobahn?"
Update 01.08.2018: Die Deutsche Telekom hat inzwischen verkündet, den Glasfaserausbau weiter voranzutreiben. Ab 2021 sollen gemäß dieser Pläne jährlich zwei Millionen Haushalte einen Glasfaseranschluss erhalten.
(bsc)