Heise > Bestenlisten > Testsieger > Top 10: Die beste Soundbar ohne Subwoofer im Test – voller Klang ohne Extra-Box
Top 10: Die beste Soundbar ohne Subwoofer im Test – voller Klang ohne Extra-Box
Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie). heise bestenlisten
Stefan Schomberg
Stefan schrieb bereits während des Studiums Spieletests für ein Printmagazin im Ruhrgebiet. Durch einen glücklichen Zufall landete er in Berlin und arbeitete fast 15 Jahre bei Areamobile, zuletzt als leitender Testredakteur. Für Heise Bestenlisten testet er Smartphones, Saug- und Mähroboter, Lautsprecher, Modellflugzeuge und andere Technik-Gadgets.
Soundbars sind dann gefragt, wenn für ein vollwertiges Heimkino-System der Platz nicht ausreicht. Wir zeigen die zehn besten Soundbars ohne Subwoofer.
Ein voller, satter Sound ist entscheidend für echtes Kino-Feeling daheim – egal ob über Blu-ray oder Streaming. Die eingebauten TV-Lautsprecher reichen dafür oft nicht aus.
Zwar schafft ein Surround-System Abhilfe, doch der Nachrüstaufwand ist meist hoch: Kabel können stören und Platz für mehrere Boxen ist nicht immer vorhanden. Hier bieten Soundbars eine elegante Alternative.
Auch wenn sie nicht an eine vollständige Mehrkanalanlage heranreichen, übertreffen sie die TV-Lautsprecher deutlich – bei einfacher Installation und oft günstigerem Preis.
In dieser Top 10 zeigen wir die besten Soundbars ohne Subwoofer aus unseren Tests. Bewertet wurden vor allem Klangqualität, Preis-Leistung und die Unterstützung gängiger Tonformate.
Wer mehr Wumms benötigt, sollte ein Modell mit Subwoofer ansehen. Unsere Empfehlungen zeigen wir in der Bestenliste Die beste Soundbar mit Subwoofer im Test – Samsung vor JBL und LG. Wie man gekonnt zwischen mehreren Geräten umschalten kann, zeigt die Top 10: Der beste HDMI-Switch im Test – Testsieger kostet 18 Euro.
Welche Soundbar ist die beste?
In Bestenlisten ist ein klarer Testsieger oft schwer auszumachen – vor allem, wenn viele Produkte auf ähnlich hohem Niveau liegen. Im Bereich der Soundbars ohne Subwoofer ist das anders: Hier führt die KEF Xio mit deutlichem Abstand.
Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie). heise bestenlisten
Die Soundbar des britischen Audioprofis KEF setzt in puncto Klang – egal ob bei Filmen oder Musik – Maßstäbe und sorgt regelmäßig für Gänsehautmomente. Zwar erreicht sie nicht die volle Räumlichkeit eines Systems mit Subwoofer und Satelliten, doch was sie auf nur 1,21 Meter Breite leistet, grenzt an ein Wunder. Für rund 2.300 Euro ist sie eine beträchtliche Investition, die sich vor allem dann lohnt, wenn die Soundbar auch als hochwertige Musikanlage genutzt wird.
Als günstigere Alternative zur KEF Xio können wir unseren Technologiesieger, die Sonos Arc Ultra ab 849 Euro empfehlen. Sie kommt ohne Subwoofer und Rears, kann aber um diese erweitert werden. Unser neuer Preis-Leistungs-Sieger ist die Klipsch Flexus Core 200 für 411 Euro. Sie überzeugt im Test mit einem kräftigen Heimkinoklang und guter Sprachverständlichkeit.
KURZÜBERSICHT Ratgeber
KEF Xio
Die KEF Xio ist ein absolutes Spitzenprodukt. Sie ist teuer, groß und schwer, aber klanglich auf einem herausragenden Niveau: fein auflösend, erstaunlich dynamisch und mit einem echten Surround-Feeling. Im Unterschied zum Mitbewerb sticht die exzellente Musikwiedergabe der Soundbar heraus, vor allem, wenn sie mit Musik im Dolby-Atmos-Format gefüttert wird.
VORTEILE
- klanglich herausragend, vor allem bei Musikwiedergabe
- viele Streaming-Clients integriert
- Ethernet-Netzwerkanschluss mit Zugriff auf lokalen Medienserver
NACHTEILE
- teuer
- WLAN-Zugriff problematisch
Sonos Arc Ultra
Die Sonos Arc Ultra begeistert als Premium-Soundbar mit hervorragendem Klang, Dolby Atmos und kräftigem Bass – ideal für Heimkino-Fans, die eine starke Einzellösung suchen. Mit einem aktuellen Preis von 849 Euro ist die Sonos Arc Ultra allerdings kein Schnäppchen, bietet jedoch im Vergleich zum Vorgängermodell für 600 Euro einige Verbesserungen wie einen spürbar stärkeren Bass und Bluetooth.
VORTEILE
- kräftiger Bass auch ohne Subwoofer und klare Höhen
- Dolby Atmos
- hochwertiges, schlichtes Design und solide Verarbeitung
- einfache Einrichtung und TV-Steuerung
- Bluetooth 5.3 und Sprachsteuerung
NACHTEILE
- kein Chromecast, kein Google Assistant
- App unnötig kompliziert
- Gesamtpreis steigt mit Zubehör schnell an
- ungünstig platzierte Touch-Bedienelemente
Klipsch Flexus Core 200
Die Klipsch Flexus Core 200 ist eine Soundbar mit Fokus auf kräftigen Heimkinoklang und guter Sprachverständlichkeit. Sie richtet sich an Nutzer, die es möglichst einfach und überschaubar haben wollen. Und mit einem aktuellen Preis von 411 Euro ist die Flexus Core 200 unser neuer Preis-Leistungssieger.
VORTEILE
- Kräftiger Bass auch ohne Subwoofer
- Gute Sprachverständlichkeit bei Film und Fernsehen
- Einfache Einrichtung über HDMI-eARC
- Ausbau-Option mit Subwoofer und Rears
- App
NACHTEILE
- Kein WLAN, integriertes Streaming, Multiroom oder Sprachsteuerung
- wenig 3D-Klang
- enttäuschend bei Musik
Wie sinnvoll ist eine Soundbar?
Eine Soundbar stellt im Vergleich zu einem vollwertigen Hi-Fi-System stets einen Kompromiss aus Klang, Leistung und Größe dar. Gegenüber dem gewöhnlichen TV-Ton bieten jedoch selbst preiswerte Modelle in der Regel eine deutliche Verbesserung. Wer Filme, Serien oder Sportereignisse ansieht, profitiert von klarerer Sprachwiedergabe, mehr Bass und je nach Modell sogar von einem räumlichen Klangerlebnis.
Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up mit 820 Watt Gesamtleistung und Dolby-Atmos-Unterstützung heise bestenlisten
Grundsätzlich ist zwischen kompakten Soundbars ohne und solchen mit separatem Subwoofer zu unterscheiden. Es gibt zudem Lautsprecher, bei denen die Tieftöner bereits im Hauptgerät integriert sind. Diese oft als Sounddecks bezeichneten Modelle sind meist tiefer gebaut und können einen Fernseher direkt aufnehmen. Ein einfaches Gerät ohne externen Subwoofer wird als 2.0-System bezeichnet, mit zusätzlichem Subwoofer als 2.1-System – wobei der Subwoofer kabelgebunden oder kabellos angebunden sein kann. Welche Variante die richtige ist, hängt vom verfügbaren Platz, der Nachbarschaft, den eigenen Hörgewohnheiten und nicht zuletzt vom Budget ab.
Dolby Atmos und DTS:X ermöglichen als objektbasierte Verfahren räumlichen Klang, indem sie Schall so wiedergeben, dass er von allen Seiten zu kommen scheint. Grundsätzlich funktioniert dies auch ohne separate Surround-Lautsprecher – allein mit einer entsprechenden Soundbar. Die Technologie hat in den vergangenen Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht, dennoch bleibt die Wirkung individuell unterschiedlich. Günstige Soundbars sind häufig noch weit von dem Raumklang entfernt, den echte Surround-Lautsprecher erzeugen.
Die jeweilige Soundbar muss eines der Systeme unterstützen; einige Modelle beherrschen auch beide. Der Support dieser Technologien ist allerdings keine Garantie für gute Klangqualität. Weitere relevante Tonformate für Soundbars sind Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Surround sowie DTS HD. TV-Geräte und Soundbars von Samsung nutzen zudem Q-Symphony, um die vorhandenen TV-Lautsprecher für einen erweiterten Surround-Effekt einzubinden.
Soundbar Teufel Cinebar 22 Surround Power Edition im Test: guter Klang mit starkem Bass heise bestenlisten
Soundbars mit Subwoofer
Wer etwas mehr Platz zur Verfügung hat, aber dennoch nicht auf die Anschlussfreundlichkeit einer Soundbar verzichten möchte, findet in Modellen mit Subwoofer oder zusätzlichen Satelliten eine sinnvolle Erweiterung. Die besten Geräte dieser Kategorie zeigen wir in der Bestenliste Die beste Soundbar mit Subwoofer im Test – Samsung vor JBL und LG.
Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand: Ein Subwoofer spielt deutlich tiefere Frequenzen als die kleinen Lautsprecher einer schlanken Soundbar. Das wertet insbesondere Film- und Musikwiedergabe spürbar auf. Da die meisten Subwoofer moderner Soundbars per Funk angebunden werden, sind Nutzer bei der Aufstellung relativ frei. Tiefer Bass ist kaum ortbar, daher kann der Subwoofer etwa hinter dem Sofa oder an einer anderen Wand platziert werden – lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich. "Kabellos" bedeutet in diesem Zusammenhang also nur die halbe Wahrheit, denn auf das Netzkabel kann nicht verzichtet werden.
Ähnliches gilt für Satelliten- oder Rear-Lautsprecher, die seitlich oder hinter der Hörposition für einen räumlichen Klangeindruck sorgen. Auch sie werden größtenteils kabellos angesteuert, benötigen jedoch ebenfalls eine Stromversorgung. Eine Ausnahme bilden einige Modelle von JBL, deren Satelliten dank integrierter Akkus zumindest zeitweise wirklich ohne Kabel auskommen – im Dauerbetrieb ist dies jedoch eher die Ausnahme und nicht durchgängig praktikabel. Unabhängig von der konkreten Stromversorgung verstärken solche Rear-Lautsprecher den Raumklang erheblich und gehören daher zu jedem anspruchsvollen Heimkino-Set-up dazu.
Wie funktioniert Surround Sound?
Surround Sound wird von drei großen Anbietern dominiert: Dolby, DTS und Auro. Dolby Atmos, Auro 3D und DTS erweitern den klassischen Surround-Sound um eine zusätzliche Dimension, sodass der Klang auch von oben kommt.
Während man im Heimkino oft Lautsprecher an der Decke montiert, setzen Soundbars wie die KEF Xio, Sonos Arc oder die Bose Smart Soundbar 900 auf nach oben gerichtete Lautsprecher, die den Klang über Reflexionen erzeugen. Allerdings fehlt vielen Geräten die richtige Hardware für echten 3D-Sound, weshalb sie den Klang nur emulieren. Hochwertige Modelle mit echten 3D-Lautsprechern kosten jedoch mehr als 2000 Euro. THX ist hingegen keine eigene Sound-Technologie, sondern eine Zertifizierung für bestimmte Wiedergabestandards.
Viele Streamingdienste bieten inzwischen auch Musik mit Dolby Atmos. Damit klingt Musik deutlich besser als bei einer klassischen Stereo-Ausgabe. heise bestenlisten
Nicht jeder möchte sein Wohnzimmer mit fünf oder mehr Lautsprechern und einem Berg an Kabeln ausstatten. Hier kommen virtuelle Surround-Systeme ins Spiel. Sie simulieren mit mehreren Lautsprechern in einer Soundbar echten Raumklang, indem sie das Gehör austricksen. Der Effekt: Der Klang scheint von allen Seiten zu kommen, obwohl die Soundquelle direkt vor dem Nutzer steht.
Allerdings funktioniert das nicht bei jedem gleich gut – manche empfinden den künstlichen Klang als unnatürlich. Wer jedoch damit zurechtkommt, profitiert von einem deutlich einfacheren Set-up. Heute ist Virtual Surround, besonders in Kombination mit Dolby Atmos oder DTS zu einer echten Alternative geworden.
Wie am besten die Soundbar anschließen?
Die gängigste und klanglich beste Verbindung zwischen Soundbar und Fernseher erfolgt über HDMI. Wichtig ist dabei, den richtigen Anschluss zu wählen: Am TV muss ein mit ARC oder eARC gekennzeichneter HDMI-Port verwendet werden. Die Abkürzungen stehen für Audio Return Channel respektive enhanced Audio Return Channel.
Während ARC bereits die Übertragung von Surround-Formaten wie Dolby Digital ermöglicht, erlaubt die modernere eARC-Variante die Übermittlung von unkomprimiertem Ton in hoher Auflösung – einschließlich Dolby Atmos und DTS:X. Voraussetzung dafür ist, dass sowohl Fernseher als auch Soundbar und das verwendete HDMI-Kabel den HDMI-2.1-Standard unterstützen. Insbesondere bei längeren Kabelstrecken lohnt sich ein Blick auf die Spezifikationen, nicht jedes Kabel ist für die hohen Datenraten geeignet. Mehr zu diesem Thema erklärt der Artikel HDMI-Kabel ab 5 Euro – Unterschiede, HDMI 2.1, 4K, HDR.
Alternativen zum HDMI-Anschluss
Eine verbreitete Alternative ist der optische Digitaleingang (Toslink), den viele Soundbars bieten. Der optische Anschluss ist weitverbreitet und funktioniert zuverlässig, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Der Datendurchsatz ist deutlich niedriger als bei HDMI, weshalb sich unkomprimierte Formate wie Dolby Atmos nicht übertragen lassen. Für ältere Fernseher oder als Zweitlösung ist er dennoch eine gute Wahl.
Analoge Anschlüsse wie 3,5-Millimeter-Klinke oder Cinch bieten einige Soundbars nach wie vor – etwa die Bose TV-Speaker oder günstigere Modelle von LG und Samsung. Sie eignen sich für den Anschluss älterer Audiogeräte oder wenn kein digitaler Ausgang am TV vorhanden ist, bleiben klanglich aber hinter den digitalen Alternativen zurück.
Kabellose Verbindungen – praktisch, aber nicht immer optimal
Viele Soundbars setzen zunehmend auf kabellose Übertragungswege. Bluetooth ermöglicht die unkomplizierte Musikwiedergabe vom Smartphone, Tablet oder Laptop – Modelle wie die Teufel Cinebar 22 oder die JBL Bar 2.1 unterstützen zudem hochwertigere Codecs wie AAC oder aptX. Für die reine TV-Anbindung ist Bluetooth jedoch weniger geeignet, da es zu Verzögerungen zwischen Bild und Ton kommen kann. Zudem bleiben Funkverbindungen wie Bluetooth oder WLAN aufgrund von Interferenzen, Bandbreitenschwankungen und potenziellen Aussetzern klanglich und vor allem in puncto Stabilität immer eine Notlösung – auch wenn sie im Alltag oft bequem sind.
Der Goldstandard: Ethernet
Die hochwertigste und stabilste Lösung für die Netzwerkanbindung ist nach wie vor der kabelgebundene Ethernet-Anschluss. High-End-Soundbars wie die KEF Xio oder die Sennheiser Ambeo Soundbar bieten daher weiterhin einen LAN-Port. Wer Musik in hoher Auflösung ohne Komprimierung, Unterbrechungen oder Latenzprobleme streamen möchte, kommt um ein Ethernet-Kabel kaum herum. Gerade in anspruchsvollen Multiroom-Set-ups oder bei der Einbindung in Smart-Home-Lösungen wie Home Assistant ist die kabelgebundene Verbindung jeder Funklösung überlegen. WLAN bleibt dagegen eine Komfortfunktion – praktisch für die schnelle Einrichtung, aber für audiophile Ansprüche oder kritische Anwendungen nur die zweitbeste Wahl.
Fazit
Eine Soundbar ist eine äußerst vielversprechende Lösung, um den Klang des Fernsehers deutlich zu verbessern, ohne dabei wertvollen Wohnraum zu opfern. Sie vereint platzsparendes Design mit hörbaren klanglichen Fortschritten gegenüber den meist dünn klingenden TV-eigenen Lautsprechern.
Für kleinere Räume oder puristische Einrichtungen sind Modelle ohne separaten Subwoofer die beste Wahl. Sie fügen sich nahtlos in das Wohnzimmer-Ambiente ein und liefern dennoch einen satteren Klang als jeder integrierte TV-Lautsprecher.
Schon preiswerte Modelle wie die Fire TV Soundbar Plus von Amazon oder Geräte von Sharp und Polk heben das Hörerlebnis spürbar an – ein Einstieg, der sich für wenige hundert Euro lohnt. Wer jedoch keine Kompromisse machen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Den klanglichen Feinschliff liefern die Spitzenmodelle etablierter Hersteller: KEF, Sonos, Sennheiser, Bose, Denon und Klipsch setzen hier die Maßstäbe.
Diese Systeme überzeugen selbst ohne zusätzlichen Subwoofer durch ihre Ausgewogenheit, Präzision und Räumlichkeit. Allen voran die KEF Xio – eine Soundbar, die nicht nur optisch und technisch überzeugt, sondern selbst audiophilen Ansprüchen genügt und damit beweist, dass hochwertiger Klang auch ohne Subwoofer möglich ist.
Mehr zum Thema Heimkino zeigen wir in diesen Ratgeber-Artikeln und Bestenlisten:
- Die beste Soundbar mit Subwoofer im Test – Samsung vor JBL und LG
- Perfekter Sound fürs Heimkino: Die besten Lautsprecher, Subwoofer & AV-Receiver.
- Unsichtbares Heimkino im Wohnzimmer – DIY mit Beamer-Lift und elektrischer Leinwand
- Ratgeber OLED-TV: 55 Zoll Philips, LG oder Panasonic für unter 900 Euro
- Top 10: Der beste HDMI-Switch im Test – Testsieger kostet 18 Euro
BESTENLISTE 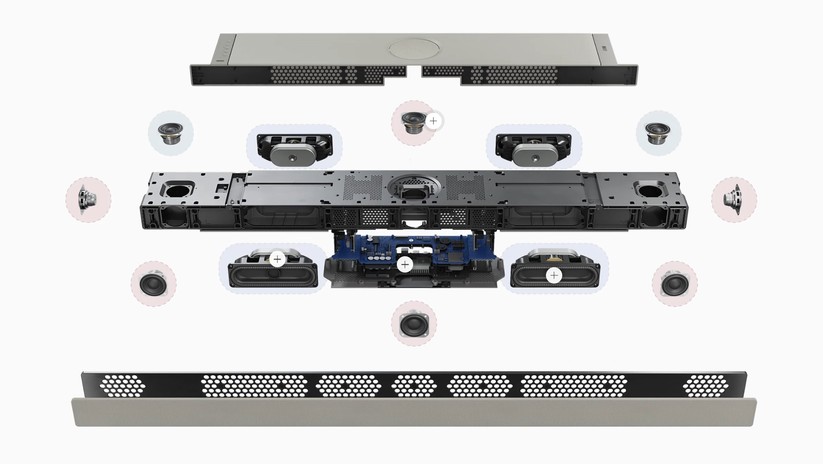

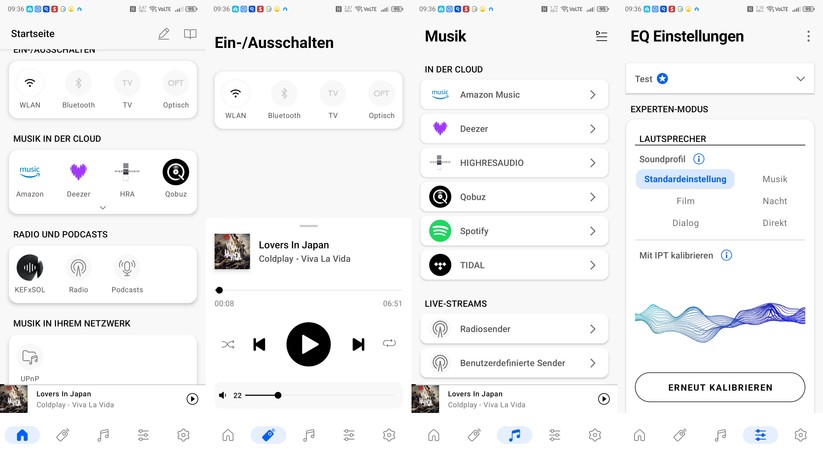
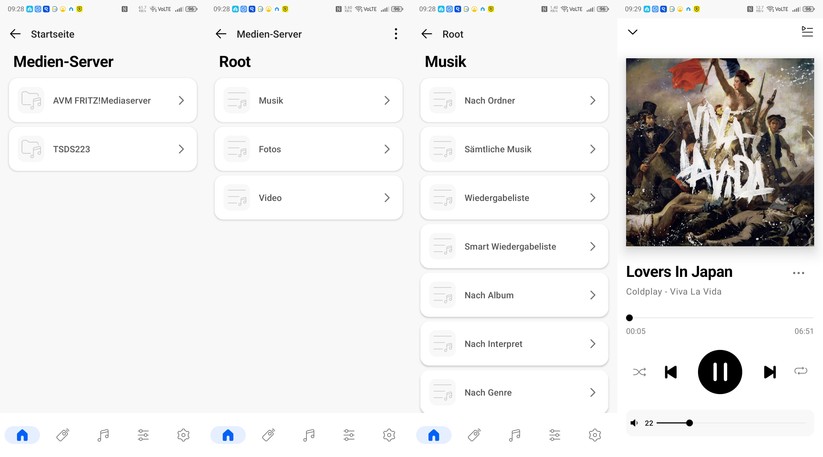
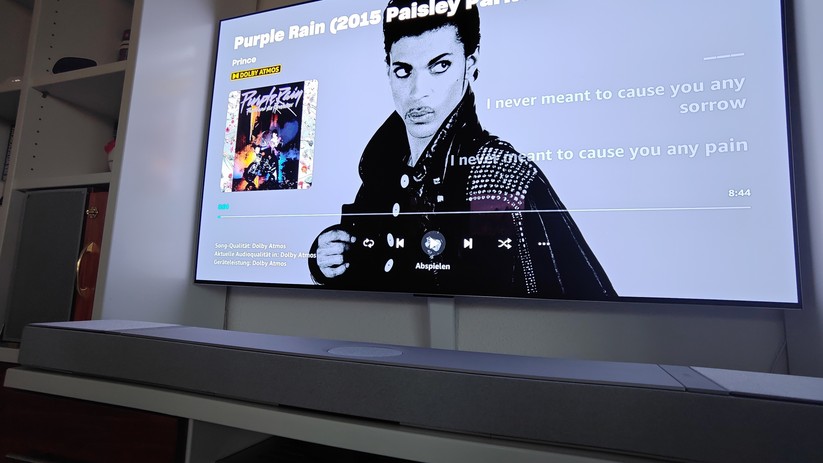

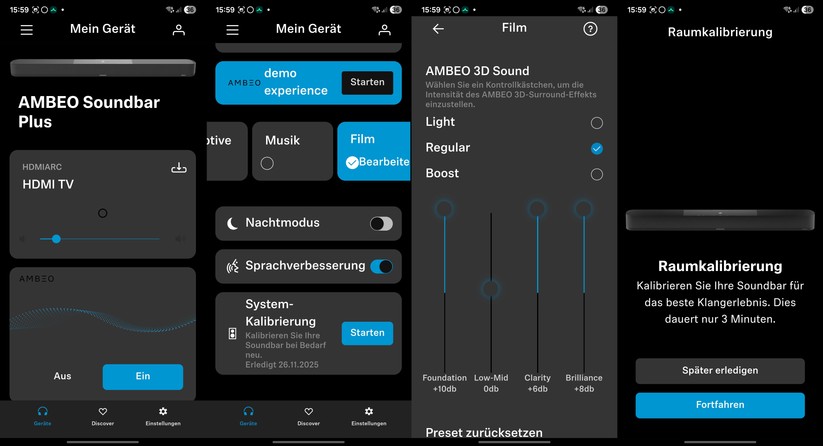
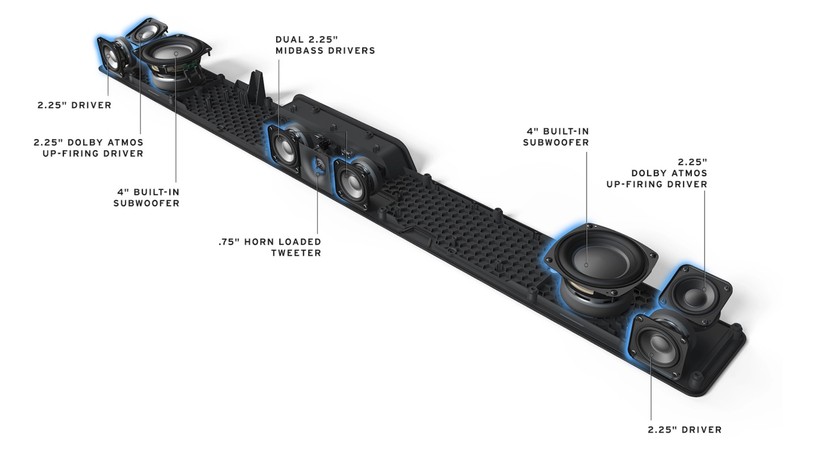
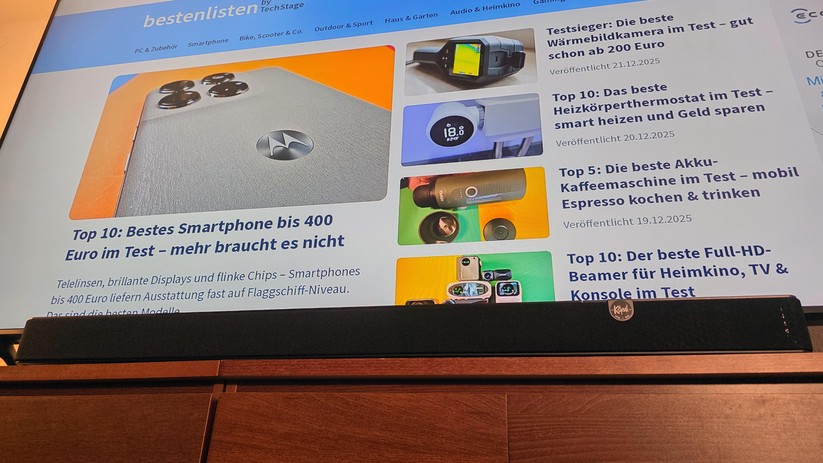
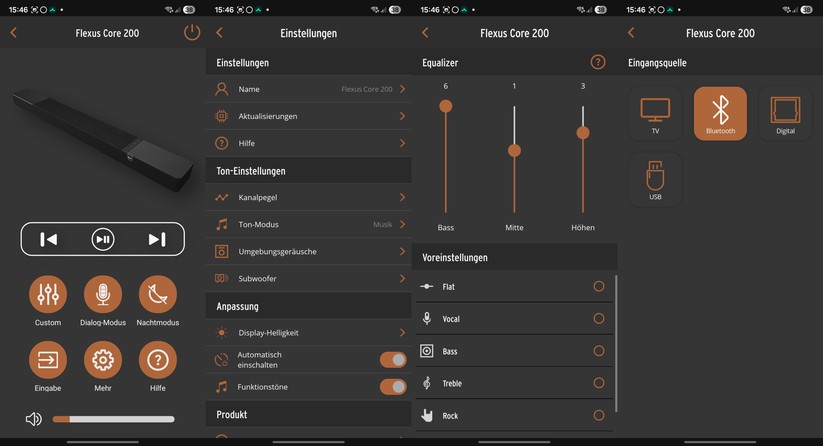
ZUSÄTZLICH GETESTET 



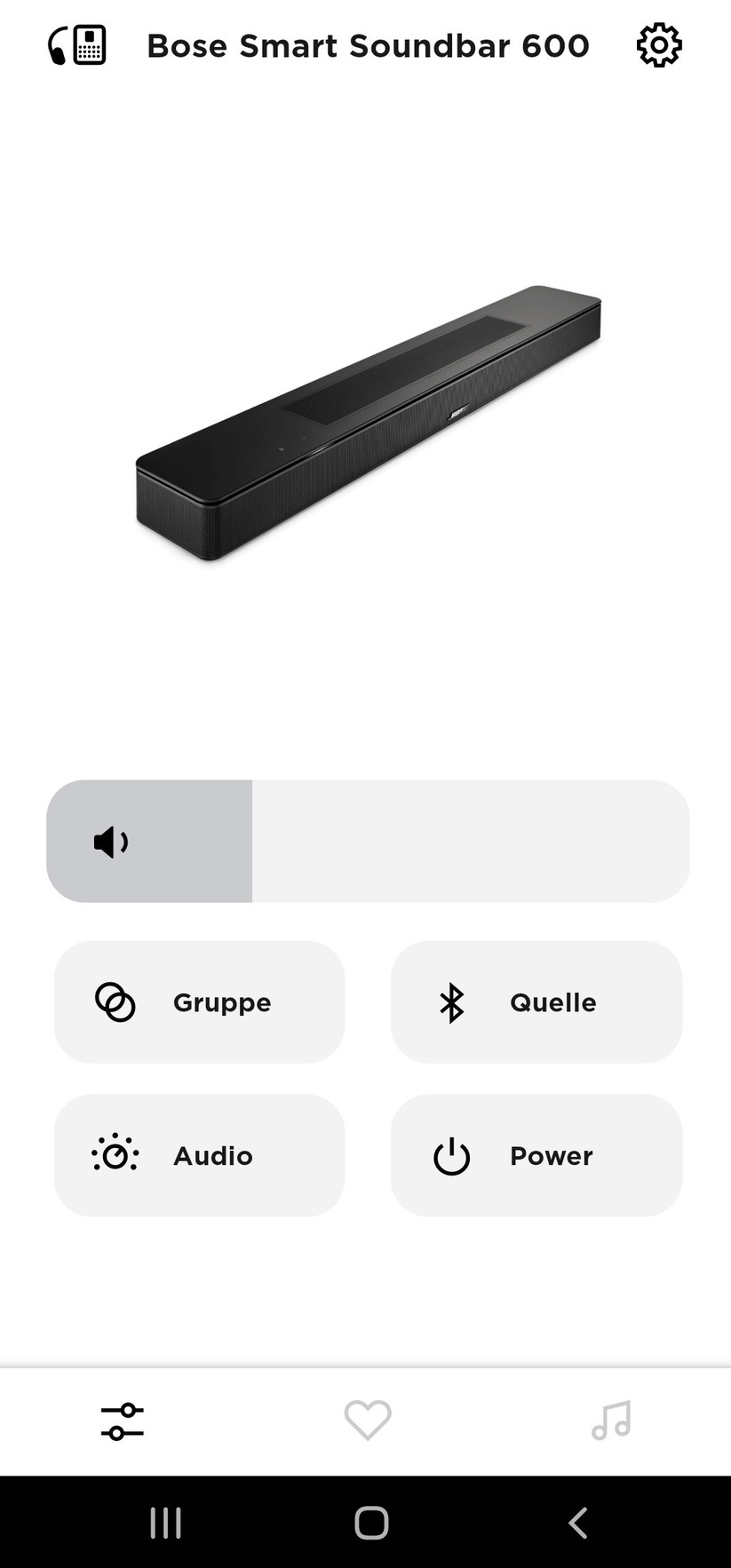


Testsieger
KEF Xio
Mit 12 Lautsprechern und einer Musikleistung von 820 Watt will die KEF Xio bei Soundbars neue Maßstäbe setzen. Ob und wie gut ihr das gelingt, zeigt unser Test.
VORTEILE
- klanglich herausragend, vor allem bei Musikwiedergabe
- viele Streaming-Clients integriert
- Ethernet-Netzwerkanschluss mit Zugriff auf lokalen Medienserver
NACHTEILE
- teuer
- WLAN-Zugriff problematisch
Soundbar KEF Xio im Test: grandioser Klang – auch ohne Subwoofer
Mit 12 Lautsprechern und einer Musikleistung von 820 Watt will die KEF Xio bei Soundbars neue Maßstäbe setzen. Ob und wie gut ihr das gelingt, zeigt unser Test.
Mit der Xio bringt der britische Soundspezialist KEF (Kent Engineering and Foundry) eine 5.1.2-Soundbar mit 820 Watt Musikleistung, die nicht nur mit Dolby-Atmos-Unterstützung bei der Wiedergabe von Filmsound überzeugen will, sondern vor allem auch Musikliebhaber begeistern soll. Bei einem Preis von 2300 Euro waren wir gespannt, ob die KEF Xio, die standardmäßig ohne Subwoofer kommt, diese Ansprüche erfüllen kann.
Ausstattung und Technik im Überblick:
- Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber, mit KEFs VECO-Technologie).
- Abmessungen & Gewicht: 70 × 1210 × 165 mm, 10,5 kg
- Intelligente Ausrichtung: Ein Lagesensor erkennt automatisch, ob die Soundbar steht oder hängt, und schaltet die Lautsprecherkanäle entsprechend um.
- Hochwertige Anschlüsse: HDMI 2.1 eARC (für Dolby Atmos & Co.), optischer Eingang, USB, Ethernet (für eine stabile Netzwerkverbindung und Zugriff auf einen lokalen Medienserver) sowie WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 5.3 (AAC).
- Smarte Integration: Die Soundbar lässt sich nahtlos in Home Assistant als Medienabspielgerät einbinden und unterstützt Apple Airplay und Google Cast.
- Unterstütze Dateiformate: Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM und Ogg Vorbis
Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie). KEF
Anschlüsse und Konnektivität
Die KEF Xio bietet eine solide Auswahl an physikalischen Anschlüssen und drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten, die jedoch mit einigen praktischen Einschränkungen verbunden sind.
- HDMI eARC: Dies ist der primäre Anschluss für die Übertragung hochauflösender Audiosignale (inklusive Dolby Atmos) vom Fernseher zur Soundbar. Einen weiteren HDMI-Anschluss gibt es nicht. Spielekonsolen müssen also über den TV angeschlossen werden.
- Optischer Digitaleingang (Toslink): Bietet eine weitere digitale Audioverbindung, ideal für ältere TVs oder andere Geräte wie Blu-ray-Player.
- Ethernet-Port: Ermöglicht eine kabelgebundene Netzwerkanbindung.
- USB-Anschluss: Wird primär für Firmware-Updates genutzt.
- Klinkenbuchse für Subwoofer: Ermöglicht den Anschluss eines aktiven externen Subwoofers über ein Klinke-auf-Cinch-Kabel (im Lieferumfang enthalten).
Bilder: KEF Xio
Praxistipp: Netzwerkverbindung
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die WLAN-Verbindung der Xio besonders dann zu Problemen neigen kann, wenn sich Soundbar und Steuerungsgerät (Smartphone/Tablet) in unterschiedlichen WLAN-Netzen befinden. Dies ist in vielen Haushalten mit separaten 2,4-GHz- und 5-GHz-Netzen oder mit Mesh-Systemen der Fall. Um Verbindungsabbrüche und Einrichtungsprobleme mit der KEF Connect App zu vermeiden, empfehlen wir, die kabelgebundene Ethernet-Verbindung zu verwenden. Diese ist in jedem Fall stabiler und sorgt für einen stressfreien Betrieb, insbesondere für das Streaming von Highres-Audio oder den zuverlässigen Zugriff auf den heimischen Medienserver (per DLNA).
Für Nutzer, die noch mehr Bassleistung wünschen, bietet KEF eine flexible Lösung an:
- Der separate KEF KW2-RC Funkadapter für 179 € kann mit kompatiblen KEF Subwoofern nachgerüstet werden.
- Der KW2-Rc verfügt über einen kombinierten Audioausgang (Klinke), der sowohl analoge Signale als auch ein optisches Toslink-Signal ausgeben kann. Dies ermöglicht auch die Verbindung mit Subwoofern anderer Hersteller. Allerdings muss man diese manuell einmessen, während KEF-Subwoofer automatisch eingemessen werden.
- Der Adapter kann wahlweise über die spezielle Steckverbindung am Subwoofer oder einer USB-Buchse mit Strom versorgt werden.
Einen immersiven Kinoklang mit Dolby Atmos bieten viele Soundbars. Doch bei der Musikwiedergabe hapert es meistens. Nicht so bei der KEF Xio. Was sie im Hinblick auf Musikwiedergabe leistet, sucht seinesgleichen. Mit Musik im Dolby-Atmos-Format kann man sich den Konzertbesuch sparen. heise bestenlisten
Aufbau und innovative Lautsprechertechnologie
Die KEF Xio kann liegend auf einem Möbelstück oder zusammen mit dem Fernseher mit der im Lieferumfang befindlichen Halterung an der Wand montiert werden. Ein besonderes Merkmal ist die fortschrittliche Uni-Q-MX-Lautsprechertechnologie. Diese koaxialen Chassis kombinieren Mittel- und Hochtöner in einer Einheit für einen präzisen und klaren Klang. Für den kräftigen Bass sollen vier neu entwickelte, ovale Tieftöner mit einer speziellen Membran aus Aluminium sorgen. Das integrierte VECO-System (Velocity Control) misst und regelt die Bewegung der Membranen aktiv. Dies soll für eine extrem präzise Wiedergabe sorgen und Verzerrungen verhindern, selbst bei hoher Lautstärke.
Die KEF Xio bietet verschiedene Klangprofile, die für verschiedene Einsatzzwecke gedacht sind:
- Standardeinstellung: Klingt klar und natürlich, mit hervorragender Räumlichkeit. Die Bässe sind überzeugend, aber nicht so brachial wie mit einem dedizierten Subwoofer.
- Film: Steigert die Räumlichkeit für ein immersiveres Kinoerlebnis, wobei die klare Differenziertheit des Klangs ein wenig leidet.
- Dialog: Ideal für Nachrichten und Dokumentationen, da es die Sprachwiedergabe gezielt hervorhebt. Verfälscht das gute Klangbild der Standardeinstellung kaum.
- Nacht: Reduziert Dynamik und Bässe für leises Hören, ist klanglich aber nicht sonderlich überzeugend.
- Musik: Erzeugt eine weite Bühne mit natürlichen Stimmen und einem detaillierten, präzisen Bass. Für Stereo-Quellen ist dieser Modus empfehlenswert, doch für Musik im Dolby-Atmos-Format ist das Standard-Profil besser geeignet.
- Direkt: Audioausgabe ohne Virtualisierung für ein unverfälschtes Klangerlebnis. Im Vergleich zu den anderen Modi fehlt es hier an Dynamik.
Die App ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Konfigurationsoptionen, etwa die Anpassung der Lautstärkeregelung. Auch kann man damit die Netzwerkgeschwindigkeit ermitteln und Firmware-Updates durchführen. heise bestenlisten
Klangerlebnis: Brillant, immersiv und kraftvoll
Die Klangqualität ist schlichtweg fantastisch. Die Soundbar erzeugt einen erstaunlich luftigen und dennoch kraftvollen Sound.
- Film top: Bei Actionszenen mit spektakulären Soundtracks glänzt die Xio. Der Dialog bleibt auch in den lautesten Momenten kristallklar. Die immersive Klangverteilung in Breite und Höhe ist vorbildlich, primär bei Filmen im Dolby-Atmos-Format.
- Musik hervorragend: Die Musikwiedergabe ist generell exzellent. Mit Musik im Dolby-Atmos-Format entfaltet sie ihr ganzes Potenzial und schafft ein beeindruckendes, immersives Klangerlebnis. Ein zusätzlicher Subwoofer ist für die meisten Hörer nicht nötig, kann aber nachgerüstet werden.
KEF Xio: Mit der KEF-App ist auch ein Zugriff auf einen lokalen Medienserver möglich. heise bestenlisten
Streaming und Bedienung
Bei den Streaming-Diensten wurde Wert auf Klasse statt Masse gelegt. Integriert sind Amazon Music, Deezer, Highres Audio, Qobuz, Tidal und Spotify. Praktischer ist es oft, die App des Streaming-Dienstes auf dem Smartphone zu nutzen und die Soundbar als Wiedergabegerät auszuwählen. Das empfiehlt sich vor allem bei Amazon Music, da der in der Xio integrierte Client keine Dolby-Atmos-Musik abspielt. Zudem streamt die Xio über DLNA direkt von einem Medienserver im lokalen Netzwerk. Das bietet sonst kaum eine andere Soundbar.
Die KEF Connect App steuert alle Einstellungen. Die Einrichtung und Verbindung sind stabil, die Logik der App ist jedoch gewöhnungsbedürftig (z. B. gibt es keine separate Ein-/Ausschalttaste). Mit der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Xio ebenfalls steuern. Damit sich die Xio zusammen mit dem Fernseher automatisch einschaltet, muss man in den Lautsprecher-Einstellungen als zweite Weck-Quelle die Option TV auswählen.
Die KEF Xio bietet nicht nur einen hervorragenden Klang bei Filmen, sondern überzeugt auch bei der Musikwiedergabe. heise bestenlisten
Preis
Die KEF Xio gibt es in Grau und in Schwarz für 2300 Euro. Das entspricht dem empfohlenen Verkaufspreis, günstigere Angebote gab es bislang nicht. Über den 179 Euro teuren Funkempfänger lassen sich aktive Subwoofer von KEF wie dem KC62, KC92 und Kube kabellos mit der Xio verbinden.
Fazit
Die KEF Xio ist ein absolutes Spitzenprodukt. Sie ist teuer, groß und schwer, aber klanglich auf einem herausragenden Niveau: fein auflösend, erstaunlich dynamisch und mit einem echten Surround-Feeling. Im Unterschied zum Mitbewerb sticht die exzellente Musikwiedergabe der Soundbar heraus, vor allem, wenn sie mit Musik im Dolby-Atmos-Format gefüttert wird.
Aber auch bei Filmen überzeugt sie mit klaren Dialogen und einem immersiven Kinoerlebnis. Natürlich ist das nicht so ausgeprägt wie bei Lösungen mit Rear-Lautsprechern. Der fehlende direkte Anschluss für Konsolen und die Eigenheiten der App sind die wenigen Kompromisse für dieses klangliche Meisterstück. Wem der gute Bass nicht reicht, kann die Xio mit einem Subwoofer erweitern. Wer hingegen nur eine Soundbar für ein immersives Kinoerlebnis sucht, wird mit der Samsung Q990F (Testbericht) deutlich günstiger bedient, muss dann aber bei der Musikwiedergabe erhebliche Abstriche akzeptieren.
Technologiesieger
Sonos Arc Ultra
Die Premium-Soundbar Sonos Arc Ultra klingt mit ihren 14 Treibern, dem Dolby Atmos und dem beeindruckenden Bass einfach fantastisch. Doch ist sie wirklich 1000 Euro wert? Wir machen den Test.
VORTEILE
- kräftiger Bass auch ohne Subwoofer und klare Höhen
- Dolby Atmos
- hochwertiges, schlichtes Design und solide Verarbeitung
- einfache Einrichtung und TV-Steuerung
- Bluetooth 5.3 und Sprachsteuerung
NACHTEILE
- kein Chromecast, kein Google Assistant
- App unnötig kompliziert
- Gesamtpreis steigt mit Zubehör schnell an
- ungünstig platzierte Touch-Bedienelemente
Soundbar Sonos Arc Ultra im Test
Die Premium-Soundbar Sonos Arc Ultra klingt mit ihren 14 Treibern, dem Dolby Atmos und dem beeindruckenden Bass einfach fantastisch. Doch ist sie wirklich 1000 Euro wert? Wir machen den Test.
Sonos zeigt mit der Arc Ultra einen Nachfolger für die beliebte Arc-Soundbar. Die neue Premium-Soundbar will mit 14 integrierten Treibern, Dolby Atmos-Unterstützung und der Sound-Motion-Technik für kräftigen Kinoklang im Wohnzimmer sorgen. Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von rund 1100 Euro positioniert sich die Arc Ultra im mittelhohen Preissegment.
In unserem Test hören wir genau hin und klären, ob sie den hohen Preis rechtfertigt. Während uns der mittlerweile für etwa 600 Euro erhältliche Vorgänger Arc im Test bereits klanglich überzeugte, verspricht die Ultra-Version noch mehr Leistung und neue Funktionen. Besonders interessant: Sonos hat die neue Soundbar mit Bluetooth 5.3 ausgestattet – ein Feature, das wir beim Vorgängermodell schmerzlich vermisst haben.
Optik & Verarbeitung
Die Sonos Arc Ultra ist ein eleganter, minimalistischer Sound-Balken mit den Maßen 117,8 × 11 × 7,5 cm (B×T×H). Mit 5,9 kg ist sie nicht übermäßig schwer. Erhältlich in Schwarz oder Weiß fügt sie sich dezent in Wohnzimmereinrichtungen ein und passt unter die meisten Fernseher ab 50 Zoll, ohne Teile des Bilds zu verdecken.
Das hochwertige Akustikgitter umschließt die gesamte Soundbar und verleiht ihr ein edles Erscheinungsbild. Die Verarbeitungsqualität ist auf höchstem Niveau – hier gibt es keine wackeligen Teile oder billig wirkende Elemente. Alle Kanten sind sauber verarbeitet.
Die Touch-Bedienelemente steuern die grundlegenden Funktionen wie Play, Pause und Lautstärke und befinden sich mittig auf der Oberseite im hinteren Bereich der Soundbar. Etwa bei einer Wandmontage sind diese schwer zu erreichen, was die Bedienung ohne App oder Fernbedienung erschwert. Die kapazitiven Taster können per App gesperrt werden.
Sonos Arc Ultra Bilder
Bedienung & App
Die Installation beschränkt sich auf das Anschließen des HDMI-Kabels und die Einrichtung über die Sonos-App. Die Lautstärkeregelung erfolgt in der Regel problemlos über die TV-Fernbedienung.
Die Soundbar unterstützt Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Sonos Voice (nur englisch und französisch), allerdings nicht Google Assistant. Ein Schalter deaktiviert das Mikrofon bei Bedarf – wichtig für alle, die Wert auf Privatsphäre legen. Allerdings ist der Schalter hinter der Soundbar schwer erreichbar.
Ein Feature, welches viele an der Sonos Arc vermissten, ist nun mit an Bord: Über Bluetooth lassen sich direkt externe Quellen ansteuern. Ein Display gibt es nicht. Stattdessen zeigen dezente LED-Anzeigen den Betriebszustand an. Diese minimalistische Gestaltung passt zum eleganten Design der Soundbar.
Die Sonos-App ist das Herzstück der Bedienung und bietet Zugriff auf Funktionen wie Streaming-Dienste, Multiroom-Audio und die Trueplay-Raumeinmessung. Letztere passt den Klang an die Raumakustik an. Das Einmessen funktioniert nur mit iOS-Geräten vollumfänglich. Es steht ein sehr rudimentärer Equalizer bereit, der die Höhen, die Tiefen und – sofern vorhanden – den Sub sowie die Rear-Lautsprecher anpasst. Die App beschneidet auf Wunsch auch die maximale Lautstärke. Zusätzlich steht eine Option zur Verstärkung von Dialogen bereit.
Die App ist mächtig, aber etwas verwirrend aufgebaut und mit gelegentlichen Abstürzen. Sonos verspricht Verbesserungen durch künftige Updates.
Klang
Die Sonos Arc Ultra klingt einfach hervorragend. Gerade wenn sie ganz alleine für den Sound verantwortlich ist, spielt sie ihre Stärken voll aus und klingt abermals klarer und kräftiger als ihr Vorgänger Sonos Arc. Das verdankt sie auch ihren 14 Treibern, welche den Klang über in den Raum wirft. Die Frequenzabdeckung reicht von 30 Hz bis 20.000 Hz. Besonders der außergewöhnlich tiefe Bass ließ uns zunächst zweifeln, ob wir nicht doch den Subwoofer zusätzlich angeschlossen haben. Aber nein: Die Sonos Arc Ultra schafft aus ihrem schlanken Gehäuse einen starken Bass, den wir so nicht erwartet hätten. Hier ist ein separater Subwoofer nicht zwingend erforderlich.
Nutzt man trotzdem zusätzlich einen Sonos Subwoofer, hebt es das Klangbild spürbar an. Wir haben das mit den Sonos Sub 4 ausprobiert. Tatsächlich scheint dann die Sonos Arc Ultra wie entlastet und mit mehr Kapazitäten, sich auf die hohen Frequenzen zu konzentrieren, die dann klarer und auch gerichteter wirken. Zusätzlich liefert der Sub 4 auf Wunsch einen Bass, der den Boden des Nachbarn zum Vibrieren bringt. Trotzdem verschwimmen hier die Unterschiede der Sonos Arc Ultra zur Sonos Arc – auch die Sonos Arc klingt mit Subwoofer deutlich besser. Der klangliche Unterschied zur Sonos Arc Ultra schrumpft.
Sonos Sub 4 Bilder
Bei Dolby Atmos-Inhalten entfaltet die Arc Ultra ihre volle Stärke. Klangeffekte werden präzise im Raum platziert, was ein immersives Hörerlebnis schafft. Besonders beeindruckend ist die Klarheit der Dialoge, die selbst in actionreichen Szenen gut verständlich bleiben. Der Bass drückt ordentlich, ohne zu übersteuern oder zu dröhnen.
Bei der Musikwiedergabe zeigt die Arc Ultra ein ausgewogenes Klangbild mit guter Detailtreue. Allerdings erreicht sie hier nicht das Niveau hochwertiger Stereo-Lautsprecher.
Technik
Die technische Ausstattung der Sonos Arc Ultra umfasst WLAN, Bluetooth 5.3, HDMI eARC und einen optischen Digitaleingang. Die Unterstützung für Dolby Atmos ermöglicht räumlichen 3D-Sound, während die von Sonos Sound-Motion getaufte Technik für spürbare Bässe ohne zusätzlichen Subwoofer sorgt.
Ein deutlicher Schwachpunkt ist die begrenzte Anschlussvielfalt. Mit nur einem HDMI-Eingang müssen Nutzer mit mehreren Quellgeräten entweder auf den Fernseher als Umschaltzentrale zurückgreifen oder zusätzliche Hardware anschaffen. Auch die fehlende Chromecast-Integration ist ein Manko, das besonders Google-Nutzer stören dürfte.
Einer der großen Vorteile von Sonos-Geräten ist ihr modularer Aufbau. So ist es jederzeit möglich, etwa die Sonos Arc Ultra mit einem Subwoofer und zusätzlichen Rear-Lautsprechern zu ergänzen.
Preis
Mit einem aktuellen Preis von 849 Euro ist die Sonos Arc Ultra kein Schnäppchen, bietet jedoch im Vergleich zum Vorgängermodell für 600 Euro einige Verbesserungen wie einen spürbar stärkeren Bass und Bluetooth.
Wer das volle Potenzial ausschöpfen möchte, sollte jedoch zusätzliche Investitionen einplanen. Ein Sonos Sub 4 gibt es bei Amazon für 759 Euro oder Rear-Lautsprecher Era 300 für 413 Euro bei Amazon treiben den Gesamtpreis schnell in die Höhe.
Fazit
Die Sonos Arc Ultra ist eine Premium-Soundbar, die vorwiegend mit ihrem exzellenten Klang überzeugt. Für Heimkino-Enthusiasten bietet sie mit Dolby Atmos-Unterstützung und der kräftigen Bass auch ohne Subwoofer einen beeindruckenden Sound. Wir kennen keine andere Soundbar, die ohne Unterstützung weiterer Lautsprecher besser, räumlicher und kräftiger klingt.
Allerdings gibt es auch Schwachpunkte: Die App ist unnötig kompliziert, die Touch-Bedienelemente sind bei der Wandmontage unpraktisch platziert, und das Fehlen von Google-Diensten schränkt die Flexibilität ein.
Für Nutzer, die bereits im Sonos-Ökosystem zu Hause sind oder eine hochwertige Einzellösung suchen, ist die Arc Ultra eine ausgezeichnete Wahl.
Sennheiser Ambeo Soundbar Plus
Breiter 3D-Klang aus einem kompakten Gehäuse, viele Anschluss- und Streaming-Optionen: Die Sennheiser-Soundbar überzeugt auch allein.
VORTEILE
- insgesamt voller und klarer Sound
- große Bühne und überzeugender virtueller Surround-Sound
- gute Sprachverständlichkeit bei Film und Fernsehen
- viele Anschlüsse inklusive HDMI-eARC, 2x HDMI-Eingängen und Sub Pre-Out
- modernes Streaming mit AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect und Tidal Connect
- bis zu 4 kabellose Ambeo-Subs
NACHTEILE
- hoher Preis
- kein Ausbau zu echtem Surround mit Rear-Lautsprechern
- kein Display
Sennheiser Ambeo Soundbar Plus im Test: Stark bei 3D, Anschlüssen und Sound
Breiter 3D-Klang aus einem kompakten Gehäuse, viele Anschluss- und Streaming-Optionen: Die Sennheiser-Soundbar überzeugt auch allein.
Die Ambeo Soundbar Plus ist das kompaktere Modell und unter der massiven Ambeo Soundbar Max angesiedelt. Sie soll dennoch ein 7.1.4-Heimkinosystem in nur einem einzigen, unter Fernseher oder Beamer-Leinwand aufgestellten Gerät nachbilden – also ohne Rearspeaker und Sub. Dafür setzt Sennheiser auf automatische Raumeinmessung, viele Tonformate und umfangreiche Konnektivität. Kann das wirklich klappen?
Design und Verarbeitung
Die Ambeo Soundbar Plus ist rund 105 cm breit, 7,7 Zentimeter hoch und etwa 12 Zentimeter tief, sie bleibt damit überschaubar voluminös. Trotzdem wiegt sie 6,3 Kilogramm und deutet damit schon mal ihre Pegel- und Tieftonfähigkeiten an. Das Gehäuse ist sauber verarbeitet und bleibt optisch zurückhaltend in mattem Schwarz mit hübschem Stoffbezug. Ein richtiges Display fehlt leider, stattdessen gibt es eine LED-Leiste für Status und Lautstärke. Sie versucht, mit Lauflichtern und unterschiedlichen Farben bei der Steuerung des Geräts zu unterstützen, die per Touch, Fernbedienung oder App möglich ist.
Die Touch-Tasten oben auf der Soundbar dürften dafür aber wohl am wenigsten zum Einsatz kommen. Daher ist es auch nicht weiter schlimm, dass sie kein Feedback auf Berührung geben. Eine Wandmontage ist möglich, die passende Halterung ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Alles andere ist für einen direkten Start nach dem Auspacken dabei – auch die hochwertige, teils aus Metall bestehende Fernbedienung samt Batterien.
Bilder: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.
heise bestenlisten
Anschlüsse und Ausstattung
Die Soundbar bietet zwei HDMI-2.0a-Eingänge und einen HDMI-Ausgang mit eARC – sie kann auf Wunsch also auch als Anschlussort für weitere Zuspieler dienen, falls am Fernseher keine HDMI-Plätze mehr frei sind. Durchleitung von 4K mit 60 Bildern pro Sekunde ist möglich, 4K mit 120 Bildern pro Sekunde hingegen nicht – für moderne Spielekonsolen ist das ein Nachteil. Zusätzlich gibt es einen optischen Digitaleingang und analogen Line-In-Anschlüsse über Cinch. Für einen externen Subwoofer ist ebenfalls ein Ausgang vorhanden, sodass jeder beliebige aktive Subwoofer zum Einsatz kommen darf – ohne Markenbindung an Sennheiser. Das bietet längst nicht jede Soundbar. Kabellos kommen Subs ebenfalls an die Soundbar Plus – bis zu vier (!) Ambeo-Subs lassen sich gleichzeitig auf diese Weise koppeln.
Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: Die HDMI-Anschlüsse erlauben nur 4K bei 60 Hz. Spielekonsolen sollten daher direkt mit dem TV verbunden werden. heise bestenlisten
Auch bei Funk und Streaming ist die Ausstattung modern. Unterstützt werden Bluetooth 5.0 und WLAN 6. Zudem sind Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect und Tidal Connect dabei. Das sorgt für flexible Zuspielwege und viel Komfort. Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa klappt direkt im Gerät, Google Assistant funktioniert über den Umweg eines entsprechenden Geräts in Kombination mit Chromecast built-in. Siri benötigt ein passendes Apple-Gerät und nutzt dann den Umweg über Airplay 2. Bei den Tonformaten ist die Soundbar ebenfalls breit aufgestellt. Zu den abspielbaren Codecs zählen Dolby Atmos inklusive Dolby TrueHD sowie DTS:X. Außerdem werden MPEG H Audio und 360 Reality Audio unterstützt. Ob all das am Ende ankommt, hängt vom Zuspieler und vom Fernseher ab.
Insgesamt stecken im Gerät 9 Lautsprecherchassis, angetrieben von neun Class-D-Endstufen mit zusammen 400 Watt RMS-Leistung. Zu den Speakern gehören 2 langhubige Tieftöner mit je 4 Zoll und 7 Breitbandtreiber mit je 2 Zoll. Spezielle Hochtöner gibt es nicht. Neben den Frontkanälen (links, Mitte, rechts) gibt es seitliche Abstrahlung für die Surround-Virtualisierung, und für die Höhen-Darstellung sind zwei nach oben abstrahlende Treiber (Upfiring) oben im Gehäuse eingebaut. Das ergibt rein hardwaretechnisch eher ein 5.1.2-Set-up, die von Sennheiser beworbene 7.1.4-Aufstellung wird durch digitale Virtualisierung und Schallreflexion an Wänden und Decke erreicht.
Aufbau, Inbetriebnahme und Steuerung im Alltag
Für Surround-Sound setzt die Sennheiser Ambeo Soundbar Plus auf Reflexion des Schalls. Entsprechend müssen die einzelnen Treiber nach vorn, seitlich und oben ungestört abstrahlen können. Der Aufbau ist grundsätzlich einfach. Die Soundbar sollte mittig unter Fernseher oder Beamer-Leinwand positioniert werden. HDMI-eARC ist der wichtigste Anschluss, der die Verbindung zwischen Fernseher und Soundbar herstellt. Dank CEC-Steuerung (Consumer Electronics Control) wird die Lautstärke der Soundbar später wie gewohnt über die Fernbedienung des Fernsehers gesteuert. Ansonsten braucht es nur noch den Stromanschluss – fertig.
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung. Dabei wird der Raum mit den integrierten Mikrofonen akustisch vermessen, bei uns verbesserte das Balance und Surround-Sound deutlich. Sehr hohe Decken, besonders große, offene Räume oder viel schallabsorbierende Stoffe und Möbel mindern den 3D-Effekt allerdings stark.
Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung. heise bestenlisten
Klangqualität
Bei Film und Fernsehen erzeugt die Soundbar in Tests eine breite Bühne. Linker und rechter Kanal sind klar getrennt. Stimmen bleiben normalerweise ab Werk schon gut verständlich, noch klarer wird es mit dem zuschaltbaren Dialogmodus. Bei hoher Ambeo-Intensität wirkt die Bühne zwar je nach Zuspielmaterial noch größer, aber bisweilen klingen Dialoge dann weniger direkt und unerwünschter Hall verstärkt sich.
In passender Umgebung ist Surround-Sound nach der automatischen Einmessung erstaunlich stark und präsent. Zwar erreichte die Soundbar im Test bei uns keine komplette 180-Grad-Abdeckung und mangels nachrüstbaren Rearspeaker können Nutzer hier auch nicht nachbessern. Aber bei passendem Zuspielmaterial werden rund 160 Grad abgedeckt. In diesem Bereich sind dann einzelne Effekte teils sehr präsent und räumlich – faszinierend, was die Technik imstande ist zu leisten. Bisweilen entsteht dann sogar ein nachvollziehbarer Höheneindruck, auch wenn das durch die Testräumlichkeiten denkbar erschwert wurde – so ist das nun mal in einem typischen Wohnzimmer mit Couch, Teppichen und Gardinen.
Der Bass ist dabei für eine Standalone-Soundbar schön kräftig. Sennheiser spricht von erreichbaren Frequenzen von bis zu 38 Hz, druckvoll sind realistisch aber eher um 50 Hz. Darunter sind dank leichter Überhöhung bei 55 und sogar 45 Hz Tieftöne zwar noch gut hörbar, haben jedoch nicht mehr die Intensität, die man von ordentlichen externen Subwoofern gewohnt ist. Gerade bei Filmen und bestimmten Musikrichtungen wie Hip-Hop oder Dubstep fehlt dann der nötige „Punch“.
Bei Musik zeigen sich eine generell gute Detailauflösung und saubere Mitten. Stimmen wirken klar, Höhen sind präzise, fallen in akustisch hellen Räumen aber etwas überpräsent aus. Hier hilft ein vorsichtiger Eingriff per Equalizer. Bei üblicher Zimmerlautstärke bleibt der Klang kontrolliert und dynamisch, bei sehr hohen Pegeln klingt er zunehmend spitz und hart. Heimkino hat uns damit mehr Spaß als Musik gemacht, wobei die aber durchaus auch mehr als erträglich ist.
Preis
Die UVP der Sennheiser Ambeo Soundbar Plus in Deutschland liegt bei 1.499 Euro. Der aktuelle Straßenpreis laut Geizhals.de liegt bei rund 979 Euro (Stand: 3/2026), zur Black Week war er sogar bei 849 Euro.
Fazit
Die Ambeo Soundbar Plus ist eine sehr gut ausgestattete Standalone-Soundbar für alle, die ohne Zusatzlautsprecher klaren, vollen 3D-Surroundsound wollen. Sie punktet mit breiter Bühne, guter Sprachverständlichkeit und vielen Zuspielwegen. Der virtuelle 3D-Effekt kann in passenden Räumen überzeugen, die Ambeo Soundbar Plus liefert hier unter 1000 Euro den besten „Mittendrin-Klang“. Nur mit echten Rears geht noch mehr. Wer zusätzlichen Bass will, greift zu bis zu 4 (!) kabellosen Subs oder schließt einen bereits vorhandenen aktiven Sub per Kabel an. Im Detail ist aber nicht alles perfekt. Musik etwa spielen andere Soundbars besser, etwa die Sonos Arc Ultra für weniger Geld. Außerdem dürfen Nutzer keine Rears nachrüsten – sehr schade. Das Gesamtpaket der Sennheiser-Soundbar ist aber hervorragend.
Sennheiser Ambeo Mini
Ausgereifte Technik ist keine Frage mehr von Platz oder Gehäusevolumen: Das beweist die neue Sennheiser-Soundbar Ambeo Mini, die neben Dolby Atmos, DTS:X sowie 360 Reality Audio auch Raumkalibrierung, Bluetooth, AirPlay 2, Google Chromecast und Sprachsteuerung beherrscht. Wie gut sie klingt, zeigt der Test.
VORTEILE
- sehr guter, räumlicher Klang
- viele Streaming-Optionen
- HDMI-Anschluss
- Dolby Atmos, DTS:X, Sony 360 Audio
- hoher Bedienkomfort
NACHTEILE
- relativ teuer
Sennheiser Ambeo Mini im Test: Kleine Soundbar für TV mit großartigem Raumklang
Ausgereifte Technik ist keine Frage mehr von Platz oder Gehäusevolumen: Das beweist die neue Sennheiser-Soundbar Ambeo Mini, die neben Dolby Atmos, DTS:X sowie 360 Reality Audio auch Raumkalibrierung, Bluetooth, AirPlay 2, Google Chromecast und Sprachsteuerung beherrscht. Wie gut sie klingt, zeigt der Test.
Dass man im Heimkino unbedingt die längste haben muss, gilt einfach nicht mehr. Auch eine kompakte Soundbar wie die Ambeo Mini beherrscht dreidimensionale Klangformate und erzeugt 7.1.4-Sound. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) hat Sennheiser an einer Virtualisierungs-Technik getüftelt, die ein komplettes Heimkinosystem mit sieben Boxen, Subwoofer und vier Deckenlautsprechern imitieren will. Zudem lässt sich die Soundbar per Smartphone kalibrieren und steuern. Wir haben die Sennheiser-Soundbar genau unter die Lupe genommen und unter anderem geprüft, wie gut der Klang und der Bedienkomfort abschneiden.
Design und Verarbeitung
Die Bezeichnung „Mini“ trägt die Ambeo Soundbar zu Recht in ihrem Namen: Denn mit einer Größe von 70 × 10 × 6,5 Zentimetern ist für den TV-Lautsprecher in jedem Wohnzimmer Platz. Der Schallwandler lässt sich dezent vor einem Flachbildfernseher platzieren, eine Wandmontage ist ab Werk nicht vorgesehen, hierfür benötigt man eine optionale Halterung. Der dunkelgraue Akustikstoff und die schwarze Bedienoberfläche harmonieren mit nahezu jeder Einrichtung. Zwei dezente Gummifüße schonen empfindliche Oberflächen, etwa von Sideboards. Mit einem Gewicht von 3,3 Kilogramm lässt sich die Soundbar bequem verstellen und gänzlich unkompliziert handhaben.
Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Der Stoffbezug liegt faltenfrei an und schmiegt sich auch an den seitlichen Rundungen perfekt um den Korpus. Die Anschlüsse an der Rückseite sitzen vertieft im Gehäuse, um Kabel sauber zu verlegen. Clever: Das Gehäuse ist leicht abgeschrägt, um die Bedienung des 7.1.4-Systems zu erleichtern. Lobenswert: Die schwarze Oberfläche ist absolut immun gegen Fingerabdrücke. Diese haben im Gegensatz zu schwarzen Hochglanzoberflächen nahezu keine Chance.
Anschlüsse und Ausstattung
Bei den Anschlüssen und der Ausstattung lässt sich Sennheiser nicht lumpen. Die Gehäuserückseite ist mit einem HDMI-Port mit eARC (Enhanced Audio Return Channel, ermöglicht höhere Bandbreiten und die Übertragung von hochauflösenden Surround-Toninformationen), mit einer USB-Buchse zur Stromversorgung externer Geräte, dem Stromanschluss sowie Reset- und Setup-Taste noch übersichtlich ausgestattet. Dank der Technik im Gehäuse läuft die Ambeo Mini jedoch zur Höchstform auf.
Zum Streamen unterstützt der Klangzwerg neben Bluetooth und WLAN auch Apple Airplay 2, Chromecast Built-In sowie Alexa Built-In, außerdem die Musikportale Spotify Connect und Tidal Connect. Nutzer können auch vorhandene Google Assistant- oder Siri-fähige Geräte verwenden, um Audio-Inhalte über Chromecast oder AirPlay 2 an die Ambeo Soundbar Mini zu übertragen. Diese verfügt über vier integrierte Mikrofone, welche einerseits Sprachbefehle für Alexa entgegennehmen, andererseits für die Raumkalibrierung benötigt werden. Über die Fernbedienung stehen inhaltsspezifische Presets wie „Music“, „Movie“, „News“, „Sports“ und „Neutral“ zur Verfügung. Im Setting „Adaptive“ versucht die Ambeo wiedergegebenen Inhalten selbst ein Genre zuzuordnen und den Klang in Eigenregie zu optimieren. Eine Option zur besseren Sprachverständlichkeit und ein nachbarschaftsfreundlicher Nachtmodus lassen sich bei Bedarf dazuschalten.
Will man die Soundbar mit einem Flat-TV koppeln, so erfolgt die Verbindung über das mitgelieferte HDMI-Kabel. Natürlich kann die Ambeo auch autark spielen, dazu verbindet man sie drahtlos per Bluetooth, Airplay 2 oder Chromecast mit einem Mobilgerät oder einem Desktop-PC.
Im ersten Schritt muss man den Lautsprecher einrichten. Dazu ist die kostenlos für iOS und Android erhältliche App „Sennheiser Smart Control“ erforderlich. Nachdem man die Bluetooth-Freigabe erteilt hat, wird die Soundbar nach wenigen Sekunden automatisch gefunden. Jetzt wird der Lautsprecher noch ins heimische WLAN eingebunden – das komplette Setup ist super unkompliziert und blitzschnell auch von absoluten Laien erledigt. Die App sucht nach frischer Firmware und installiert diese umgehend. Um sich optimal auf die häusliche Umgebung anzupassen, in der die Ambeo steht, führt diese eine rund dreiminütige Raumkalibrierung durch. In dieser Zeit spielt sie verschiedene Testtöne ab, um beispielsweise herauszufinden, ob sich in der Nähe des Lautsprechers reflektierende Oberflächen oder schallschluckende Materialien befinden.
Anschließend ist die Soundbar betriebsfertig und lässt sich vollständig über die App steuern. Anpassen kann man die Lautstärke, zudem besteht Zugriff auf sämtliche Quellen und Anschlüsse, auf mögliche Center- und Subwoofer-Setups – falls entsprechende Geräte angeschlossen sind – sowie Soundmodi, das Nacht-Setup und die Sprachverbesserung.
Ebenfalls unproblematisch gelingt die Bedienung über den mitgelieferten schwarzen Steuerstab. Dieser ist schwer, liegt gut in der Hand, die 14 Tasten sind übersichtlich angeordnet, neigen jedoch dazu, leicht zu verfusseln. Hier wäre eine Polyurethan-Beschichtung wünschenswert, die Sony beispielsweise bei seinen höherwertigen TV-Fernbedienungen verwendet. Quelle, Lautstärke und Modi ändert man auch über den Sennheiser-Steuerstab sehr intuitiv. Dies klappt zudem über fünf drucksensitive Tasten auf dem Gehäuse. Ein Leuchtstreifen auf der Soundbar informiert durch wechselnde Farben über die gerade aktive Quelle und die Lautstärke-Intensität.
Das Sennheiser-Bedienkonzept verdient Bestnoten. Ohne Eingewöhnungszeit hat man die Soundbar per App, Fernbedienung oder mittels Gehäusetasten sofort im Griff. Einen Blick in die Anleitung kann man sich weitgehend sparen. Zum Glück, denn das großformatige Faltblatt ist sehr unübersichtlich gestaltet und bereitet wenig Freude beim Stöbern.
Sennheiser Ambeo Mini: Bilderstrecke
Klangeigenschaften
Hoppla, was ist da denn plötzlich los? Kaum wird der Ambeo Mini unsere Spotify-Playlist mit einer bunten Mischung diverser Genres präsentiert, spielt diese mit einer ungeahnten Räumlichkeit und Dynamik auf. Von Zurückhaltung keine Spur! Der Lautsprecher im Mittelklasse-65-Zöller von Panasonic klingt dagegen mit denselben Inhalten eher wie ein schlapper Radiowecker. Ganz anders der Sennheiser-Winzling: Mit seinen wuchtigen Klängen umhüllt er die Zuschauer auch auf seitlichen Sitzplätzen.
Für maximale Raumfülle muss man die Ambeo-Taste auf der Fernbedienung oder in der App drücken, der entsprechende Schriftzug leuchtet unten rechts an der Soundbar auf. Die Ambeo Mini webt einen noch breiteren Soundkokon, der alle Zuhörer angemessen umgibt. Actionstreifen mit Dolby-Atmos-Inhalten steigern die Transparenz zusätzlich, Höheneffekte wie Regentropfen, ein Pistolenschuss oder die Geräusche eines Hubschraubers lassen sich recht präzise orten. Das Ergebnis kann jedoch mit größeren Soundbars oder separaten Höhenlautsprechern nicht mithalten.
Die Sprachverständlichkeit der Ambeo ist vorzüglich. Ob Nachrichtensprecher, Talkgäste oder Schauspieler: Es bedarf keiner Anstrengung, um die Protagonisten perfekt wahrzunehmen. Die menschliche Stimme wird präzise und glasklar herausgearbeitet, auch wenn im Hintergrund Musik spielt oder etwa eine viel befahrene Straße Lärm verursacht. Chapeau!
Noch in einem anderen Punkt überrascht die Soundbar positiv: Sie liefert viel mehr und deutlich wuchtigeren Bass als erwartet. Der Tieftonteppich ist dick gewebt, mitunter darf es sogar einen Tick weniger sein. Als optimalen Klangmodus raten wir zu „Film“ (in der App) genauer gesagt „Movie“ (auf der Fernbedienung). Für die meisten Inhalte und Genres ist die Sennheiser-Soundbar so optimal eingestellt.
Technische Daten
Die Ambeo Mini hat einen 250 Watt starken Class-D-Verstärker an Bord, der vier Breitbandtreiber und zwei Vier-Zoll-Subwoofer antreibt. In den Tieftonkeller klettert der Lautsprecher auf bis zu 43 Hertz hinab. Für noch mehr Wumms lassen sich bis zu vier Ambeo Subs kabellos mit der Soundbar verbinden. Die Mini unterstützt die Audio-Formate Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H-Audio-Codecs sowie 360 Reality Audio.
Preis
Sennheiser verlangt für die Ambeo Mini 799 Euro. Generell ist die Soundbar auch bei großen Ketten und Internet-Anbietern sehr preisstabil. Mit ein wenig Stöbern findet man den Klangriegel bei vereinzelten Online-Händlern inzwischen schon ab 556 Euro (3/2026).
Fazit
Mit der Ambeo Mini hat Sennheiser ein perfektes Soundbar-Gesamtpaket geschnürt: Der kleine TV-Lautsprecher benötigt nicht viel Platz, spielt aber trotzdem druckvoll und voluminös mit sattem Bass. Die Verarbeitung des Klangzwergs ist top, der Bedienkomfort via App und Fernbedienung hoch, und mit allen aktuellen Streamingmöglichkeiten müssen speziell Musikfans keine Kompromisse eingehen. Wenn man unbedingt einen kleinen Kritikpunkt suchen möchte: Mit knapp 700 Euro ist die Ambeo Mini aber kein Schnäppchen – dafür erhält man auch bewährte und hochwertige Sennheiser-Technik.
Denon Home Sound Bar 550
Dolby Atmos, DTS:X, Sprach- und App-Steuerung, AirPlay 2 und Multiroom: Denon hat seine 500-Euro-Soundbar mit jeder Menge Technik und Ausstattung vollgestopft. Die gute Nachricht: Auch die Akustik ist klasse.
VORTEILE
- starker Klang
- Atmos, DTS:X, Dolby Digital
- Multiroom-tauglich
- gute Verarbeitung
NACHTEILE
- kein Display
Denon Home Sound Bar 550 im Test: Toller Klang, Dolby Atmos & DTS:X
Dolby Atmos, DTS:X, Sprach- und App-Steuerung, AirPlay 2 und Multiroom: Denon hat seine 500-Euro-Soundbar mit jeder Menge Technik und Ausstattung vollgestopft. Die gute Nachricht: Auch die Akustik ist klasse.
Vernetzung, Apps und Streaming haben mittlerweile auch das Segment der Soundbars erreicht. Was manchmal nicht mehr als eine nette Spielerei ist, bietet beim Denon-Klangriegel einen echten Mehrwert. Denn die Heos-Anwendung holt eine riesige Fülle bekannter Streaming-Dienste auf den TV-Lautsprecher. So viel Flexibilität und Auswahl bereiten wirklich Freude.
Design und Verarbeitung
Die Denon Home Sound Bar 550 ist erstaunlich kompakt. In der Breite bringt sie es gerade mal auf 65 Zentimeter, die meisten ausgewachsenen Klangriegel kommen hier auf rund einen Meter. Mit 7,5 Zentimeter in der Höhe und 12 Zentimeter in der Tiefe ist der 3,5 Kilo leichte Lautsprecher problemlos vor den meisten Flat-TVs zu platzieren.
Die Verarbeitung ist sehr gut, die Soundbar ist in grau-schwarzen Akustikstoff gehüllt. Gummifüße schützen empfindliche Oberflächen, Aufhängungen für die Wandmontage sind bereits in der Rückseite integriert. Die Front ziert eine Status-LED, oben sitzt ein Annäherungssensor, der Tasten einblendet, sobald man sich mit der Hand nähert. Alle Kanten der Box sind schön abgerundet, sodass sich diese angenehm anfühlen.
Technische Daten
Die Denon Home Sound Bar 550 verfügt über insgesamt sechs Treiber. Verbaut sind zwei Hochtöner à 19 mm, zudem vier Full-Range-Treiber mit jeweils 55 mm und drei Passivmembranen mit jeweils 50 x 90 mm.
Der Lautsprecher unterstützt die räumlichen Klangformate Dolby Atmos und DTS:X und spielt WMA-Dateien mit einer Auflösung von bis zu 192 kbps ab. Ebenso ist die Wiedergabe von AAC und MP3 mit bis zu 320 kbps, FLAC, WAV und ALAC mit maximal 24-bit/192 kHz sowie DSD 2.8 und 5.6 MHz möglich. Nach einem Software-Update lassen sich optional Denon Home-Lautsprecher als Surround-Boxen hinzufügen.
Anschlüsse und Ausstattung
Versetzt in der Rückseite eingelassen, damit sich Kabel bei einer Wandmontage sauber nach unten verlegen lassen, findet man einen HDMI-Ein- sowie einen -Ausgang mit Enhanced Audio Return Channel (eARC). Zudem gibt es einen optischen Digitaleingang, einen 3,5-mm-AUX-Eingang sowie einen USB-Port, über den man Musik abspielen kann. Ins Internet wird der Lautsprecher über ein Netzwerkkabel oder via WLAN eingebunden. Zudem beherrscht der Schallwandler Bluetooth, um sich mit einem Mobilgerät oder per PC zu koppeln. Wer ein Apple-Gerät besitzt, freut sich über die Unterstützung von AirPlay 2. Zudem beherrscht die 550 die Steuerung per Sprache mittels Alexa.
Über die Fernbedienung kann man zwischen den Klangmodi „Movie“ und „Music“ wechseln, im „Pure“-Setting gibt die Soundbar die Musik bzw. den Audio-Inhalt unverfälscht wieder. Im „Night“-Modus agiert die Denon-Box zurückhaltender, damit auch der Nachwuchs im Zimmer und der Nachbar ungestört schlafen können. Stimmen lassen sich über das Feature „Dialog Enhancer“ hervorheben.
Ihr volles Potenzial schöpft die Soundbar mit der für iOS und Android kostenlos erhältlichen „HEOS“-App aus. Über diese hat man Zugriff auf Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music oder Napster (kostenpflichtige Abos sind Voraussetzung), außerdem auf tausende Internet-Radiosender via TuneIn, auf Songs vom USB-Stick oder von einer Netzwerkfestplatte. Zudem kann man die Eingänge wechseln.
Einrichtung und Bedienung
Soll die Soundbar an einen Flat-TV angeschlossen werden, verwendet man hierzu idealerweise ein HDMI-Kabel und muss im TV-Menü unter Umständen noch die externe Tonausgabe bzw. HDMI ARC aktivieren.
Wer gerne per Bluetooth streamt, wählt die entsprechende Quelle über die Fernbedienung und koppelt sein Mobilgerät mit der Soundbar – auch das ist ein Kinderspiel. Der Signalgeber ist etwas größer als eine Scheckkarte und hat 19 gummierte Tasten. Diese lassen sich präzise drücken, allerdings verfusselt der Gummiüberzug rasch und sieht dann nicht mehr so attraktiv aus. Mit einem feuchten fusselfreien Tuch kann man der Oberfläche aber ruckzuck wieder ihre ursprüngliche Optik verleihen.
Die Tastenbelegung ist sinnvoll und hinterlässt keine offenen Fragen. Klasse ist der Annäherungssensor, der das Bedienfeld auf der Oberseite aus dem Nichts erscheinen lässt und Funktionen für die Lautstärkeregelung, Play/Pause, die Stummschaltung von Alexa und zum Überspringen oder Neustarten von Songs zur Verfügung stellt.
Die Heos-App ist auch von Laien sehr zügig eingerichtet. Nach wenigen Sekunden wird die Denon Home 550 eigenständig gefunden. Der Benutzer kann einen Raumnamen bestimmen – das ist sinnvoll, wenn man mehrere Lautsprecher integriert und einen Multiroom-Verbund aufbaut – und legt fest, ob die Soundbar an der Wand hängt oder auf einem Tisch liegt.
Klangeigenschaften
Die Denon Home Sound Bar 550 klingt erstaunlich ausgewachsen und erwachsen, viel fülliger, als man bei diesem 65 Zentimeter kurzen Klangzwerg erwarten würde. Ob Klassik, Schlager, Pop oder Rock – der TV-Lautsprecher ist für jedes Genre geeignet, agiert auch bei flotten Passagen souverän und standfest.
Die Sprachverständlichkeit ist exzellent, insgesamt hat Denon seine Box sehr homogen abgestimmt. Die 500-Euro-Soundbar zeigt sich äußerst spielfreudig und dynamisch, fast schon druckvoll. Instrumente werden sauber herausgearbeitet, die 550 begeistert hier durch ihre Trennschärfe und baut eine gelungene Kulisse mit ordentlich breiter Klangbühne auf – immer unter Berücksichtigung der kompakten Abmaße.
Speziell Actionfilme mit Dolby-Atmos-Unterstützung sind ein Ohrenschmaus, denn Effekte wie ein vorbeifliegender Hubschrauber oder eine knallende Autotür stellt die Denon plastisch in den Raum. Insgesamt sind wir mit der Akustikfülle sehr zufrieden, gegenüber fast allen selbst höherpreisigen Fernsehern peppt die Soundbar die Akustik deutlich auf. Noch ein Lob gibt es für den Bass: Das Tieftonfundament des Lautsprechers ist angenehm ausgeprägt, man spürt den Donner am Himmel oder das Dröhnen der Formel-1-Boliden.
Denon Home Sound Bar 550 - Bilderstrecke
Preis
Denon hat die Home Sound Bar 550 auf seiner Homepage von ursprünglich 649 auf 499 Euro reduziert. Das ist angesichts der gebotenen Klangperformance und der Ausstattung ein mehr als fairer Preis. Wer im Internet ein wenig stöbert, kann beim Kauf noch bis zu 50 Euro gegenüber dem Denon-Preis sparen. Ein Ebay-Händler bietet sie aktuell für 470 Euro an. Dann ist die 550 zwar immer noch kein Schnäppchen, aber eine preislich sehr attraktive Soundbar-Investition.
Fazit
Mehr muss man nicht haben, um den TV-Sound auf ein deutliches höheres Niveau zu heben und Musikstreaming klanglich ohne Kompromisse zu genießen. Die Denon Home Sound Bar 550 hat abgesehen vom fehlenden Display keine Schwäche, spielt sehr dynamisch mit ordentlichem Bass und eröffnet dank Heos-App den Zugriff auf eine riesige Musikfülle. Ihr Bedienkomfort ist hoch, die Verarbeitung top und der Preis fair – es gibt kein Argument mehr, sich weiterhin über den dürftigen TV-Ton zu ärgern.
Soundbar Nubert nuBoxx AS-425 max
Für mehr TV-Spaß im Wohnzimmer schickt Nubert seine neue vollaktive Zwei-Wege-Soundbar Nuboxx AS-425 max ins Rennen. Die integrierte „Hörizonterweiterung“ soll die Klangbühne deutlich vergrößern. TechStage hat ausprobiert, ob das funktioniert.
VORTEILE
- Hervorragender Klang selbst ohne externen Subwoofer
- eARC
- Bluetooth-Streaming
NACHTEILE
- Eingeschränkter Bedienkomfort
- kein Dolby Atmos
Soundbar Nubert nuBoxx AS-425 max im Test
Für mehr TV-Spaß im Wohnzimmer schickt Nubert seine neue vollaktive Zwei-Wege-Soundbar Nuboxx AS-425 max ins Rennen. Die integrierte „Hörizonterweiterung“ soll die Klangbühne deutlich vergrößern. TechStage hat ausprobiert, ob das funktioniert.
Als Nachfolgerin der nuPro AS-250 ordnet sich die vierte aktuelle Nubert-Soundbar zwischen der nuBox AS-225 und der großen nuPro AS-3500 ein. Als voll aktives All-in-one-Soundsystem nimmt der Lautsprecher Verbindung mit dem Fernseher, Satelliten-Receiver, Blu-ray-Player oder Smartphone auf. Reicht die Soundbar-Mittelklasse von Nubert aber auch aus, um eine erstklassige Akustik zu genießen?
TechStage testet die Nubert Nuboxx AS-425 max im Rahmen der Themenwelt Soundbars. Neben Einzeltests haben wir dort Hintergrundartikel veröffentlicht, etwa den Grundlagenartikel Soundbars: Fetter Klang für flache TVs.
Design und Verarbeitung
Schwarz/Graphit und Weiß/Eisgrau sind die beiden Farbkombinationen, in denen die Nubert-Soundbar zu haben ist. Ihr Gewicht von 15,2 Kilo ist ein erstes Indiz dafür, dass der Hersteller auf ein hochwertiges Innenleben mit vernünftigen Komponenten setzt. Mit 86 x 34 x 12,9 Zentimeter ist die Nuboxx AS-425 max ein ausgewachsener Schallwandler, der Flachbildfernseher mit einem Maximalgewicht von 50 Kilogramm trägt. Das massive und verwindungssteife Gehäuse besteht aus 19 Millimeter starken mitteldichten Faserplatten. Während der Korpus mit einer Dekorfolie überzogen ist, wurde die Schallwand seidenmatt lackiert. Die Frontabdeckung aus grauem Akustikstoff hält magnetisch. Insgesamt ist die Soundbar ordentlich verarbeitet. Wer auf mehr Schick steht und sich beispielsweise gebrochene Kanten wünscht, muss preislich in ein höheres Regal greifen.
Technische Daten
Nubert hat die Nuboxx AS-425 max als vollaktive Zwei-Wege-Soundbar mit einer aktiven Weiche sowie insgesamt vier Digitalverstärkern mit jeweils 40 Watt Dauerleistung konzipiert. Der Lautsprecher arbeitet als Stereosystem mit einem linken und einem rechten Kanal. Über die integrierte Wide-Schaltung lässt sich die Klangbühne erweitern.
Für den Hochtonbereich zeichnen zwei Seidengewebekalotten mit 25 Millimetern Durchmesser verantwortlich, für die Bässe und die mittleren Frequenzen kommen zwei 118-Millimeter-Langhub-Chassis zum Einsatz.
Anschlüsse und Ausstattung
Als Anschlüsse stellt die Soundbar einen HDMI-Port mit eARC-Standard, einen optisch-digitalen sowie einen analogen Cincheingang und einen Subwoofer-Ausgang bereit. Die Übergabefrequenz liegt bei 80 Hertz. Smartphones und Tablets lassen sich zur drahtlosen Musikwiedergabe per Bluetooth koppeln.
Die Nuboxx AS-425 max gibt nicht nur Ton im PCM-Format wieder, sondern dekodiert auch Dolby-Digital- (AC3) sowie DTS Digital Surround. Dolby Atmos gehört nicht zum Portfolio. Beim Streamen unterstützt der Klangriegel aptX HD (Android) und AAC (iOS) für hochauslösende Musikwiedergabe.
Auf ein Display verzichtet die Nuboxx AS-425 max, Nubert vertraut vielmehr auf ein Bedienkonzept mit farbigen LEDs an der Gerätefront. Eine Fernbedienung wird mitgeliefert.
Einrichtung und Bedienung
Eine Installation bzw. Einrichtung der Nubert-Soundbar ist nicht erforderlich. Idealerweise wird diese per HDMI-Kabel an den Flat-TV angeschlossen, hier muss man lediglich noch die externe Tonausgabe bzw. HDMI ARC aktivieren, fertig!
Die mitgelieferte Fernbedienung ist etwas größer als ein Signalgeber im klassischen Scheckkarten-Format. Ihre hochwertige Oberfläche besteht aus Metall, die insgesamt 17 Tasten verfügen über einen sauberen Druckpunkt. Lautstärke, Wahl der Quelle und Anpassungen des Klangs lassen sich direkt über die Fernbedienung vornehmen. Persönliche Soundeinstellungen können über drei Speichertasten abgelegt und jederzeit wieder aufgerufen werden. Das ist praktisch!
An der Soundbar selbst befindet sich ein multifunktionaler Drehregler, der leider nicht sonderlich stramm sitzt und sich zu schwammig anfühlt. Über ihn verändert man neben der Lautstärke auch die Quelle sowie die Bass- und Klangregelung. Mit der Häufigkeit, mit der man auf den Regler drückt, entscheidet man über das jeweilige Menü. Die einzelnen Zuspiel-Optionen sind aufgedruckt, zudem leuchten LEDs in der passenden Farbe, bei Bluetooth beispielsweise blau oder rot, wenn der optische Digitaleingang belegt ist.
Je nach Farbe des LED-Rings kann man Rückschlüsse auf das aktuelle Audiosignal ziehen: PCM leuchtet weiß, Dolby Digital rosa, und für DTS hat Nubert orange reserviert. Als Besitzer der Nuboxx AS-425 max muss man sich jedoch noch mehr Farben merken. Erstrahlen die um den Drehregler angeordneten LEDs in grün, so befindet man sich im Setup für die Bassintensität, bei blauen LEDs kann man den Mittel- und Hochtonbereich modifizieren. Und je nachdem, welche LEDs leuchten, erkennt man, ob die Hörerweiterung aktiviert ist bzw. ob die Klangbühne eher dezent oder stark wächst.
Auch für die Fokussierung auf die Sprachwiedergabe hat der Hersteller eine spezielle LED-Konfiguration hinterlegt. Für unseren Geschmack ist das etwas zu viel LED-Spektakel, ein klassisches Display wäre deutlich aussagekräftiger. Positiv anzumerken ist, dass die LEDs auch durch die aufgesetzte Stoffblende problemlos zu erkennen sind.
Zur Ausstattung der Soundbar gehört eine Standby-Automatik – liegt für 20 Minuten kein Signal an, schaltet sich der Lautsprecher eigenständig aus.
Nubert Nuboxx AS-425 max: - Bilderstrecke
Klangeigenschaften
Wir testen die Soundperformance der Nuboxx AS-425 max sowohl im TV-Betrieb über HDMI als auch via Bluetooth-Streaming. Was in beiden Fällen sofort auffällt: Die Nubert-Soundbar strotzt nur so vor Spielfreude, intoniert ungemein leicht und unangestrengt. Bei „Hero“ von Family of the Year gefallen uns ihre Dynamik und die Lebendigkeit der Inszenierung. Die Saitenanschläge der Gitarre sind sehr plastisch, Stimmen wunderbar warm und perfekt zu verstehen. Die feine Auflösung des Schallwandlers spürt man auch bei „Calm After The Storm“ von The Common Linnets. Hier deutet die AS-425 max an, dass sie sich nicht nur im Tieftonkeller wohlfühlt, sondern vor allem mit glasklaren Höhen punkten kann. „Another One Bites The Dust“ von Queen untermauert, dass die Nubert-Bässe knackig-trocken ohne Nachhall zum Leben erweckt werden – zwar nicht mit furchteinflösender Wucht, aber mit dem Temperament, das absolut familien- und damit wohnzimmertauglich ist.
Auch wer auf Klassik steht, hat mit der Nuboxx seine Freude. In konzertanten Darbietungen trennt die Soundbar einzelne Instrumente messerscharf und bleibt in hektischeren Sequenzen absolut souverän. Die Streicher in Mozarts Symphony No. 40 gehen mühelos jedes Tempo mit, ohne unpräzise oder gar verzerrt zu klingen. Bei Nachrichten oder Talkshows sollte man mal die Funktion „Voice+“ aktivieren: Stimmen werden jetzt noch stärker betont und hervorgehoben.
Absolut empfehlenswert ist die „Hörizonterweiterung“: In der intensivsten Stufe hat man das Gefühl, Nubert zieht links und rechts der Soundbar virtuelle Schallschutzwände hoch. Die akustische Bühne ist jetzt deutlich breiter, der Raum wird klanglich geflutet, auch bei seitlicher Sitzposition umhüllt die AS-425 max ihre Zuhörer. Chapeau, so erobert Nubert nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen seiner Kunden.
Preis
Die Nuboxx AS-425 max kostet 675 Euro. Da Nubert sämtliche Produkte nur im Direktvertrieb verkauft, kann man sich die Mühe sparen, im Internet nach einem Schnäppchen der Zwei-Wege-Aktivsoundbar zu suchen. Die 675 Euro sind damit weitgehend in Stein gemeißelt - außer zur Black Week, als die Nuboxx AS-425 max für knapp 500 Euro erhältlich war.
Fazit
Nuberts Nuboxx AS-425 max hebt den TV-Sound auf ein anderes Niveau! Volumen, Räumlichkeit, Bässe, Dynamik und Klarheit begeistern, so läuft jeder Flachbildfernseher akustisch zur Höchstform auf. Auch wenn das Bedienkonzept nicht optimal ist: egal! Die tonale Brillanz des Lautsprechers lässt dieses kleine Defizit verschmerzen.
Preis-Leistungs-Sieger
Klipsch Flexus Core 200
Dolby Atmos, kräftiger Bass ohne Subwoofer, einfache Einrichtung – das ist die Klipsch Flexus Core 200. Aber es gibt auch Nachteile.
VORTEILE
- Kräftiger Bass auch ohne Subwoofer
- Gute Sprachverständlichkeit bei Film und Fernsehen
- Einfache Einrichtung über HDMI-eARC
- Ausbau-Option mit Subwoofer und Rears
- App
NACHTEILE
- Kein WLAN, integriertes Streaming, Multiroom oder Sprachsteuerung
- wenig 3D-Klang
- enttäuschend bei Musik
Klipsch Flexus Core 200 im Test: 3.1.2-Soundbar mit viel Bass und Dolby Atmos
Dolby Atmos, kräftiger Bass ohne Subwoofer, einfache Einrichtung – das ist die Klipsch Flexus Core 200. Aber es gibt auch Nachteile.
Die Klipsch Flexus Core 200 ist die größere Soundbar der Flexus-Reihe. Sie arbeitet als 3.1.2-System mit Dolby Atmos und integriertem Subwoofer. Ein Netzwerkmodul fehlt, daher laufen App und Musikstreaming nicht über WLAN. Inhalte kommen stattdessen hauptsächlich über den Fernseher, über Zuspieler am Fernseher oder per Bluetooth zur Soundbar. Das macht die Bedienung einfach, schränkt aber Nutzungsumfang und Komfort ein. Wir haben im Test überprüft, für wen sich die Soundbar lohnt.
Mit insgesamt neun Lautsprechern bietet die Soundbar Klipsch Flexus Core 200 eine Leistung von 185 Watt. Klipsch
Design und Verarbeitung
Die Klipsch-Soundbar ist knapp 112 cm breit, 7,8 cm hoch und fast 13 cm tief. Mit 8,5 kg ist sie für eine Einzel-Soundbar recht schwer und wirkt stabil. Das deutet auf ordentliche Bassreserven hin. Das Format passt gut zu großen Fernsehern, kann aber bei kleinen TVs das Bild unten leicht verdecken. Die Optik ist zurückhaltend und vor allem auf Funktion ausgelegt. Das kantige Design wirkt eigenständig. Oben sitzen seitliche Metallgitter, in der Mitte eine Abdeckung in dunkler Holzoptik. Vorn und an den Seiten nutzt Klipsch Stoff. Das Metalllogo ragt vorne rechts sichtbar in die Front – außergewöhnlich.
Tasten auf der Oberseite ermöglichen eine Grundbedienung ohne App, ein Display gibt es leider nicht. Die Verarbeitung ist solide, die ganze Soundbar wirkt hochwertig. Die beiliegende Fernbedienung besteht zwar nur aus Kunststoff, liegt mit ihren deutlichen Rundungen aber gut in der Hand und wirkt nicht billig.
Bilder: Klipsch Flexus Core 200
Anschlüsse und Ausstattung
Für den Fernseher ist ein HDMI-Anschluss mit eARC vorgesehen. HDMI-Eingänge für Zuspieler gibt es nicht – Spielkonsole, Streaming-Box oder Blu-ray-Player müssen daher direkt an den Fernseher gehängt werden. Zusätzlich sind ein optischer Digitaleingang und ein Sub-Out für einen frei wählbaren externen Subwoofer vorhanden. Der ebenfalls vorhandene USB-C-Anschluss ist im Alltag hingegen nicht nutzbar, er dürfte für Service-Aufgaben reserviert sein.
Für kabellose Verbindungsaufnahme gibt es nur Bluetooth. WLAN, Air Play, Chromecast, Spotify Connect und Multiroom-Funktionen sind nicht Teil der Ausstattung. Gleiches gilt für Sprachsteuerung, eine entsprechende Funktion ist ebenfalls nicht integriert. Zu den nutzbaren Tonformaten gehören Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround und Dolby Digital Plus. DTS:X wird hingegen nicht unterstützt. 9 Treiber baut Klipsch in den Klangriegel mit einer Gesamtleistung von 185 Watt ein: 2 × Tieftöner mit je 4 Zoll, 2 × Höhenlautsprecher mit je 2,25 Zoll, 2 Lautsprecher für die Kanäle links und rechts mit je 2,25 Zoll und ein Center, bestehend aus 2 × 2,25 Zoll für Mitten und einem Hochtöner mit 0,75 Zoll. Mit diesem Set-up soll die Flexus Core 200 einen Frequenzbereich von 43 Hz bis 20 kHz spielen.
Dolby Atmos, kräftiger Bass ohne Subwoofer, einfache Einrichtung – das ist die Klipsch Flexus Core 200. heise bestenlisten
Aufbau, Inbetriebnahme und Steuerung im Alltag
Die Einrichtung ist grundsätzlich einfach. HDMI-eARC verbinden, Strom anschließen, fertig. Weil kein WLAN genutzt wird, entfällt die Netzwerkkonfiguration. Eine App gibt es trotzdem. Die Klipsch Connect Plus-App verbindet sich per Bluetooth mit der Soundbar und ermöglicht Zugriff auf Funktionen wie Klangmodi, Pegel, Dialog-Anhebung sowie einen einfachen Equalizer.
Die Klipsch Connect Plus-App verbindet sich per Bluetooth mit der Soundbar und ermöglicht Zugriff auf Funktionen wie Klangmodi, Pegel, Dialog-Anhebung sowie einen einfachen Equalizer. heise bestenlisten
Klangqualität
Bei Film und Fernsehen fällt als Erstes der kräftige Bass auf. Als Standalone-Soundbar liefert die Core 200 für diese Klasse spürbaren Tiefgang und Druck. Im Test zeigt sich, dass die Soundbar nicht nur wie vom Hersteller versprochen bis 43 Hz, sondern tatsächlich sogar bis rund 37 Hz runterspielt – enorm! Dank leichter Überhöhungen bei etwa 50 und 40 Hz erweckt das in den meisten Fällen den Eindruck, dass ein separater Subwoofer nicht zwingend nötig ist. Da aber der „Punch“ unter 50 Hz deutlich nachlässt, empfiehlt sich ein Sub spätestens bei Musikrichtungen wie Hip-Hop oder für intensiven Filmgenuss. Das gibt bei sehr tiefen Effekten und hoher Lautstärke noch einmal deutlich mehr Fundament.
Dialoge werden klar und gut verständlich wiedergegeben. Ein Dialogmodus ist vorhanden, muss aber nicht dauerhaft aktiv sein, weil Stimmen auch so bereits klar und sogar etwas spitz durchkommen. Der Dolby-Atmos-Effekt ist hörbar, aber leider nicht sehr stark ausgeprägt. Eine Anpassung an den Aufstellraum ist mangels automatischer Einmessung bedauerlicherweise nicht möglich. So werden Höheninformationen wie Regen, Hall oder generelle Geräusche von oben zwar dank passender Reflexion durchaus angedeutet, allerdings bleibt der 3D-Eindruck ohne zusätzliche Rear-Lautsprecher eingeschränkt. Außerdem muss der Raum passen, andere Konkurrenzprodukte wie Sennheiser Ambeo Soundbar Plus oder Bose Smart Ultra Soundbar sind hier deutlich flexibler.
Bei Musik waren wir enttäuscht, schließlich gilt Klipsch als Audiospezialist. Während die Soundbar in Tests oft als dynamisch und kräftig beschrieben wird, empfanden wir die Flexus Core 200 hier als eher flach und wenig dynamisch. Das mag für Stile wie Pop und Elektro noch passen, weil Kickbass und Grundton voll und ausreichend deutlich klingen. Zudem bleibt die Soundbar auch bei höherer Lautstärke stabil. Bei komplexer Musik wirkt die Abstimmung hingegen weniger ausgewogen. Begriffe wie „fein“ oder „differenziert“ finden wir hier eher unpassend – schade.
Preis
Die UVP in Deutschland liegt für die Klipsch Flexus Core 200 bei 499 Euro. Der aktuelle Straßenpreis laut Geizhals.de (Deutschland) liegt bei rund 411 Euro (Stand: 3/2026). Wer die Soundbar mit einem Sub erweitern möchte, zahlt zusätzlich für den 10-Zoll Sub 100 249 Euro und für das 12-Zoll-Modell Sub 200 449 Euro. Für ein Paar Surround-Lautsprecher fallen weitere 250 Euro (Surr 100) oder 400 Euro (Surr 200) an.
Fazit
Die Klipsch Flexus Core 200 ist eine Soundbar mit Fokus auf kräftigen Heimkinoklang und guter Sprachverständlichkeit. Sie richtet sich an Nutzer, die es möglichst einfach und überschaubar haben wollen. Ein Subwoofer ist dabei dank kräftigem Bass nicht zwingend nötig. Schwächen gibt es hingegen beim Komfort. Ohne WLAN fehlen integriertes Streaming, Multiroom und Sprachsteuerung. Surround-Sound ist darüber hinaus wenig beeindruckend und auch bei Musik konnte uns die Flexus Core 200 nicht restlos überzeugen – das hätten wir von einem Audiospezialisten anders erwartet. Wer eine Soundbar primär für Film und Fernsehen sucht und später mit Subwoofer und Rear-Lautsprechern der Reihe nach erweitern möchte, bekommt unter den genannten Einschränkungen dennoch ein stimmiges Konzept.
Sonos Arc
Die Soundbar Sonos Arc ersetzt die bisherigen Playbar und Playbase. Ihr Klang ist Oberklasse. Aber lohnt sich der teure Umstieg für Sonos-Nutzer? Wir haben sie getestet.
VORTEILE
- unkomprimiertes Dolby Atmos
- insgesamt hervorragender Klang
NACHTEILE
- teuer
Soundbar Sonos Arc im Test
Die Soundbar Sonos Arc ersetzt die bisherigen Playbar und Playbase. Ihr Klang ist Oberklasse. Aber lohnt sich der teure Umstieg für Sonos-Nutzer? Wir haben sie getestet.
Die Sonos Arc ist mit knapp 900 Euro das teuerste Gerät im großen Sonos-Portfolio. Sie soll in erster Linie den sonst meist flachen TV-Sound gehörig aufmotzen. Denn aktuelle Fernseher (Kaufberatung UHD-TVs: 4K-Fernseher für jeden Geldbeutel ) werden immer dünner. Hier ist schlicht kein physischer Platz für einen großen Klangteppich. Sonos-Kunden nutzten dafür in der Vergangenheit die Playbar, die Playbase oder die Sonos Beam – häufig mit zwei Play:1 (Testbericht) , One oder Symfonisk als Satellitenlautsprecher für 5.0- und einem Sub für 5.1-Sound. Die Playbar und Playbase verschwinden mit dem Erscheinen der Arc aus dem Portfolio, die mit unter 400 Euro vergleichsweise günstige Sonos Beam bleibt im Programm.
Das Besondere an der Arc: Sie ist der erste Lautsprecher von Sonos mit unkomprimierter Dolby-Atmos-Unterstützung. Dafür hat Sonos den mit 114 Zentimetern sehr langen Sound-Riegel bis oben hin mit Technik vollgestopft. In ihm stecken elf digitale Klasse-D-Verstärker für acht elliptische Tieftöner für mittlere Sprachfrequenzen und Bass und drei Kalottenhochtöner für hohe Frequenzen und Dialoge.
Musik
Sonos untermauert mit der Sonos Arc den Ruf, in seinem Preissegment Premium-Sound zu liefern. Im Klangtest als Stereo-Anlage überzeugt sie uns auf voller Linie. Egal ob Classic-Rock, Minimal, Klassik, Reggae oder Hip-Hop – die Sonos Arc meistert den Genre-Mix mit Bravour. Die Höhen sind klar und jederzeit gut zu orten, die Mitten präsent und deutlich vom Rest differenzierbar und die Bässe sind auch ohne zusätzlichem Sonos Sub erstaunlich tief und mächtig. Komplizierte Songs mit vielen Instrumenten gleichzeitig plus Gesang löst die Sonos Arc sauber auf, zu einem Klangbrei kommt es quasi nie. Dabei klingt der nur wenig komprimierte Sound von Tidal am besten. Aber auch Songs von Spotify tönen aus der Arc so gut, dass man nur ungern wieder auf sein altes, weniger hochwertiges System zurückfallen mag.
Im direkten Vergleich mit der alten Sonos Playbar zieht diese deutlich den Kürzeren. Vor allem fällt auf, dass die Sonos Arc dank ihrer gerichteten Lautsprecher um den etwa drei Meter vor ihr sitzenden Hörer einen wahren Klangteppich ausbreitet. Sie klingt tatsächlich als würden mehrere meterweit entferne einzelne Boxen einen feinen, multidirektionalen Sound erzeugen. Die Playbar löst ebenfalls fein auf und bietet einen deutlichen Stereo-Effekt. Dieser ist aber bei weitem nicht so raumfüllend wie die von der Arc erzeugte Sound-Kulisse.
In Kombination mit einem Sonos Sub und zwei Play:1 als Satellitenboxen minimiert sich der Unterschied. Zwar hat hier noch immer die Sonos Arc die Nase vorne, was vor allem an den nach oben gerichteten Lautsprechern liegt, die so einen immersiveren Sound erzeugen. Insgesamt würde man bei diesen als Musikanlage genutzten Setup aber nicht davon ausgehen, dass sich die Investition von zusätzlichen 900 Euro, um die Playbar mit der Arc zu ersetzen, für jeden lohnt.
Fernsehen
Ihre volle Stärke soll die Arc in Verbindung mit einem Fernseher ausspielen, schließlich verspricht Sonos nicht nur Dolby Digital Plus, sondern eben auch die Wiedergabe von unkomprimiertem Dolby Atmos. Das Problem: Im Testumfeld nutzen wir ein etwas älteres TV-Gerät, welches lediglich eine HDMI-ARC-Schnittstelle, nicht aber die für unkomprimierten Atmos-Sound nötige HDMI 2.1 und den eARC-Standard (enhanced Audio Return Channel). Diese wurde erst 2017 verabschiedet, 2018 kamen die ersten Geräte. Wer ein neues TV-Gerät (Kaufberatung UHD-TVs: 4K-Fernseher für jeden Geldbeutel ) kauft und Wert auf unkomprimiertes Dolby Atmos (Dolby Atmos TrueHD) legt, sollte auf HDMI 2.1 und eARC achten. Komprimiertes Dolby Atmos gibt die Arc dank Dolby-Digital-Plus-Codec auch über einen normalen HDMI-ARC-Port wieder.
Auch mit einem externen Zuspieler wie einem Bluray-Player (Vergleichstest) , Apple TV (Testbericht), Amazon Fire TV Stick 4K (Testbericht) oder Amazon Fire TV Cube (Testbericht), die eigentlich unkomprimiertes Atmos unterstützen, lässt sich das Problem nicht umgehen. Denn die Arc hat nur eine HDMI-Schnittstelle, an der der Fernseher hängt. So müssen externe Zuspieler immer über das TV-Gerät gehen, um die Sonos Arc zu erreichen.
Immerhin bieten ältere Fernseher meist eine HDMI-ARC-Schnittstelle. Diese liefert über Dolby Digital Plus komprimiertes Dolby Atmos. Im Klangtest bietet auch dieser ein fantastisches Klangbild, welches den Zuschauer in den entsprechenden Filmpassagen wie eine Wolke umgibt. Gerade der Sound, der gefühlt von oben kommt, erweitert das Hörerlebnis deutlich. Von Kinoqualität zu sprechen wäre übertrieben, aber der Sonos Arc geht einen deutlichen Schritt in diese Richtung.
Der direkte Vergleich mit der Playbar liefert als TV-Wiedergabegerät ein ähnliches Ergebnis wie als reiner Musik-Player: Einzeln ist die Arc der Playbar deutlich überlegen. In Kombination mit einem Sonos Sub und zwei Play:1 schmilzt dieser Vorsprung so weit, dass sich ein Wechsel von der Playbar auf die Arc für die meisten nicht lohnt. Hat man ein HDMI-2.1-fähiges TV-Gerät und das entsprechende Dolby-Atmos-Tonmaterial, könnte sich die Arc dagegen absetzen.
Trueplay, Assistenten & Airplay 2
Die Arc unterstützt die von anderen Sonos-Geräten bekannte Autotuning-Funktion, um den Lautsprecher klanglich in seine Umgebung einzufügen. Allerdings benötigen Käufer zum Einrichten ein iPhone oder iPad. Android unterstützt Sonos dafür nicht. Vollautomatisches Autotuning ohne externe Geräte wie bei der Sonos Move (Testbericht) kennt die Arc nicht. Laut Sonos sei diese nicht so präzise wie die Lösung mit iPhone und iPad.
Über die App kann der Nutzer der Arc entweder Amazon Alexa oder den Google Assistant zuweisen. Die vier eingebauten Fernfeldmikrofone hören dabei aufmerksam in den Raum, Sprachbefehle erkennt sie zuverlässig. Spielt sie jedoch laut Musik, muss man schon ordentlich dagegen anbrüllen.
Sonos S2
Die Arc ist das erste Sonos-Produkt, welches nicht mehr mit einigen älteren Geräten des Herstellers zusammenarbeitet. Zu den nicht mehr unterstützten Geräten gehört die Sonos Bridge, der Connect (1. Gen), der Connect Amp (1. Gen) und die Play:5 (1. Gen). Auch lässt sie sich nur mit der neuen Sonos-S2-App verknüpfen. Wer bereit ein bestehendes Sonos-System nutzt, muss dafür zuvor seine alten, kompatiblem Sonos-Geräte auf die neue App umziehen.
Wer die alte App kennt, fühlt sich in der neuen sofort gut aufgehoben. Es gibt frische Animationen und das Design hat sich etwas verändert. Grundsätzliche Funktionen sind jedoch genau dort zu finden, wo man sie auch in der alten App fand. Neu: Die App gruppiert auf Wunsch verschiedene Räume, um zum Beispiel Schlafzimmer und Bad beim Aufstehen gleichzeitig zu starten.
Preis
Für seinen Premium-Sound verlangt Sonos auch einen Premium-Preis: Knapp 900 Euro kostet die Sonos Arc bei seiner Einführung. Inzwischen ist sie ab 600 Euro erhältlich.
Wer nach einer günstigeren Möglichkeit sucht, Surround-Klang von Sonos zu erhalten, kann zum Beispiel zur Sonos Beam für 400 Euro greifen und sie entweder mit zwei Play:1 für zusammen etwa 350 Euro oder zwei Ikea Symfonisk für zusammen 200 Euro erweitern.
Fazit
Wer den entsprechenden Fernseher und das nötige Kleingeld besitzt, erhält mit der Sonos Arc eine fantastische Soundbar. Ein Umstieg von der Playbar kann sich für alle lohnen, welche dir Playbar bisher einzeln nutzten. Wer sie im Verbund mit zwei Play:1 (Testbericht) , One oder Symfonisk und einem Sonos Sub nutzt, für den lohnt sich der Wechsel jedoch nicht unbedingt.
Weitere Informationen:
Nubert Nupro AS-2500
Die AS-2500 von Nubert ist flach und liefert saubere Stereo-Abstimmung für TV und Musik. Was sie sonst noch kann, zeigt der Test.
VORTEILE
- flach und optisch zurückhaltend
- HDMI eARC mit CEC, dazu optisch, koaxial und analog Cinch
- Subwoofer-Ausgang, optional auch Funklösung im Nubert System
- überzeugende Stereo-Abstimmung für TV und Musik
- klarer Sound mit ordentlich Bass
NACHTEILE
- Keine App, keine automatische Raumeinmessung
- Kein echtes Surround, keine Dolby Atmos oder DTS:X Decoder
- Tiefbass und Maximalpegel bauartbedingt begrenzt
Nubert Nupro AS-2500 im Test: Soundbar mit Fokus auf klaren Sound und TV
Die AS-2500 von Nubert ist flach und liefert saubere Stereo-Abstimmung für TV und Musik. Was sie sonst noch kann, zeigt der Test.
Die Nupro AS-2500 ist Nuberts kompakte Antwort auf die oft tiefen Sounddecks der Marke. Sie ist zwar 105 cm breit, aber „nur“ rund 14 cm tief und passt damit auch vor den Fernseher statt nur darunter. Im Kern steht Stereo-Klang mit 3-Wege-Aufbau und vergleichsweise vielen Eingängen. Auf Netzwerk-Streaming und App-Steuerung wird bewusst verzichtet, leider aber auch auf echten Surroundsound. Wir verraten im Test, für wen sich die schicke Soundbar trotzdem lohnt.
Design und Verarbeitung
Das Gehäuse ist sauber verarbeitet und besteht aus MDF mit matter Oberfläche. Es gibt die Bar in Schwarz oder Weiß, die abnehmbare Frontblende mit Akustikstoff ist hingegen immer schwarz. Mit 7,3 cm Bauhöhe bleibt sie flach, mit Füßen sind es rund 8,1 cm. Das Gewicht liegt laut Datenblatt bei 8,1 kg und verspricht ordentlich Leistung. Die Blende ist abnehmbar und versteckt das mittig auf der Front platzierte Wählrad mit Druckfunktion für Einstellungen direkt am Gerät. Eine klassische Anzeige gibt es nicht, stattdessen dient ein LED-Ring als Statusanzeige, der auch sichtbar ist, wenn die Frontblende am Gerät verbleibt. Zur Wandmontage sind Halterungen am Gehäuse vorgesehen.
Anschlüsse und Ausstattung
Für den TV-Anschluss steht HDMI-eARC bereit, inklusive CEC-Funktion, sodass die Lautstärke bequem über die TV-Fernbedienung geregelt werden kann. Die hochwertige Fernbedienung der Soundbar, die aus Metall gefertigt ist, ermöglicht eine präzise Feinanpassung des Klangriegels. Neben dem einen HDMI-Eingang stehen ein optischer Digitaleingang, ein koaxialer Digitaleingang und ein analoger Cinch-Eingang zur Verfügung. Ebenfalls vorhanden ist ein Subwoofer-Ausgang für kabelgebundene Subwoofer, und optional lässt sich ein Funkmodul von Nubert für kabellose Lösungen nachrüsten. Für kabellose Audiowiedergabe sorgt Bluetooth 5.0 mit Unterstützung für SBC, AAC, aptX, aptX HD und aptX Low Latency. Der USB-Anschluss dient laut Datenblatt lediglich der Stromversorgung mit 5 V und 1,5 A und dürfte zudem für Servicezwecke vorgesehen sein. Dekodiert werden PCM, Dolby Digital und DTS, während hochauflösende Formate wie Dolby TrueHD, DTS HD, Dolby Atmos und DTS:X nicht unterstützt werden.
Bilder: Nubert Nupro AS-2500
Aufbau, Inbetriebnahme und Steuerung im Alltag
Die Inbetriebnahme der Nubert Nupro AS-2500 gestaltet sich denkbar einfach: Stromkabel anschließen, Eingang wählen, fertig. Positiv hervorzuheben ist der Lieferumfang, der neben HDMI- und optischem Kabel auch passende Adapter enthält. Da keine App zur Verfügung steht, bleibt der Funktionsumfang jedoch eingeschränkt – eine automatische Raumeinmessung sucht man ebenso vergeblich.
Zur Steuerung dient ein zentrales, drückbares Drehrad, das von einem mehrfarbigen LED-Ring umgeben ist. Dieser visualisiert verschiedene Klangoptionen, was anfangs jedoch eher verwirrend wirkt. Im Vergleich zu einem klar strukturierten Display erscheint diese Lösung auf Dauer unnötig kompliziert – auch wenn man sich nach einer gewissen Eingewöhnungszeit halbwegs zurechtfindet.
Als reine Stereo-Soundbar verfügt die AS-2500 über eine vergleichsweise kompakte Treiberbestückung: Zwei 25-mm-Kalottenhochtöner, zwei 66-mm-Mitteltöner und zwei nach unten abstrahlende 90-mm-Langhub-Tieftöner sorgen für den Klang. Eine Ein- und Ausschalt-Automatik ist vorhanden, allerdings lässt sich die Soundbar nicht automatisch über Bluetooth aktivieren.
Klangqualität
Die Nupro AS-2500 ist klanglich als reine Stereo-Soundbar ausgelegt und überzeugt mit einer sauberen tonalen Balance sowie ordentlicher Detailauflösung – insbesondere bei TV-Ton und Musik in normaler Lautstärke. Angesichts der kompakten Bauweise fällt der Bass durchaus präsent und kräftig aus, stößt bei tiefen Frequenzen unter 50 Hz jedoch erwartungsgemäß an Grenzen. Dank des Subwoofer-Ausgangs lässt sich das System problemlos erweitern – und das herstellerunabhängig.
Für bessere Sprachverständlichkeit sorgt die Funktion „Voice+“, die Dialoge anhebt. Die Verständlichkeit ist dadurch insgesamt ordentlich, fällt aber je nach Zuspielmaterial unterschiedlich aus. Teilweise verändert sich der Klang der Stimmen merklich, sodass gelegentliches Nachjustieren nötig wird. Das machen andere Hersteller besser.
Eine DSP-gestützte Klangfeldverbreiterung soll für mehr Räumlichkeit sorgen. Der Effekt ist durchaus hörbar, jedoch stark sitzplatzabhängig und geht nicht selten zulasten der klanglichen Präzision. Statt echtem Surroundsound wird primär die Bühne verbreitert – echte Mehrkanal- oder 3D-Tonformate mit Höhenkanälen werden nicht unterstützt. Entsprechende Signale werden auf Stereo heruntergemischt. Auch in dieser Disziplin bieten Konkurrenzmodelle teils deutlich mehr.
Preis
Die UVP der Nubert Nupro AS-2500 liegt in Deutschland bei 495 Euro. Der Straßenpreis lag zum Testzeitpunkt laut Geizhals.de mit 502 Euro sogar leicht darüber (Stand: 02/2026).
Fazit
Die Nupro AS-2500 ist eine schlanke und optisch zurückhaltende TV-Soundbar mit Schwerpunkt auf sauberem Stereo-Klang und einfacher Bedienung. Klarheit und Bass sind ordentlich – letzterem setzt nur die Bauform Grenzen, die sich aber mit einem Subwoofer sinnvoll erweitern lassen. Sie ist interessant für alle, die neben HDMI-eARC nur einige klassische Digitaleingänge und Bluetooth, aber kein Netzwerk-Streaming benötigen. Außerdem darf Surroundsound nicht im Lastenheft stehen. Denn keine App bedeutet keine Einmessung und zusammen mit der begrenzten Treiber-Anzahl gibt es auch keinen echten Surroundsound.
Sharp HT-SB700
Wer günstig und einfach den Klang des Fernsehers aufpeppen will, benötigt eine Soundbar. Die HT-SB700 von Sharp kommt mit einem kraftvollen Klang, einem schicken Design und sogar Dolby Atmos. Wo die Schwächen liegen, zeigt der Test.
VORTEILE
- insgesamt solider Klang
- schickes Design und gute Verarbeitung
- preiswert
- Support für Dolby Atmos & Bluetooth
NACHTEILE
- Bass und Detailliertheit im Klang fehlen
- Ausstattung mit Anschlüssen sehr spärlich
- keine Möglichkeit, einen Subwoofer anzuschließen
Sharp HT-SB700 im Test
Wer günstig und einfach den Klang des Fernsehers aufpeppen will, benötigt eine Soundbar. Die HT-SB700 von Sharp kommt mit einem kraftvollen Klang, einem schicken Design und sogar Dolby Atmos. Wo die Schwächen liegen, zeigt der Test.
Bei wem schon ein günstigerer Fernseher im Wohnzimmer stand, der weiß, wie miserabel die Klangqualität mancher in solchen Geräten verbauten Lautsprecher sein kann. Viele Menschen suchen deshalb in anderen Sound-Lösungen Abhilfe. Eine beliebte Möglichkeit, den Klang seines Fernsehers aufzupeppen, ist eine Soundbar. Und bei wem ein günstigerer Fernseher im Wohnzimmer steht, der wird selten mehr als den Kaufpreis des Fernsehers für eine Soundbar ausgeben wollen. Dann kommen günstigere Modelle wie die Sharp HT-SB700 ins Spiel.
Für gerade mal 170 Euro gibt es hier eine kompakte 2.0.2-Mini-Soundbar mit insgesamt vier Vollbereich-Stereolautsprechern. Zu den Top-Features gehört unter anderem die Unterstützung für Dolby Atmos. Doch kann eine Soundbar um diesen Preis wirklich gut klingen? Das zeigt unser Test.
Design & Verarbeitung
Sharp nutzte beim Entwickeln der HT-SB700 den bei einfachen Geräten wie Soundbars ohnehin kaum vorhandenen Spielraum für abgefahrene Designs offensichtlich nicht. Denn die schwarze Soundbar ist schlicht und elegant gehalten wie eh und je. Die Soundtechnik ist in ein gerade mal 1,9 kg schweres Kunststoffgehäuse verpackt.
Die Front besteht aus einem Akustikgitter aus Metall, dahinter sind weiße LEDs versteckt, die bei der Bedienung helfen und zudem die aktuelle Soundquelle anzeigen. Der Hersteller fand dort wohl keinen Platz, um sein Logo zu platzieren und überließ jegliche Bedruckung der Oberseite des Geräts. Dort finden wir neben einem Logo und der Modellbezeichnung auch Hinweise auf die verschiedenen Eingangsquellen sowie auf die unterstützte Dolby-Atmos-Technologie.
In der Mitte sind fünf Knöpfe platziert, mit denen die Soundbar eingeschaltet, der Eingang und die Lautstärke angepasst sowie der Bluetooth-Kopplungsmodus aktiviert werden kann. Die Soundbar ist 64 cm breit, 11 cm hoch und 16 cm tief und passt mit diesen sehr kompakten Abmessungen problemlos unter jeden Fernseher, ohne Infrarotlicht-Sensoren zu verdecken.
Ausstattung, Anschlüsse & Bedienung
An Schnittstellen mangelt es bei der Sharp HT-SB700 leider ein wenig. So verbaut der Hersteller nur einen digitalen optischen Eingang, einen HDMI 2.1-Port mit ARC-Support und einen 3,5-mm-Audioeingang. Der Schein, auch über den verbauten USB-A-Anschluss auf der Rückseite Sound abspielen zu können, trügt – es handelt sich um einen Service-Port, falls die Soundbar mal vom Hersteller repariert werden muss. Dazu kommt die Wiedergabemöglichkeit über Bluetooth 5.3. Ein weiterer HDMI-Port wäre hier für den Preis wahrscheinlich noch drin gewesen und würde vielen Nutzern ein wenig Kopfschmerzen ersparen. WLAN beherrscht die Soundbar ebenfalls nicht, sodass man nicht etwa über Google Chromecast Musik auf dem Gerät abspielen kann.
Die Bedienung der Soundbar muss nicht zwingend über die Knöpfe auf der Oberseite erfolgen, sondern gelingt auch über die recht knopfreiche Fernbedienung. Damit kann man natürlich Lautstärke und Wiedergabe steuern, aber auch den 3D-Surround-Modus (mehr dazu gleich) aktivieren und deaktivieren sowie verschiedene EQ-Profile auswählen. Zur Auswahl stehen Movie, Music, Voice und Night. Auch die direkte Steuerung von Bass und Treble ist mit der Fernbedienung möglich. Auf einen Bildschirm verzichtet die Soundbar preisgemäß, sodass sich insbesondere die aktuelle Lautstärke nur über die LEDs auf der Vorderseite einsehen lässt. Eingerichtet wird das Gerät einfach, indem es an die Stromversorgung angeschlossen und der Fernseher über einen der Eingänge oder über Bluetooth verbunden wird. Das ist kinderleicht!
Klangeigenschaften
Wie immer bei der Bewertung von Klangeigenschaften, gilt es auch hier anzumerken: Nur ein bestimmter Teil dieser Bewertung kann objektiv sein. Vieles bestimmen auch andere Faktoren wie die Vorlieben des Benutzers, die Beschaffenheit und Größe des Raumes, in dem getestet wurde, die genauen Einstellungen und vieles mehr. Wir haben die Sharp HT-SB700 in einem mittelgroßen Raum getestet und sind bei den von Werk aus bestimmten Klangeinstellungen geblieben.
Vorneweg: Die HT-SB700 klingt keinesfalls schlecht. Grundsätzlich muss man aber zwischen zwei großen Anwendungsszenarien unterscheiden – der Musikwiedergabe und der Wiedergabe von Filmen, Serien, Shows und anderen Sendungen. Die Stärke dieses Geräts liegt wenig überraschend in der letzteren Anwendungsmöglichkeit. Bei der Musikwiedergabe stellt man schnell fest, dass die HT-SB700 sehr, sehr laut werden kann. Im oberen Lautstärkenbereich wird der Ton wie bei vielen anderen günstigeren Audio-Geräten stark verzerrt, sodass wir zumeist im Bereich von 60 bis 80 Prozent probegehört haben. Und dort haben wir etwas weniger bekommen als das, was der Preis von 200 Euro versprechen kann. Der Sound lässt sich insgesamt als etwas unklar und leicht blechern, aber dennoch souverän und schon allein aufgrund seiner Raumstärke als raumfüllend beschreiben. Der Fokus liegt klar auf den Mitten, worunter die Höhen und vor allem der Bass leidet. Letzterer ist hier nur in einem geringen Umfang enthalten.
Das größte Problem hat die HT-SB700 damit, die Klangbühne von Titeln mit vielen verschiedenen Instrumenten korrekt darzustellen. Hier hört sich alles „durcheinander“ an – die Soundbar schafft es kaum, die einzelnen Instrumente voneinander zu trennen, sodass insbesondere bei vollgepackten Instrumental-Segmenten die lautesten Geräuschquellen zu sehr in den Vordergrund dringen und die leiseren Details verschwinden. Gesangsstimmen gehören leider meist, aber nicht immer zu den Details, die verschwinden und so kann aus vielen Songs ein leicht blechern und ohrenbetäubend klingender Einheitsbrei werden; von der Ungenießbarkeit ist man hier trotzdem weit entfernt. Dieses konkrete Problem kann weitgehend behoben werden, indem man den 3D-Surround-Modus deaktiviert. Dann klingt alles fokussierter, klarer und freundlicher, aber ein großer Teil der Fülle und Breite des Klangs verschwindet. Ein Dilemma.
Bei der Wiedergabe von Filmen, Serien und Co. sieht es abermals ein wenig anders aus. Dort legt man ohnehin nicht den größten Wert auf eine akkurate Darstellung der Klangbühne oder einen warmen, freundlichen Klang. Besonders im Modus „Movie“ ist es hier möglich, gute Ergebnisse zu erzielen, und mit Dolby-Atmos-Titeln ohnehin. Am besten schneidet die Soundbar in Talkshows, Nachrichtensendungen und anderen Formaten ohne vollgepackte Geräuschkulisse ab. Ein Tipp: Sollte der Dialog beispielsweise bei einer Actionfilm-Szene zu unverständlich sein, lohnt sich ein Klick auf die „Voice“-Taste auf der Fernbedienung.
Sharp HT-SB700 - Bilderstrecke
Technische Daten
In der Sharp HT-SB700 arbeiten insgesamt vier Vollbereichslautsprecher. Zwei davon sind in einer Stereo-Konfiguration hinter dem Frontgitter versteckt, die anderen beiden befinden sich links und rechts auf der Oberseite des Geräts und strahlen nach oben ab. Die Treibergröße der verbauten Lautsprecher konnten wir leider weder über die Spezifikationstabelle in der Bedienungsanleitung noch auf Sharps Website herausfinden. Der Lautsprecher unterstützt die Soundformate Dolby Digital, DTS und Dolby Atmos. Die maximale Abtastfrequenz bei Bluetooth-Übertragungen beträgt 48 kHz.
Preis
Die Sharp HT-SB700 ist bei vielen Elektrofachmärkten und anderen Drittanbietern ab 170 Euro erhältlich.
Fazit
Was erwartet man von einer Soundbar, die unter 200 Euro kostet? Das hängt ganz davon ab, ob man schon einmal in seinem Leben den Klang einer hochwertigen Audio-Anlage erlebt hat. Bei wem das bisher nicht der Fall war, der wird die Sharp HT-SB700 als großartiges Upgrade zum oftmals schlechten Klang des eigenen Fernsehers sehen. Dafür handelt es sich bei diesem Gerät ohnehin primär für budgetorientierte Kunden um eine exzellente Wahl. Wer allerdings nach einer Klangqualität sucht, die einen vom Hocker haut, wird mehr Geld in die Hand nehmen müssen.
JBL Bar 5.0 Multibeam
JBL Bar 5.0 Multibeam
Die JBL Bar 5.0 Multibeam Soundbar ist eine kompakte Soundbar, die dank Dolby Atmos aber auch ohne Subwoofer Kino-Feeling nach Hause bringen. Ob das gelingt, zeigt der Test.
VORTEILE
- klare Dialoge
- kompakt und schick
- ordentlicher Sound bei moderater Lautstärke
- automatisches Einmessen
- viele Streaming-Optionen
NACHTEILE
- etwas wenig Bass
- nicht sehr pegelfest
- wenig Sound-Einstellungen
JBL Bar 5.0 Multibeam im Test
Die JBL Bar 5.0 Multibeam Soundbar ist eine kompakte Soundbar, die dank Dolby Atmos aber auch ohne Subwoofer Kino-Feeling nach Hause bringen. Ob das gelingt, zeigt der Test.
Guter Klang hängt bei Lautsprechern jedweder Art nicht nur, aber auch am verfügbaren Platz. Denn physikalisch ist ein gewisses Mindestvolumen solcher Speaker nötig, um ordentlichen Sound produzieren zu können. Das gilt entsprechend auch für Soundbars, die bauartbedingt möglichst flach und schlank sein müssen. Gerade Soundbars ohne Subwoofer machen es für Hersteller schwer, dennoch preisen sie normalerweise auch solche Produkte mit Marketing-wirksamen Begriffen an. Auch JBL ist bei seiner Bar 5.0 Multibeam vom eigenen Produkt überzeugt und verspricht, Kinosound in das Wohnzimmer zu bringen. Das Zauberwort ist hier Dolby Atmos – aber hält die Soundbar, was der Hersteller verspricht?
Design und Verarbeitung
Die JBL Bar 5.0 Multibeam bringt das typisch dezente, hochwertige und moderne JBL-Design in mattschwarzer Farbe mit. Die Soundbar ist mit 709 mm Breite, 58 mm Höhe und 101 mm Tiefe kompakt und eher unscheinbar. Mit einem Gesamtgewicht von 2,8 kg ist sie dazu auch noch eher handlich. Die Ecken und Kanten der Soundbar sind abgerundet und lassen sich dadurch angenehm anfassen. Das ist schick und praktisch.
Beim Material der Soundbar greift JBL zum Großteil aus Kunststoff zurück. Nur vorn ist ein feines Metallgitter verarbeitet, hinter dem die Lautsprecher platziert sind. Durch die kompakte Größe der Soundbar findet sie problemlos auf einem Schrank unter dem Fernseher Platz. Alternativ ist es möglich, die Soundbar mit dem im Lieferumfang enthaltenen Montagematerial an der Wand zu befestigen. Auf der Oberseite der Soundbar ist eine gummierte Tastenleiste verbaut. Hier befinden sich die Drücker On/Off, Lautstärke +/- sowie die Taste zur Auswahl des Eingangs. In der Mitte der Tastenleiste ist außerdem ein Mikrofon für die Audiokalibrierung (Automatische Multibeam-Kalibrierung, kurz AMC) zu finden. Beim Drücken einer Taste wird ein kleines Display hinter dem Metallgitter sichtbar. Unter der Soundbar sind dezente, flache Gummifüße angebracht, um die Oberfläche des Schranks zu schützen.
Alle Bilder zur JBL Bar 5.0 Multibeam im Test
Ausstattung
Wie schon der Name JBL Bar 5.0 Multibeam verrät, wird der Sound auf fünf Kanälen ausgespielt. Das geschieht mit insgesamt fünf 4,8 × 8 Zentimeter großen Treibern, wovon einer je rechts und links an der Seite der Soundbar platziert ist und drei an der Front. Echte Höhenlautsprecher gibt es nicht. Jeder Treiber wird mit 50 W angetrieben, somit hat die Soundbar eine Gesamtleistung von maximal 250 W. Jeweils zwei oben und unten eingebaute 75-mm-Passivmembranen sollen für tiefe Töne sorgen, die JBL Bar 5.0 Multibeam kommt ohne Subwoofer. Auch eine nachträgliche Erweiterung zur Surround-Anlage ist leider nicht möglich, dazu später mehr.
Die Lautsprecher unterstützen die Klangformate Dolby Atmos und Multibeam. Auf der Rückseite der Soundbar ist ein HDMI-Eingang sowie ein HDMI-Ausgang zu finden. Hier ist es möglich, die Soundbar als zentrale Schnittstelle für eine Spielekonsole oder einen Mediaplayer zu nutzen, sofern der Fernseher dies nicht bietet. Des Weiteren gibt es einen Optical-, Ethernet-, sowie einen USB-C-Port. Zudem besitzt die JBL Bar 5.0 Multibeam Bluetooth und WLAN. Auch für die Nutzung von Airplay 2, Chromecast und Alexa ist gesorgt.
Steuerung und Sound im Alltag
Die JBL Bar 5.0 Multibeam bietet verschiedene Möglichkeiten der Steuerung. Über die Fernbedienung können Lautstärke und Klangmodus verändert werden. Außerdem ist die Wiedergabequelle über die TV-, Bluetooth- oder HDMI-Taste wählbar. Durch längeres Drücken (länger als 5 Sekunden) der HDMI-Taste wird die Soundbar automatisch kalibriert und somit an den Raum angepasst. Bei der Kalibrierung werden Testtöne von der Soundbar abgegeben und über das Mikrofon auf der Tastenleiste aufgefangen. Dadurch soll der Surround-Sound optimal auf den Raum angepasst werden. Achtung: Die dabei ausgegebenen Töne sind laut!
Wer über HDMI-ARC (Audio Return Channel) am Fernseher verfügt, kann einfach mit der Fernbedienung des Fernsehers die Lautstärke der JBL Bar 5.0 Multibeam steuern. So wird im Alltag weiterhin nur eine Fernbedienung benötigt. Das kleine Display (ca. 2 × 4 cm) mit maximal fünf Zeichen hinter dem Metallgitter an der Front der Soundbar soll mithilfe einer Laufschrift die Bedienung erleichtern. Das funktioniert sehr gut, denn die Schrift ist gut lesbar dargestellt. Einen eigenen Sprachassistenten hat die JBL Bar 5.0 Multibeam nicht, aber es werden die gängigen Sprachassistenten wie Alexa, Google Assistant und Siri unterstützt. Wer Presets oder einen EQ zur Verbesserung der Klangqualität sucht, wird leider enttäuscht. Auch in der Setup-App „JBL Bar“ steht kein EQ zur Verfügung.
Den Bass stellt man lediglich über die Fernbedienung ein – und das recht umständlich. Dafür wird die TV-Taste für 3 Sekunden gehalten und anschließend die Plus- oder Minus-Taste gedrückt. Der Bass wird in fünf verschiedenen Leveln angegeben. JBL gibt eine untere Frequenz von 50 Hz an. Im Basstest bei einer Lautstärke von 50 Prozent und einer Frequenz von 59 Hz ist eine leichte Überhöhung hörbar. Schluss nach unten ist tatsächlich sogar erst bei etwa 40 Hz, aber der Pegel ist unterhalb von rund 50 Hz zu vernachlässigen. Insgesamt ist das zu wenig, das fällt weniger im Basstest, sondern vielmehr im Alltag auf.
Bei Musik und Film lässt die Klangqualität gerade bei höherer Lautstärke nach, sodass der Sound dann dünner und undifferenziert wird. Hier macht sich außerdem der beschriebene fehlende Bassdruck bemerkbar. Beim Wechsel von Bluetooth auf HDMI fliegen uns zudem fast die Ohren weg, da der Lautstärkeunterschied riesengroß ist. Positiv: Die Sprache bei der JBL Bar 5.0 Mulitbeam wird deutlich und klar wiedergegeben. Durch das Zuschalten von Dolby Atmos an der Fernbedienung wird bei Film und Fernsehen die Atmosphäre deutlich verbessert, die Bühne wird spürbar breiter. Das wird besonders bei Filmen mit Dolby-Atmos-Unterstützung hörbar. Umschließenden 3D-Sound, der von allen Seiten oder gar noch aus verschiedenen Höhen den Hörer umschmeichelt, gibt es hier aber nicht.
Preis
JBL bietet die Soundbar JBL Bar 5.0 Multibeam zum Testzeitpunkt auf seiner Website für rund 400 Euro an. Derzeit ist das Modell aber vorübergehend vergriffen. Ein Ebay-Händler bietet die Soundbar derzeit für 300 Euro an.
Fazit
Die JBL Bar 5.0 Multibeam bietet schickes und modernes Design, das zudem durch ihre vergleichsweise kompakten Maße sicherlich in viele Wohnzimmer passt. Sie ist leicht anzuschließen und einzurichten. Dialoge und bei normaler Lautstärke die ganze Sound-Kulisse werden schön klar wiedergegeben, eine Bereicherung für den TV-Sound ist die JBL-Soundbar zweifelsfrei. An ihre Grenzen gelangt sie jedoch schnell, wenn man etwas genauer und lauter hört. Wer mehr will, muss tiefer in die Tasche greifen. Für knapp 130 Euro mehr bekommt man bereits unseren Testsieger der aktuellen Bestenliste.
Sonos Ray
Sonos Ray
Die dritte Sonos-Soundbar ist im Handel. Die Sonos Ray kostet knapp 300 Euro, verzichtet auf einen HDMI-Anschluss und setzt dafür auf eine optische Audio-Übertragung. Wie gut ist die neue Soundbar?
VORTEILE
- Top-Klang bei Musik
- einfache Einrichtung
- optischer TV-Anschluss funktioniert einfach
- zahlreiche kompatible Lautsprecher
NACHTEILE
- Bass ohne Sub etwas schwach
- keine automatisches Klangeinmessung
- keine Steuerung mit Bluetooth-Fernbedienungen
- kein Dolby Atmos
Sonos Ray im Test
Die dritte Sonos-Soundbar ist im Handel. Die Sonos Ray kostet knapp 300 Euro, verzichtet auf einen HDMI-Anschluss und setzt dafür auf eine optische Audio-Übertragung. Wie gut ist die neue Soundbar?
Sonos liefert eine dritte Soundbar, die Sonos Ray soll dank eines günstigen Preises (für Sonos-Verhältnisse) vor allem Einsteiger locken. Denn sie arbeitet nicht nur als Soundbar am TV, es handelt sich um einen vollwertigen Sonos-Lautsprecher mit ziemlich fettem Klang. Anders als die größeren Soundbars verzichtet die Ray auf einen HDMI-Anschluss, Audio-Inhalte vom TV bekommt sie nur über ein optisches Kabel. Damit fallen Formate wie Atmos weg, reicht ein gutes, virtuelles 5.1 heutzutage überhaupt noch?
Design
Die Ray ist minimalistisch. Sie ist knapp 55 mm lang und damit kürzer als die Sonos Beam oder die Bose Smart Soundbar 500. Die Front ist mit einem Gitter versehen, das komplette Gerät ist wahlweise schwarz oder weiß gefärbt. Sprich, minimalistisches Design, Sonos-typisch. Vorn ist eine Status-LED, die aber meist automatisch deaktiviert wird. Auf der Oberseite sind die drei typischen Sonos-Knöpfe für Lauter, Leiser und Play/Pause.
Die Soundbar macht sich gut unter dem TV, wer möchte, der kann sie mit den separat erhältlichen Halterungen an die Wand schrauben. Passende Bohrungen sind vorhanden.
Anschlüsse
Die Sonos Ray ist einfach, denn es gibt nur drei Anschlüsse: Strom, Ethernet, optischer Eingang. HDMI fehlt, dafür ist natürlich WLAN integriert. Das Bluetooth-Modul kommt nur während des Set-ups zum Einsatz.
Neben dem Sonos-Multiroom-System kann man über Airplay 2, Spotify Connect oder Google Chromecast kabellos Musik streamen.
Einrichtung
Sonos ist beim Thema Set-up erfreulich einfach. Solange man die App auf einem halbwegs aktuellen Smartphone installiert hat und bei einem Sonos-Konto angemeldet ist, läuft der Rest fast von allein. Die Ray wird kurz nach dem Start automatisch in der App angezeigt, ein Klick darauf startet den Pairing-Vorgang. Die eigentliche Koppelung läuft über einen Ton, alles ziemlich komfortabel. Nach einem automatischen Update ist das Gerät einsatzbereit.
Ähnlich einfach ist die Verbindung zum Fernseher. Die Sonos Roam hat lediglich einen optischen Anschluss für Audio, HDMI (und damit ARC) fehlt. Das beiliegende Kabel steckt man an den optischen Ausgang am TV, das andere Ende kommt in die Soundbar. Anschließend läuft das Set-up durch, eventuell muss man noch die Lautsprecher des Fernsehers manuell deaktivieren.
Da die Sonos Ray nicht über HDMI und CEC gesteuert werden kann, muss man eine Fernbedienung manuell anlernen. Das funktioniert allerdings nur, wenn man Infrarot-basierte Fernbedienungen nutzt. Bei neueren TVs oder Multimedia-Geräten wie das Nvidia Shield, die Bluetooth verwenden, hat man Pech. Hier werden derzeit nur Apple TV, Samsung One, Samsung F-Serie und LG Magic unterstützt. Alle anderen müssen die Soundbar über die App steuern.
Bei den Surround-Lautsprechern gibt es allerdings ein paar Einschränkungen. Die Surround-Lautsprecher müssen vom gleichen Typ sein, man kann also nicht einen Play:3 und einen Play:1 mischen. Außerdem kann man leider keinen Sonos Roam als Rücklautsprecher nutzen. Schade, gerade die ließen sich dank ihres Akkus einfach positionieren.
Ebenfalls bedauerlich ist das fehlende Einmessmikrofon für Trueplay. iOS-Nutzer können immerhin ihr Smartphone nutzen, Android-Nutzer sehen weiter in die Röhre. Virtuelle Assistenten kann man ebenfalls nur über andere Geräte nutzen – es fehlt einfach ein Mikro.
Bedienung
Wie immer laufen Bedienung sowie Konfiguration über die immer noch sehr gute App. Musik lässt sich aus verschiedenen Quellen wählen und wiedergeben. Zusätzlich kann man darüber Gruppen erstellen, die dann die gleichen Inhalte spielen. Doch das gilt nur für Musik, wer echte Surround-Lautsprecher für Filme sucht, der muss diese in den Einstellungen einrichten. Hier kann man auch optional den Subwoofer Sonos Sub hinzufügen.
Weiter lassen sich hier die verschiedenen Optionen für die Wiedergabe am TV regeln. Wir empfehlen, TV Autoplay zu aktivieren, dann schaltet die Soundbar in den TV-Modus, sobald Sound am optischen Eingang ankommt. Im TV-Modus kann man die Lautstärke per App verändern, den Nachtmodus aktivieren oder die Dialoge hervorheben.
Um von der TV-Funktion wieder auf die Multiroom-Wiedergabe umzusteigen, muss man einfach nur über die App eine neue Playliste oder einen neuen Radiosender laden.
Sonos Ray - Bilderstrecke
Soundqualität
Die Sonos-Produkte haben uns beim Sound noch nie enttäuscht, die Sonos Ray ist dabei keine Ausnahme. Kurz, Musik hören oder Filme ansehen macht mit der relativ kleinen Soundbar richtig viel Spaß. Das liegt auch daran, dass man so ziemlich jede Quelle als Zuspieler nehmen kann. Neben populären Diensten wie Spotify oder Deezer, sind auch Apple Music, Tidal, Qobuz oder Napster verfügbar. Dazu kommen lokale Wiedergabesysteme, etwa über Plex oder einfach UPnP.
Insgesamt kann der Sound überzeugen, wenngleich der Bass vielleicht etwas untergeht. Irgendwann zeigt die Physik einfach Grenzen auf. Das gilt auch beim Kino-Sound. Die kleine Ray schafft schon allein einen überraschend guten virtuellen 5.1-Sound, der Bass ist hörbar, aber nicht wirklich dröhnend. Mit einem Sonos Sub ändert sich das, aus einfachem Bass wird ein raumfüllendes Beben. Ob dieser Zusatz aber knapp 680 Euro wert ist, muss jeder selbst entscheiden. Gut gefallen hat uns die Dialogverbesserung. Sie macht Gespräche deutlich besser hörbar, gerade, wenn die sonst im Klangsumpf untergehen.
Preis
Die Preisempfehlung für die Sonos Ray liegt bei 299 Euro. Inzwischen ist sie auf Ebay für 150 Euro erhältlich.
Fazit
Mit der Sonos Ray liefert Sonos ein spannendes Produkt für das untere Preissegment (zumindest für Sonos-Produkte). Der Preis liegt zwar über einer Sonos One (Testbericht), aber deutlich unterhalb einer Sonos Five (Testbericht). Und man bekommt einen vollwertigen Multiroom-Lautsprecher, der mit den größeren Sonos-Lautsprechern mithalten kann. Quasi kostenlos gibt es dann eine Soundbar-Funktion hinzu. Der Verzicht auf HDMI bedeutet allerdings auch, dass weder CEC noch ARC verfügbar ist, beides sind praktische Funktionen zur Steuerung der Soundbar. Dafür ist der Anschluss über das optische Kabel deutlich weniger anfällig für Zickereien als bei HDMI.
Harman Kardon Citation Multibeam 1100
Harman Kardon Citation Multibeam 1100
Die Soundbar Harman Kardon Citation Multibeam 1100 verspricht ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher und Subwoofer. Mit Dolby Atmos und der innovativen Multibeam-Technologie ausgestattet, bietet sie vollen, räumlichen Klang bei umfangreicher Funktionalität. Das kostet – ist der Preis gerechtfertigt?
VORTEILE
- sehr klare Dialoge
- breiter Raumklang auch ohne Satelliten
- voller Sound auch ohne Sub
- tolles LCD mit Touch zur Steuerung
- viele Anschlüsse und Funktionen
NACHTEILE
- für Musik nicht optimal
Harman Kardon Citation Multibeam 1100 im Test
Die Soundbar Harman Kardon Citation Multibeam 1100 verspricht ein beeindruckendes Heimkino-Erlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher und Subwoofer. Mit Dolby Atmos und der innovativen Multibeam-Technologie ausgestattet, bietet sie vollen, räumlichen Klang bei umfangreicher Funktionalität. Das kostet – ist der Preis gerechtfertigt?
Kein Platz für einen Subwoofer, aber es soll trotzdem ordentlichen Raumklang geben? Mit der Citation Multibeam 1100 verspricht Hersteller Harman Kardon genau das. Dabei setzt der Hersteller nicht nur insgesamt auf hochwertige Komponenten, sondern auf spezielle Sidefiring-Speaker, ein Touchdisplay und viel Leistung mit bis zu 630 Watt. Zudem ist der schicke Barren für noch mehr (3D-)Sound um Satelliten und Subwoofer erweiterbar. Wir wollten im Test wissen, ob das alles auch ohne die Add-Ons so gut wie versprochen funktioniert.
Design und Verarbeitung
Die Citation Multibeam 1100 präsentiert sich in einem eleganten Design, das in Schwarz oder relativ hellem Grau erhältlich ist. Die Soundbar ist mit einem hochwertigen Wollstoff des dänischen Herstellers Kvadrat bespannt, der schmutzabweisend und schwer entflammbar sein soll – schick ist er allemal, zudem fühlt er sich gut an. Dadurch fällt auch nicht weiter auf, dass Harman Kardon trotz des hohen Preises bis auf eine schmale Metallleiste oben auf der Front mit typischem Hersteller-Schriftzug fast ausschließlich Kunststoff als Material verwendet. Das sieht man zwar nicht, fühlt es aber vor allem bei den auffällig geformten Speakern an den Seiten. Bei dem hohen Preis der Multibeam 1100 hätten wir hochwertigeres Material erwartet.
Dank der beiden Farbgebungen und den Maßen von 115 x 6,5 x 13 Zentimetern ist die Soundbar schlank genug, um sich unauffällig in jedes Wohnzimmer einzufügen. Trotz der großen Länge, die selbst normale 50-Zoll-Fernseher übertrifft, wirkt das Gerät im Zusammenspiel mit den organischen Rundungen und der niedrigen Höhe insgesamt beinahe filigran. Das trotz der Größe fast schon niedrige Gewicht von 4,6 Kg passt dazu gut. Auf Wunsch lässt sich die Citation Multibeam 1100 mit beiliegendem Befestigungsmaterial auch an die Wand gebracht werden.
Alle Bilder zur Harman Kardon Citation Multibeam 1100 im Test
Ein besonderes Highlight für Soundbars ist das integrierte Touch-LC-Display auf der Oberseite, das eine einfache Bedienung ermöglicht. Vorn gibt es nur mehrere einzelne LEDs als Anzeige. Alternativ bietet die mitgelieferte Fernbedienung zahlreiche Direktwahltasten für die wichtigsten Einstellungen, sodass keine Internetverbindung oder App-Steuerung notwendig ist. Eine App gibt es nicht.
Ausstattung und Konnektivität
Die Citation Multibeam 1100 ist mit einer Vielzahl von Anschlüssen und Funktionen ausgestattet. Neben Wlan, Bluetooth und AirPlay unterstützt sie auch Chromecast, Alexa MRM (Multi Room Music) und Spotify Connect. Die Soundbar lässt sich über WLAN und LAN ins Netzwerk integrieren und kann über die Google Home-App eingerichtet werden. Für Multiroom-Funktionen und sprachgesteuerte Wiedergabe sind kompatible Smart-Speaker von Amazon Alexa, Google Assistant und Apple Siri erforderlich.
An Anschlüssen bietet die Soundbar einen HDMI-Ein und -Ausgang mit eARC-Unterstützung (Enhanced Audio Return Channel) sowie eine Toslink-Buchse für ein optisches Kabel. Dank eARC lässt sich die Lautstärke der Soundbar im Alltag über die Fernbedienung des Fernsehers steuern, sodass die Fernbedienung der Soundbar eigentlich gar nicht mehr gebraucht wird. Analoge Eingänge fehlen, was für Nutzer älterer Fernseher oder Beamer ein Nachteil sein könnte. Die HDMI-Ports unterstützen 4K/60p, HDCP 2.3, HDR10+, Dolby Vision und HDR, was sie zukunftssicher macht.
Bedienung
Die Bedienung der Citation Multibeam 1100 ist intuitiv und benutzerfreundlich. Das Touchdisplay ermöglicht wie am Smartphone eine einfache Navigation durch die verschiedenen Einstellungen, Dank Grafiken und Text weiß hier jeder sofort, wie und wo etwas umzustellen ist. Anders sieht das bei den LEDs an der Front aus. Wie bei vielen Konkurrenzprodukten leuchten hier unterschiedlich viele der maximal vier weißen LEDs auf, zudem können sie unterschiedlich gedimmt werden. Wie bei der Konkurrenz ist das alles andere als wirklich aussagekräftig – warum nicht auch vorn ein kleines Display?
Zum Glück braucht es später kaum noch Eingriffe. Nach dem ersten Herumspielen, Einstellen und Feinjustieren läuft die Soundbar ohne weitere Eingriffe. Ansonsten kommt die Fernbedienung zum Einsatz, die alle wichtigen Funktionen abdeckt. Die automatische Kalibrierung der Soundbar funktioniert schnell und zuverlässig, was den Einstieg erleichtert. Anschließend wurde die Bühne deutlich breiter als vor der Kalibrierung. Wie immer gilt hierbei: Achtung laut!
Klangqualität
Breite Bühne dank seitlicher Speaker, aber umfassender Raumklang ist das nur bedingt heise bestenlisten
Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 beeindruckt insgesamt mit vollem, räumlichem und sehr klarem Klang. Die Räumlichkeit wird durch die Kombination von Dolby Atmos und der Multibeam-Technologie erreicht, bei der zwei Side-Firing-Speaker dafür sorgen, dass der Klang auch ohne zusätzliche Surround-Lautsprecher erstaunlich immersiv wirkt. Ohne Satelliten fehlt uns aber doch ein gutes Stück zu komplettem 3D-Sound, die Soundkulisse ist zwar deutlich breiter und erinnert daher an sehr plastisches Stereo, hüllt ohne Zusatzlautsprecher aber nicht von allen Seiten ein.
Trotzdem gefällt uns der Sound sehr gut. Besonders hervorzuheben ist die Sprachverständlichkeit, die auch aus seitlichen Hörwinkeln kaum nachlässt. Klingen andere Soundbars gerade bei niedriger Lautstärke gern etwas zu dumpf, passt die Multibeam 1100 im Test hier automatisch den Klang an und produziert kristallklaren Sound. Der ist auf Wunsch aber gleichzeitig auch erstaunlich voll, sodass wir anfangs irritiert nach dem offenbar doch angeschlossenen Subwoofer gesucht haben – aber im Test war da keiner. Beim weiteren Ausprobieren zeigte sich aber auch schnell, dass der Bass zwar für ein angenehm volles Klangbild reicht, aber erwartungsgemäß nicht wirklich tief spielt. Genaugenommen kommt er zwar bis unter 40 Hz, aber schon unter 60 Hz lässt der Druck hörbar nach, auch wenn es um 60 Hz sogar zu leichtem Flattern oder Klirren kommt. So oder so: Wer sonst keinen Subwoofer hat und auch keinen erwartet, wird mit der Multibeam 1100 beim Bass absolut zufrieden sein. Wer mehr will, muss zu den passenden Subwoofern Sub oder Sub S greifen.
Während die gute Verständlichkeit von Dialogen und der sehr klare Ton bei Film und Fernsehen positiv hervorsticht, wirkt das bei Musik bisweilen etwas überspitzt. Zwar lassen sich Bässe und Höhen getrennt voneinander in 4 Stufen einstellen, doch für unseren Geschmack ist hier Stufe 2 zu dumpf und Stufe 3 schon wieder zu spitz. Das lässt sich durch die Deaktivierung der 3D-Sound-Option zwar noch etwas Feinjustieren, insgesamt gefällt uns die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 aber für Filme und Serien besser als für Musik. Das ist schade, schließlich bietet sie durch die Integration in das Alexa-Universum in Verbindung mit Echo-Geräten nicht nur Sprachsteuerung, sondern auch Multiroom-Musik.
Preis
Mit einer UVP von knapp 875 Euro gehört die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 zur oberen Preisklasse der Soundbars. Inzwischen ist sie aber beim Hersteller selbst schon für knapp 480 Euro in Grau und theoretisch sogar nur 327 Euro in Schwarz bekommen – wenn letztere Variante denn zum Testzeitpunkt nicht ausverkauft gewesen wäre. Kein Wunder, denn für diesen Preis ist die Soundbar richtig gut!
Aktuell ist die Soubdbar aber leider vergriffen!
Fazit
Die Harman Kardon Citation Multibeam 1100 ist ideal für Heimkino-Enthusiasten, die ein beeindruckendes Klangerlebnis ohne zusätzliche Lautsprecher oder Subwoofer suchen. Mit Satelliten und Sub wird der Klang zwar noch voller, aber sie bietet auch so schon einen erstaunlich vollen und räumlichen Klang. Hinzu kommt eine große Funktionsvielfalt, die sie zu einer ausgezeichneten Wahl für moderne Wohnzimmer macht. Hervorzuheben ist zudem das übersichtliche Touch-LCD, das die Bedienung zum Kinderspiel macht. Nur, wer Wert auf eine besonders harmonische und neutrale Musikwiedergabe legt, könnte von der Soundbar weniger begeistert sein.
Bose Smart Soundbar 600
Bose Smart Soundbar 600
Mit der Smart Soundbar 600 bietet Bose einen handlichen TV-Lautsprecher, für den in jedem Wohnzimmer ein Plätzchen zu finden ist. Dank Dolby Atmos und nach oben abstrahlender Schallwandler ermöglicht der kompakte TV-Lautsprecher fülligen Raumklang. Wie gut das gelingt, zeigt der Test.
VORTEILE
- guter Klang
- Dolby-Atmos-Sound
- App-Steuerung
- Alexa-Sprachsteuerung
- AirPlay, Bluetooth, Chromecast
NACHTEILE
- Leuchtstreifen wenig intuitiv
Bose Smart Soundbar 600 im Test
Mit der Smart Soundbar 600 bietet Bose einen handlichen TV-Lautsprecher, für den in jedem Wohnzimmer ein Plätzchen zu finden ist. Dank Dolby Atmos und nach oben abstrahlender Schallwandler ermöglicht der kompakte TV-Lautsprecher fülligen Raumklang. Wie gut das gelingt, zeigt der Test.
Viel Volumen, großer Klang: An dieser simplen Formel führte über lange Zeit kein Weg vorbei. Mittlerweile wagen sich aber immer mehr Hersteller an vergleichsweise kleine Gehäuse und versuchen, mithilfe von Ingenieurskunst und ausgeklügelter Elektronik die Gesetze der Physik auszuhebeln.
Bose möchte mit seiner Smart Soundbar 600, die super flach und nicht mal 70 Zentimeter breit ist, selbst ausgewachsenen Flat-TV-Boliden akustisch neues Leben einhauchen und ein „mitreißendes Erlebnis mit realistischen Höheneffekten“ realisieren. Größenwahn oder audiophile Revolution im Miniatur-Format?
Design und Verarbeitung
Die Smart Soundbar 600 ist ein sehr kompakter Klangaufhübscher, der im Wohnzimmer kaum auffällt. Mit gerade mal 69,4 Zentimeter in der Breite gehört die Bose zu den kleineren Soundbars am Markt. 5,6 Zentimeter in der Höhe und 10,4 Zentimeter in der Tiefe erlauben es, die Soundbar 600 auch auf weniger üppig dimensionierten Sideboards zu verstauen. Hinzu kommt das geringe Gewicht von 3,1 Kilogramm. Das prädestiniert den Lautsprecher dafür, bei Bedarf auch in unterschiedlichen Räumen zum Einsatz zu kommen. Die Soundbar ist ausschließlich in Schwarz erhältlich, das passt aber so gut wie immer und überall.
Die Oberseite besteht aus Kunststoff, der ist glücklicherweise von der hochwertigen Sorte und macht optisch was her. Der matte Look sorgt dafür, dass Fingerabdrücke an der Oberfläche kaum haften bleiben. Das Abdeckgitter an der Front ist ebenso wie das obere aus Metall gefertigt und passgenau eingesetzt. Die Ecken der Soundbar sind abgerundet, der Handschmeichel-Effekt ist hoch. Große gummierte Füße ermöglichen einen sicheren Stand und schonen sensible Oberflächen. Der gesamte Korpus wirkt sehr stabil und verwindungssteif.
Technische Daten, Anschlüsse und Ausstattung
Die Smart Soundbar 600 unterstützt neben Dolby Atmos auch Dolby Digital, Dolby True HD sowie Dolby Digital Plus und kann Stereo- und 5.1-Ton wiedergeben. DTS-Signale werden nicht verarbeitet. An den Seiten ist jeweils ein Lautsprecher positioniert, zwei zusätzliche sitzen oben in der Mitte. Diese Höhenlautsprecher funktionieren nach dem Prinzip, dass der hier austretende Schall von der Zimmerdecke runter zum Hörplatz reflektiert wird.
An der Gehäuserückseite ist ein HDMI-Anschluss mit eARC (Audio-Rückkanal) untergebracht, außerdem lässt sich die Bose über ein optisches Audiokabel mit dem Flat-TV verbinden. Ein externer Subwoofer kann angedockt werden. Der USB-Port eignet sich lediglich für Service-Leistungen. Klasse: HDMI- und optisches Kabel werden mitgeliefert.
Zur Ausstattung gehören ferner Bluetooth 4.2, AirPlay 2, Spotify Connect und Chromecast. Die Steuerung gelingt mittels Amazon Alexa auch per Sprache, dazu später mehr. Statt eines Displays hat Bose eine Lichtleiste verbaut, die aber mitunter mehr verwirrt als weiterhilft.
Einrichtung und Bedienung
In den meisten Fällen wird die Bose Smart Soundbar wohl per HDMI an einem Fernseher betrieben. Dann genügt es, am Flat-TV die externe Tonausgabe respektive HDMI ARC zu aktivieren. An der Soundbar selbst muss lediglich HDMI als Quelle ausgewählt sein. Schon steht der Film- und Musikwiedergabe nichts mehr im Weg.
Für die unkomplizierte Bedienung hat Bose eine kleine Fernbedienung im Scheckkartenformat beigelegt. Acht Tasten auf der angenehm gummierten Benutzeroberfläche bieten hohen Bedienkomfort. So kann man die Soundbar ein- und ausschalten, die Lautstärke verändern, die gewünschte Quelle wählen und Songs pausieren.
Wer sein Smartphone ohnehin immer in der Hand hat, sollte die für iOS und Android erhältliche „Bose Music“-App herunterladen. So kann man die Soundbar steuern, die Lautstärke anpassen, Quellen wechseln sowie per Equalizer diverse Klanganpassungen vornehmen. Auch Bass und Höhen sind per App modifizierbar, zudem lassen sich Ton-Verzögerungen ausgleichen.
Bose Smart Soundbar 600: Über die „Bose Music“-App hat man Zugriff auf Quellen, kann den Klang anpassen und Hörzonen bilden. heise bestenlisten
Natürlich dient die App auch als Streaming-Zentrale – Musik spielt man beispielsweise über Spotify, Amazon Music oder Tunein zu. Für einen schnelleren Zugriff speichert man Radiosender oder Playlists in Presets ab. Hat man mehrere Bose-Lautsprecher im Einsatz, lassen sich diese in Gruppen zusammenfassen, um etwa parallel in unterschiedlichen Zimmern denselben Song abzuspielen.
Hilfreich ist hingegen die Möglichkeit, die Bose-Soundbar mittels Alexa per Sprache zu steuern. Ob lauter oder leiser, das Wechseln zu anderen Songs, das Pausieren eines Tracks oder das Stellen eines Timers – der Sprachassistent erweist sich als nützliches Feature. Die in die Soundbar integrierten Mikrofone lassen sich per Tastendruck auf der Oberseite des Lautsprechers deaktivieren.
Klangeigenschaften
Einen Fehler darf man nicht machen: die kleine Smart Soundbar 600 mit einem vollständigen Heimkinosystem oder einer deutlichen voluminöseren Soundbar mit separatem Subwoofer zu vergleichen. Denn letztendlich ist der Bose-Klangriegel eher nur ein Lautsprecher-Winzling mit sehr überschaubaren Abmaßen. Für diese kompakten Dimensionen spielt der Schallwandler angenehm luftig mit schöner Klangbühne und hervorragender Sprachverständlichkeit auf. Höhen sind nicht glasklar, werden aber deutlich akzentuiert.
Bei orchestraler Musik trennt die Bose einzelne Instrumente präzise und hebt diese plastisch voneinander ab. Auch wer seitlich von der Soundbar und nicht direkt zentral vor dem Lautsprecher sitzt, wird akustisch umnebelt. Der Klangkokon ist nicht ganz so füllig wie bei einem ausgewachsenen Soundsystem, aber trotzdem hat man das Gefühl, tonal im Geschehen dabei zu sein.
Bei Dolby-Atmos-Filmen spürt man ebenfalls ein Mehr an akustischer Präsenz. Allerdings sollte man hier seine Erwartungen ein wenig drosseln – separate Höhenkanäle oder im Raum stehende Soundeffekte werden bestenfalls angedeutet, wuchtigere und teurere Audiosysteme und natürlich erst recht separate Höhenlautsprecher agieren hier auf einem ganz anderen Niveau.
Das gilt ebenfalls für den Bass. Der Tieftonteppich liegt nicht zentimeterdick im Raum, sein Druck ist überschaubar. Aber im Vergleich zur reinen Filmwiedergabe über den Flat-TV ermöglicht die Smart Soundbar 600 doch ein intensiveres klangliches Eintauchen in die Handlung, weil die Raumabbildung merklich präsenter ist, ein Pistolenschuss oder das Donnern eines Kampfjets mit mehr Präsenz und Dynamik zum Leben erweckt werden.
Insgesamt sind wir mit der Soundperformance der Bose-Soundbar sehr zufrieden, ohne großen Aufwand und optischen Eingriff ins Wohnzimmer werden die akustische Brillanz von Musik, Sprache und Effekten effektiv aufpoliert.
Preis
Bose hatte zum Testzeitpunkt den Preis für die Smart Soundbar 600 von 550 Euro auf 500 Euro reduziert. Viel günstiger ist der TV-Lautsprecher auch bei den großen Elektronikketten und Online-Anbietern nicht zu bekommen. Selbst nach intensivem Stöbern im Internet lässt sich keine Plattform finden, auf der die Bose-Soundbar für weniger als 480 Euro zu haben ist.
Fazit
Die Smart Soundbar 600 löst keine tonale Revolution im Wohnzimmer aus, aber sie leistet bei kompakten Abmaßen ausgezeichnete Arbeit und eignet sich sowohl für ansprechende Filmakustik als auch für gelungene Konzertabende. Bedienkomfort und Verarbeitung sind top, lediglich die Lichtleiste an der Front ist noch verbesserungswürdig.
Das App-Konzept überzeugt, und in den meisten Wohnzimmern dürfte die Smart Soundbar locker ausreichen, um den TV-Ton auf ein höheres Level zu heben. Bose beweist: so groß kann klein sein!
Wer mehr Bass braucht, sollte einen Blick auf die Teufel Cinebar 11 (Testbericht) mit Subwoofer werfen. Weitere Geräte dieser Art zeigen wir im Ratgeber Mini-Soundbars: Viel Klang auf wenig Raum für TV & Homeoffice und Soundbars: So findet man den besten Klang für den Fernseher.
Mehr über satten Sound für Filme und mehr erklärt unser Ratgeber: Lautsprecher, Subwoofer und AV-Receiver: Das braucht man wirklich für gutes Heimkino. Wie man sich zu Hase sein eigenes Kino bastelt, zeigen wir im Beitrag: Unsichtbares Heimkino im Wohnzimmer: DIY mit Beamer-Lift und elektrischer Leinwand.
Amazon Fire TV Soundbar
Amazon Fire TV Soundbar
Mit der Amazon Fire TV Soundbar bietet der Online-Gigant einen kompakten TV-Lautsprecher für besseren Klang im Heimkino. Wie gut die Soundbar ist, zeigt der Test.
VORTEILE
- einfache Bedienung und Einrichtung
- relativ kompakt
- fairer Preis
NACHTEILE
- dumpfer Klang
- kein Dolby Atmos
- etwas zu hoch (je nach Standfuß des TVs)
Amazon Fire TV Soundbar im Test
Mit der Amazon Fire TV Soundbar bietet der Online-Gigant einen kompakten TV-Lautsprecher für besseren Klang im Heimkino. Wie gut die Soundbar ist, zeigt der Test.
Fernseher liefern oft nur einen schwachen Sound, da ihre eingebauten Lautsprecher aufgrund der flachen Bauweise kaum Volumen bieten. Eine Soundbar schafft hier Abhilfe. Sie nimmt nur wenig Platz in Anspruch und ist schnell angeschlossen, erzeugt aber einen vollen und dynamischen Klang für ein intensives Erlebnis im Heimkino.
Mit der Fire TV Soundbar bietet Amazon jetzt auch einen eigenen TV-Lautsprecher an, der das Sortiment rund um Amazon Fire TV Omni QLED (Testbericht) oder Fire TV Stick 4K Max (Testbericht) klanglich erweitert. Während Top-Modelle von namhaften Herstellern oft jenseits der 500 Euro liegen, besticht die Soundbar von Amazon mit einem niedrigen Preis von 140 Euro. Doch sind auch Klang und Bedienung gut? Das zeigt unser Testbericht.
Weitere Alternativen finden sich in der Top 10: Die besten Soundbars – Bose, Denon, Teufel & Co.
Design: Wie groß ist die Fire TV Soundbar?
Die Fire TV Soundbar ist ein typischer Vertreter seiner Zunft und kommt im bekannten quaderförmigen Design zum Käufer. Das Gehäuse besteht komplett aus Kunststoff und wirkt nicht besonders hochwertig, was für den Preis aber niemanden überraschen sollte. Die Verarbeitung ist aber sauber und kommt ohne scharfe Kanten aus, da die Ecken stark abgerundet sind. Hier gibt es nichts auszusetzen.
Die Lautsprecher selbst sind mit Stoff verkleidet. Dahinter befinden sich drei LED-Leuchten. Diese blinken in Weiß, wenn die Soundbar eingeschaltet ist. Bei Wiedergabe mit Dolby Digital leuchtet eine LED in Grün, bei Bluetooth-Verbindung in Blau und wenn ein inkompatibles Gerät per USB angeschlossen ist in Rot.
Oben in der Mitte befinden sich die Tasten für On/Off, Lautstärke, Bluetooth sowie die Soundquelle. Auf der Rückseite sind die Anschlüsse und der Stromanschluss. Hinten befinden sich zudem zwei Öffnungen, um die Soundbar mit einem Dübel an der Wand zu befestigen, falls auf dem Sideboard vor dem Fernseher kein Platz sein sollte.
Die Soundbar wiegt rund 1,8 kg und bietet Abmessungen von 610 × 90 × 65 mm. Damit gehört sie zu den eher kompakten Modellen, auch wenn es noch kleinere Modelle gibt. Ausprobiert haben wir sie mit einem Samsung-Fernseher, hier ragte die Soundbar wegen des niedrigen Standfußes des TVs mehr als einen Fingerbreit ins Bild hinein. Die Höhe ist also nicht optimal und hätte gerne etwas flacher ausfallen dürfen.
Ausstattung: Wie verbindet man die Fire TV Soundbar?
Als Anschlüsse stehen USB-A, HDMI eARC (enhanced Audio Return Channel) sowie ein optischer Eingang parat. Ein HDMI- sowie Netzkabel und eine Fernbedienung gehören zum Lieferumfang, ein optisches Kabel aber nicht. Der 2-0-Speaker bietet zudem Bluetooth. Als Audio-Decoder stehen Dolby Digital und DTS Virtual:X zur Verfügung. Dolby Atmos gibt es aber nicht. Die Peak-Leistung liegt bei 40 Watt. Einen Subwoofer kann man nicht anschließen.
Die Soundbar geht automatisch in Betrieb, wenn man einen eARC-Eingang am Fernseher nutzt, falls vorhanden. Das ist praktisch, da man nicht umständlich in den TV-Einstellungen die Soundquelle auswählen muss. In unserem Test-Setting mit einem älteren Samsung-Fernseher und Fire TV Stick 4K Max (Testbericht) konnten wir auch die Fernsteuerung des TV-Sticks nutzen. Allerdings reagiert die Eingabe hier verzögert. Stellt man leiser oder lauter, dreht man das Gerät rasch zu leise oder laut, wenn man nicht aufpasst.
Sound: Wie ist der Klang der Fire TV Soundbar?
Bei günstigen Soundbars ist das eine solche Sache: Zu hohe Ansprüche an den Klang sollte man nicht haben. Das ist bei der Fire TV Soundbar nicht anders. Der angenehm warme und klare Klang ist besser als bei den meisten im Fernseher integrierten Lautsprechern. Allerdings ist man nach dem ersten Einschalten bei niedrigem Pegel nicht ganz sicher, ob jetzt der Sound aus dem Klangriegel oder Fernseher kommt. Erst, wenn man aufdreht, merkt man den Unterschied positiv. Stimmen sind gut zu vernehmen, Action-Szenen wirken deutlich wuchtiger und Mitten und Höhen sind gut ausgeprägt.
Die Fire TV Soundbar entfaltet ihre Wirkung bei Filmen, Serien oder Sport-Events. Bei Musik schwächelt sie jedoch, dafür ist der Klang insgesamt etwas dumpf, nasal sowie undifferenziert. Anpassungen des Equalizers sind per Fernsteuerung möglich. Drückt man die Bass-Taste auf der Fernsteuerung doppelt, sorgt man für etwas mehr Wumms. Es gibt zudem einen 3D-Modus, den man per Fernsteuerung aktivieren kann. Die Fire TV Soundbar bietet dann einen soliden Raumklang, wenn es die Quelle ermöglicht.
Technische Daten
Preis & Alternativen: Was kostet die Fire TV Soundbar
Bei Amazon kostet die Fire TV Soundbar derzeit 140 Euro. Das ist ein fairer Preis für die gebotene Ausstattung.
Es gibt allerdings weitere preiswerte Alternativen. Dazu gehört etwa die Sharp HT-SB700 (Testbericht) mit Dolby Atmos für 164 Euro oder die Polk React (Testbericht) für knapp 143 Euro. Wer mehr Bass benötigt, kann sich die Panasonic SC-HTB496 (Testbericht) mit Funk-Subwoofer für 150 Euro ansehen.
Fazit
Die Amazon Fire TV Soundbar ist für 140 Euro definitiv ein Schnäppchen und bietet soliden Sound als Upgrade zum sonst schnöden Fernseher-Klang. Bedienung und Einrichtung sind bei eARC spielend leicht, einstecken und loslegen – fertig. Der Klangriegel ist recht kompakt, könnte aber unserer Meinung nach gerne etwa flacher sein. Bei unserem Test ragte die Soundbar etwas ins Bild hinein. Alternativ montiert man sie an die Wand.
Für den Preis ist der Klang ziemlich gut und deutlich, ohne Verzerrungen. Allerdings klingt der Sound auch etwas dumpf, was sich speziell bei Musik bemerkbar macht. Ein gewisser Raumklang wird geboten, der aber nicht ganz an Surround-Systeme heranreicht. Wer einen preiswerteren Fernseher bezüglich Sound aufwerten will, ohne viel Geld auszugeben, macht bei der Fire TV Soundbar nichts falsch.
Mehr zum Thema Sound und Heimkino zeigen wir in diesen Artikeln:
- Top 10: Die besten Soundbars – Bose, Denon, Teufel & Co.
- Perfekter Sound fürs Heimkino: Die besten Lautsprecher, Subwoofer & AV-Receiver
- Top 10: Der beste HDMI-Switch für Heimkino, TV & Co. im Test
- Die 10 besten Full-HD-Beamer bis 200 Euro – erstaunliche Ausstattung und gutes Bild
- Den besten Kurzdistanz-Beamer finden: Laser-TV für wenig Platz
Amazon Fire TV Soundbar Plus
Amazon Fire TV Soundbar Plus
Die Amazon Fire TV Soundbar Plus verspricht ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis mit kraftvollem Sound und klaren Dialogen. Unser Testbericht klärt auf, ob die Soundbar wirklich das hält, was sie verspricht.
VORTEILE
- klare Dialoge bei Film und Fernsehen
- erstaunlich viel Bass ohne Subwoofer
- ordentliche Pegel
- einfache Einrichtung
NACHTEILE
- umständliche Bedienung
- kein Raumklang trotz Dolby Atmos und DTS:X
- für Musik weniger geeignet
Amazon Fire TV Soundbar Plus im Test
Die Amazon Fire TV Soundbar Plus verspricht ein beeindruckendes Heimkinoerlebnis mit kraftvollem Sound und klaren Dialogen. Unser Testbericht klärt auf, ob die Soundbar wirklich das hält, was sie verspricht.
Die Amazon Fire TV Soundbar Plus ist ein weiteres Produkt aus dem Hause Amazon, das sich anschickt, den TV-Sound für vergleichsweise wenig Geld auf ein neues Niveau zu heben. Die kleinere und günstigere Amazon Fire TV Soundbar (Testbericht) konnte gerade in Relation zum niedrigen Preis bereits überzeugen. Mit einem 3.1-Setup mit integriertem und zusätzlichem Center für klare Stimmen, Dolby Atmos und DTS:X Unterstützung sowie einer einfachen Bedienung soll sie besonders Filmfans ansprechen, die keinen Platz für einen Subwoofer haben.
Doch wie schlägt sich die Soundbar in der Praxis und ist sie ihr Geld wert? Wir haben sie ausführlich getestet.
Design und Verarbeitung
Die Amazon Fire TV Soundbar Plus präsentiert sich in einem schlichten, aber modernen Design. Der schwarze Kunststoff mit abgerundeten Ecken und Stoffabdeckung bis zur Rückseite verleiht der Soundbar einen wertigen Look. Mit einer Länge von 94 Zentimetern und einem Gewicht von vier Kilogramm ist sie kompakt genug, um unter den meisten Fernsehern Platz zu finden, ohne dabei aufdringlich zu wirken. Erst Fernseher ab 43 Zoll sind größer als die Soundbar. Alternativ sind Winkel für eine Wandmontage dabei.
Die Verarbeitung ist tadellos, was bei einem Preis von knapp 300 Euro auch erwartet werden darf. Die Soundbar verfügt nur über die nötigsten Anschlüsse, nämlich HDMI (eARC - Enhanced Audio Return Channel), USB-A und einen optischen Eingang. Bluetooth ist ebenfalls an Bord. WLAN beherrscht das Gerät nicht, was die Flexibilität einschränkt. Ein Display zur Steuerung bietet der Klangriegel nicht, stattdessen versucht er, Informationen mittels mehrerer LEDs und Sprachausgabe an den Nutzer weiterzugeben. Die einfache Fernbedienung aus Kunststoff ist recht klein, bietet aber Zugriff auf alle Einstellungsmöglichkeiten der Plus-Soundbar.
Klangqualität
Beim Klang zeigt sich die Amazon Fire TV Soundbar Plus etwas ambivalent. Einerseits erstaunt sie mit klaren Dialogen bei Film und Fernsehehen, andererseits gehen Stimmen bei Musik bisweilen komplett unter. Dann geht das Klavierspiel auf der Fernbedienung los: Dialog-Verbesserer aus oder doch an, 3D-Sound vielleicht doch besser aus, Bass raus oder eher rein und Presets von Movie auf Musik? Letztlich hilft nur Herumprobieren und auch dann ist bei Musik nicht sicher, dass das Ergebnis gut wird. Das hängt auch von der Musikrichtung ab. Bei Genres mit vielen Mitten vermischen gern Instrumente und Stimmen, bei anderen erstaunt die Plus-Soundbar hingegen positiv.
So spielt das Modell Bass – wenn auch nicht sehr homogen oder kräftig – bis satte 36 Hz runter und hat dabei noch eine leichte Überhöhung bei 50 und eine stärkere bei 40 Hz. Damit schafft die Soundbar in der Theorie genauso viel wie deutlich teurere Soundbars mit fettem Subwoofer, etwa die Teufel Cinebar Ultima (Testbericht). In der Praxis gehen solch besonders tiefe Bässe aber im Gesamt-Sound unter, sodass er eher bis 50 Hz kräftig bleibt. Das ist trotzdem ein gutes Ergebnis und sorgt insgesamt für vollen Klang. Bass-Drops werden daher zumindest im oberen Bereich deutlich hörbar wiedergegeben, Donnergrollen oder Bombentreffer in Filmen klingen für ein Modell ohne Sub ziemlich kräftig. Bisweilen kann es dann auf höheren Lautstärken aber zum Klirren kommen, insgesamt ist die Pegelfestigkeit aber in Ordnung.
Raumklang kann die Amazon Fire TV hingegen bestenfalls im Ansatz – kein Wunder bei der begrenzten Anzahl an eingebauten Lautsprechern. Warum sie dann Dolby Atmos und DTS:X beherrschen soll, bleibt wohl ein Geheimnis des Herstellers. Zwar erzeugt die Soundbar bei Aktivierung des Raumklang-Modus vermeintlich minimal mehr Fülle, von echtem Raumklang ist man aber weit entfernt. Auch die Angabe von Amazon zu den Kanälen ist etwas irritierend: Auf der Produktseite spricht Amazon von 3.1-Soundbar, gemeint sind Stereo-Lautsprecher, ein Center und ein interner Subwoofer. Eigentlich versteht man unter dieser Schreibweise einen externen, zusätzlichen Sub.
Bedienung
Die Bedienung der Soundbar ist grundsätzlich denkbar einfach. Sie kann über Tasten am Gerät selbst oder über die mitgelieferte Fernbedienung gesteuert werden. Letztere ermöglicht eine Feinjustierung von Bässen und Höhen in neun Stufen sowie die Hervorhebung von Dialogen in fünf Stufen. Zudem stehen vier Presets zur Verfügung: Film, Musik, Sport und Nacht. Diese Presets bieten eine schnelle Möglichkeit, den Klang an unterschiedliche Inhalte anzupassen, ohne dass tiefere Einstellungen erforderlich sind.
Das Problem: Mangels Display ist die grundsätzlich sehr simple Menünavigation umständlich und die Darstellung alles andere als eindeutig. Gibt es wie für Bass oder Höhen mehrere einstellbare Level, muss der Nutzer die entsprechende Taste der Fernbedienung drücken, auf die akustische Bestätigung per Sprachausgabe warten und diesen Vorgang so lange wiederholen, bis der gewünschte Level erreicht ist. Nach Level 9 geht es wieder bei Level 1 los. Bei 9 Bass-Stufen und nur einem Bedienknopf muss der Nutzer als fünfmal drücken und jedes Mal auf die Sprachbestätigung warten, um den Tiefton von Level 6 auf Level 2 zu senken – umständlich und zeitraubend.
Ein weiteres Manko ist die Anzeige der Lautstärke über fünf LEDs an der Vorderseite, die wie bei der teuren LG DS95TR (Testbericht) in mehreren Stufen gedimmt werden, bis die nächsten LEDs an- oder ausgehen. Wie hoch die Lautstärke nun tatsächlich ist, lässt sich so bestenfalls grob ermitteln, eine numerische Anzeige wäre hier deutlich hilfreicher gewesen. Zudem sind die LEDs bei hellem Umgebungslicht schwer zu erkennen, was die Bedienung weiter erschwert.
Die Entscheidung, auf WLAN zu verzichten, könnte für einige Nutzer ein Nachteil sein, insbesondere für diejenigen, die eine nahtlose Integration in ein bestehendes Smart-Home-System wünschen. Per Bluetooth kann immerhin Musik vom Smartphone auf der Soundbar abgespielt werden.
Preis
Die Amazon Fire TV Soundbar kostet 270 Euro, war aber auch schon für 220 Euro zu haben.
Fazit
Mit einem Preis von 270 Euro bietet die Amazon Fire TV Soundbar Plus ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis für Filmfans, die ihren TV-Sound aufwerten möchten. Die klare Dialogwiedergabe und die grundsätzlich einfache Bedienung machen sie zu einer attraktiven Option. Für Musikliebhaber ist die Soundbar jedoch weniger geeignet, da sie in diesem Bereich bisweilen Schwächen zeigt.
Sony HT-AX7
Sony HT-AX7
Das Sony HT-AX7 ist ein tragbares Surround-System, das sich ohne Kabelsalat schnell aufbauen lässt. Ob die Soundbar auch für gute Klangqualität sorgt, zeigt der Test.
VORTEILE
- kabelloser Surround-Sound
- schickes Design
- Wiedergabe von 30 Stunden bei mittlerer Lautstärke
NACHTEILE
- Bassdruck fehlt und Surround-Sound ist stark positionsabhängig
- Anschluss nur mit Bluetooth-Anbindung
- eingeschränkte Codec-Unterstützung
- gelegentliche Verzögerungen und Qualitätseinbußen
Sony HT-AX7 im Test
Das Sony HT-AX7 ist ein tragbares Surround-System, das sich ohne Kabelsalat schnell aufbauen lässt. Ob die Soundbar auch für gute Klangqualität sorgt, zeigt der Test.
Viele Nutzer spielen von ihren Geräten Filme und Serien ab und nutzen sie auch für Spiele. Für die Tonuntermalung bleiben im mobilen Szenario meist nur Kopfhörer oder die eingebauten Lautsprecher übrig.
Sony hat diese Lücke erkannt und mit dem HT-AX7 ein mobiles und kompaktes Soundbar-System auf den Markt gebracht, das Surround-Sound für Fernseher, aber auch Notebooks, Tablets und Smartphones verspricht – ganz kabellos per Bluetooth. Das macht das Produkt attraktiv, wenn man es auch in den Urlaub oder zu Freunden mitnehmen möchte.
Design & Verarbeitung
Das Sony HT-AX7 sieht elegant aus und ist hochwertig verarbeitet. In der 306 × 97 × 123 mm großen Haupteinheit sind der Subwoofer und die Frontlautsprecher sowie der Akku untergebracht. Zwei runde Satellitenlautsprecher vervollständigen das System. Auch darin sind Akkus verbaut. Aufgeladen werden sie, indem man sie auf die Haupteinheit setzt. Diese wird wiederum über USB-C aufgeladen und hält etwa 30 Stunden durch, die Satelliten jeweils etwa 3 bis 4 Stunden. Das gilt für mittlere Lautstärke. Bei hoher Lautstärke reduziert sich die Gesamtlaufzeit auf etwa 4 bis 5 Stunden für die Haupteinheit deutlich.
Sony hat bei der Konstruktion des HT-AX7 nach eigenen Angaben viel Wert auf Nachhaltigkeit gelegt. Die Gehäuse bestehen aus recycelten PET-Flaschen. Die Verpackung wurde aus natürlichen Materialien und Recycling-Papier gefertigt, eignet sich aufgrund ihrer sperrigen Form aber nicht für den Transport des Geräts. Hier wäre eine Transporthülle zumindest als Zubehör eine nette Option gewesen.
Die Oberseite der Haupteinheit ist gummiert, was auch Nachteile hat. Der Gummi zieht Staub an und ist schwer zu reinigen, was man sogar auf unseren Fotos sehen kann. Die Satelliten sind mit Stoff bespannt, nur die Unterseite ist gummiert.
Eines der Designmerkmale des HT-AX7 ist das Befestigungssystem für die Satellitenlautsprecher. Wenn sie nicht verwendet werden, werden sie platzsparend auf dem Hauptlautsprecher gestellt, wo sie magnetisch in Position gehalten und kabellos aufgeladen werden.
Funktionen, Anschlüsse & Bedienung
Das HT-AX7 nutzt ausschließlich Bluetooth 5.2 für die Verbindung zum Signalgeber und unterstützt die Profile A2DP, AVRCP, HFP, HSP und SPP. Zur Anbindung an die Satellitenlautsprecher wird 2,4-GHz-Funk verwendet. Eine Kabelanbindung zur Soundquelle ist nicht vorgesehen. Der einzige Eingang ist ein USB-C-Anschluss zum Laden des Hauptakkus.
Sony hat die Audio-Codec-Unterstützung des HT-AX7 leider auf AAC und SBC beschränkt. Echtes Mehrkanal-Audio ist nicht möglich. Die räumliche Wiedergabe wird stattdessen künstlich errechnet.
Die Einstellung der Soundbar erfolgt über eine einfache App von Sony, die für iOS und Android angeboten wird. Mit der App kann der Basspegel und die Lautstärke der hinteren Lautsprecher eingestellt und verschiedene Soundmodi ausgewählt werden. Auch Firmware-Updates werden mit der App aufgespielt.
Das HT-AX7 bietet drei Soundmodi für verschiedene Hörszenarien. Der normale Stereomodus bietet eine unverarbeitete Wiedergabe, während der Monomodus für raumfüllenden Klang mithilfe aller Lautsprecher ausgelegt ist, die dafür im Raum verteilt werden können. Im Sound-Field-Modus kommt Sonys Audioverarbeitung zum Einsatz, die einen virtuellen Raumklang erzeugen soll.
Klang des Sony des HT-AX7
Die Audioleistung des HT-AX7 passt aber letztlich nicht zum Preis des Geräts: Die Haupteinheit liefert einen insgesamt ausgewogenen Klang, aber es fehlt der tiefe Bass, den viele Benutzer von einer Surround-Anlage erwarten werden. Da hilft auch der Regler in der App nicht – dem kleinen Kasten sind einfach keine wirkungsvollen, tiefen Bässe zu entlocken.
Die Satellitenlautsprecher tönen im Surround-Modus recht schwach und dienen in der Regel nur der Untermalung der Klangkulisse. Eine zusammenhängende Klangbühne mit ortbaren und herumwandernden Tönen wird so nicht erzeugt.
Wir haben den HT-AX7 mit klanggewaltigen Filmen und Serien wie Greyhound – Schlacht im Atlantik, Masters of the Air, Vikings, aber auch eher leiseren Filme wie Der Vorname angesehen und Spiele wie Resident Evil 4 auf dem iPad gespielt. In speziell abgemischtem Material stellt sich ein gewisser Raumklang ein, aber dieser ist weit entfernt von einer Geräuschkulisse mit einem richtigen Surround-System. Wird Musik abgespielt, gefiel uns der Klang ohne die Satelliten sogar besser, was aber nicht Sinn der Sache sein kann.
Die Lautsprecher des HT-AX7 sollten so platziert werden, dass die Satelliten hinter dem Hörer liegen und er selbst in einem Dreieck sitzt, dessen vordere Spitze die Haupteinheit bildet. Wer allein hört, sollte damit wenig Probleme haben. Sitzen aber mehrere Personen im Raum, nicht alle aufgereiht auf einem Sofa, leidet das Raumklangerlebnis massiv. Sony empfiehlt, die vorderen und die hinteren Lautsprecher in einem Abstand mit einem Radius von 1 bis 1,2 Meter aufzustellen. In der Praxis bedeutet dies, dass der Frontlautsprecher nicht am Fernseher, sondern eher auf dem Couchtisch platziert werden sollte.
Wir haben den Sony HT-AX7 sowohl mit einem Fernseher, einem Apple TV als auch mit einem Notebook und einem Tablet verbunden. In allen Fällen war die Bluetooth-Verbindung schnell aufgebaut. Wer will, kann sogar zwei Geräte verbinden und zwischen ihnen schnell umschalten. Unabhängig von den jeweiligen Geräten kam es sporadisch zu extrem kurzen Aussetzern, die aber trotzdem vorwiegend bei Filmen störten. Durch die Funktechnik gibt es mitunter leichte Synchronprobleme, was besonders bei Szenen in Originalsprache auffällt, weil die Lippen-Synchronität leidet.
Im Hinblick auf die Akkulaufzeit kann der HT-AX7 halten, was Sony verspricht. 30 Stunden für die Haupteinheit sind kein Problem. Wem trotzdem mitten im Film der Strom ausgeht, muss nur rund 10 Minuten nachladen, um wieder für etwa 140 Minuten Power zu haben.
Preis
Die UVP lag ursprünglich bei 549 Euro, mittlerweile hat sich als Straßenpreis ein Betrag rund um 420 Euro eingependelt.
Fazit
Das Sony HT-AX7 ist ein interessantes Konzept für eine tragbare und vor allem kabellose Surround-Lösung, aber die Umsetzung lässt etwas zu wünschen übrig. Während das Design und die Verarbeitungsqualität gut sind, kann die Audioleistung am Ende den Preis nicht ganz rechtfertigen. Hierfür müsste die Klangqualität besser sein und die Einschränkungen bei der Platzierung dürften nicht so erheblich sein.
Soundbar Polk React
Soundbar Polk React
Eine Soundbar mit Alexa-Sprachsteuerung für gerade mal 200 Euro: Die Polk Audio React macht’s möglich und reagiert auf die Stimme, um insbesondere die Lautstärke oder den Sound-Modus zu ändern. Alles schön und gut: Doch wie gut ist die Akustik des TV-Lautsprechers? TechStage testet, ob der Klang überzeugt.
VORTEILE
- Preiswert
- Solider Klang
- Sprachsteuerung und gute Fernbedienung
NACHTEILE
- Tonale Präzision nur mittelmäßig
- kein Display
Soundbar Polk React im Test
Eine Soundbar mit Alexa-Sprachsteuerung für gerade mal 200 Euro: Die Polk Audio React macht’s möglich und reagiert auf die Stimme, um insbesondere die Lautstärke oder den Sound-Modus zu ändern. Alles schön und gut: Doch wie gut ist die Akustik des TV-Lautsprechers? TechStage testet, ob der Klang überzeugt.
Alexa, Siri und Google Assistant haben den Massenmarkt längst erobert. Mittlerweile lassen sich nicht mehr nur Flat-TVs oder Hifi-Lautsprecher, sondern auch Soundbars verbal steuern, wie die Polk Audio React beweist. Natürlich ist das in erster Linie eine nette Spielerei, denn primär kommt es darauf an, wie die React Filme, Nachrichten, Sport und Talkshows zum Leben erweckt.
Design und Verarbeitung
Für gerade mal rund 200 Euro ist die Polk React erstaunlich gut verarbeitet. Der 2,9 Kilo leichte Lautsprecher ist in grauen Akustikstoff gehüllt, die Front ziert ein dezenter silberner Schriftzug des Herstellers. Die Ecken sind abgerundet. Vier kleine gummierte Füße sorgen dafür, dass die Soundbar empfindliche Oberflächen nicht zerkratzt. Für die Montage an der Wand sind in der Gehäuserückseite zwei kleine Öffnungen zum Aufhängen integriert.
Mit einer Breite von 86,4 und einer Tiefe von 12,1 Zentimetern fügt sich der optisch zeitlos gehaltene Schallwandler dezent in die heimische Umgebung ein. Praktisch: Dank der geringen Höhe von 57 Millimetern lässt sich die React problemlos vor dem Fernseher platzieren, ohne den Infrarotsensor des Flat-TVs zu verdecken.
Anschlüsse und Ausstattung
Das Anschlussfeld der React ist nicht üppig, aber mit allem ausgestattet, was Käufer einer 200-Euro-Soundbar erwarten dürfen und wahrscheinlich auch benötigen. So findet man auf der Rückseite einen HDMI-Port mit ARC (Audio Return Channel) sowie einen optischen Digitaleingang. Der USB-Port dient lediglich Service-Zwecken. Über einen Connect-Taster lassen sich der Subwoofer und die Surround-Lautsprecher koppeln. Zudem beherrscht die Soundbar Bluetooth und WLAN.
Gut in dieser Preisklasse ist die Alexa-Sprachsteuerung. Ein Befehl genügt, um etwa die Lautstärke oder den Sound-Modus zu ändern. Koppelt man die Soundbar mit anderen Alexa-fähigen Lautsprechern, so kann man sich ein Multiroom-System aufbauen und beispielsweise in allen Zimmern parallel denselben Song abspielen. Außerdem darf man über die Soundbar telefonieren und Alexa dazu auffordern, eine beliebige Nummer aus den Kontakten auf dem Smartphone zu wählen.
Polk spendiert der React die vier Soundmodi Film, Musik, Sport und Nacht. Im Nacht-Setting wird der Dynamikbereich komprimiert, um bei geringer Lautstärke die Verständlichkeit der Audiowiedergabe zu optimieren. Die Taste „Sport“ ist etwas irreführend – hier hinter verbirgt sich eine Option, um dialogreiche Inhalte wie Nachrichtensendungen oder Talkshows oder eben auch Sportübertragungen zu verbessern. Zusätzlich gibt es eine Möglichkeit, die Lautstärke von Dialogen oder Gesang hervorzuheben.
Die Soundbar verzichtet ähnlich wie die deutlich teurere Bose Smart Soundbar 900 (Testbericht) auf ein Display. An der Vorderseite informiert jedoch eine Status-LED je nach Farbe über die gewählte Eingangsquelle, die Audio-Dekodierung und den Klangmodus. Die sich darüber befindliche Lichtleiste leuchtet blau auf, wenn Alexa antwortet. Außerdem gibt die Lichtleiste Aufschluss über die aktuelle Lautstärke und die Bass-Intensität.
In die Oberseite ist ein kreisrundes Bedienfeld eingearbeitet. Hierüber kann man Alexa aufrufen, das Mikrofon stummschalten und die Lautstärke anpassen.
Polk Audio React - Bilderstrecke
Einrichtung und Bedienung
Die Inbetriebnahme der React an einem Flat-TV ist ein Kinderspiel. Dazu wird diese idealerweise über ein HDMI-Kabel mit dem Fernseher verbunden. An diesem muss man bei Bedarf lediglich noch die externe Tonausgabe bzw. HDMI ARC aktivieren, mehr ist nicht zu tun.
Zum Streamen von Musik oder anderen Inhalten etwa von einem Smartphone, Tablet oder PC wählt man „Bluetooth“ über die Quellentaste der Fernbedienung. Nach dem Antippen bzw. Anklicken der „Polk React Sound Bar“ auf dem entsprechenden Zuspieler leuchtet die Status-LED an der Front der React blau auf, sobald die Kopplung erfolgreich abgeschlossen ist.
Um die Alexa-Sprachsteuerung zu nutzen, muss man die kostenlose Alexa-App installieren, falls nicht schon geschehen. Die Einrichtung gelingt problemlos, weil sie über die App menügeführt erfolgt. Prinzipiell ist es sehr bequem, die React verbal dazu aufzufordern, die Lautstärke zu erhöhen oder den Nacht-Modus zu nutzen. Über die Fernbedienung gelingt dies mittels Direktwahltaten aber noch schneller. Eine Stimme sagt jeweils an, welcher Sound-Modus gerade gewählt wurde. Der Steuerstab fällt etwas größer aus als Fernbedienungen im klassischen Scheckkarten-Format. Die 18 Tasten sind übersichtlich angeordnet und klar beschriftet, lassen sich allerdings recht schwer drücken. Gut: Über den Signalgeber kann man auch das Bassvolumen anpassen.
Klangeigenschaften
Welche Klangqualität kann man für rund 200 Euro erwarten? Einfache Antwort: eine solide, aber keine herausragende. Polk hat die React sehr ausgewogen konzipiert, Stimmen sind klar und lassen sich bei Bedarf noch detaillierter herausarbeiten. Präsent ist vor allem der Mittenbereich, auf kristallklare Höhen und tiefe Bässe muss man jedoch verzichten. Die React ist als Ergänzung für Einsteiger- und Mittelklasse-Fernseher zu empfehlen, hier kann sie die Akustik spürbar aufpeppen.
Die Breite der Klangbühne ist in Ordnung, das gilt auch für die Dynamik. Kompromisse muss man bei der Klarheit und der Präzision der Soundwiedergabe eingehen, in diesem Punkt haben teurere Systeme deutlich mehr zu bieten. Klassische Musik beispielsweise mit vielen unterschiedlichen Instrumenten gehört deshalb nicht gerade zur Stärke der Polk. Sie ist eher im TV-Alltag zu Hause und fühlt sich mit einem Spielfilm, Nachrichten, Sport oder einer Talkshow am wohlsten.
Wer einen Action-Blockbuster mit bebendem Tieftonfundament, plastisch herausgestellten Effekten und packender Raumfülle erleben will, muss logischerweise mehr als 200 Euro investieren. Die Polk React ist vielmehr eine preiswerte Lösung, um dem oft dürftigen Klang günstiger Flat-TVs auf die Beine zu helfen. Recht überschaubar fallen die akustischen Unterschiede der einzelnen Klang-Modi aus.
Technische Daten
Die Polk Audio arbeitet mit zwei jeweils 25 Millimeter großen Hochtönern, zwei Mitteltönern (96 x 69 Millimeter) und zwei Woofern à 110 x 100 Millimeter. Der TV-Lautsprecher unterstützt die Surround-Sound-Formate Dolby Digital sowie DTS (kein Dolby Atmos) und beim Streamen via Bluetooth eine maximale Abtastfrequenz von 48 kHz.
Spielbereit ist die React als eigenständige Soundbar oder mit den optional erhältlichen kabellosen Polk SR2 Surround-Lautsprechern und dem React Wireless-Subwoofer. Im Ensemble entsteht so ein 5.1-Surround-System.
Preis
Polk selbst verlangt für die React knapp 210 Euro. Das ist ein fairer Preis für eine vollwertige Soundbar mit Sprachsteuerung. Der Subwoofer kostet um die 118 Euro, die beiden kabellosen Rear-Speaker liegen zusammen bei 171 Euro.
Fazit
Die preiswerte Polk Audio React ist eine klanglich solide Einsteiger-Soundbar mit pfiffiger Sprachsteuerung zum attraktiven Preis. Ihre Verarbeitung überzeugt, auch das Bedienkonzept ist durchdacht. Wer keine höchsten audiophilen Ansprüche hat, kann mit dem TV-Lautsprecher sein Fernsehprogramm sowie Musik per Bluetooth akustisch ansprechend zum Leben erwecken.
Für tiefere Bässe und besseren Raumklang empfehlen wir die kabellosen Polk SR2 Surround-Lautsprecher und den React Wireless-Subwoofer – dann profitiert man von den Vorzügen eines echten 5.1-Systems, das die React klanglich um eine Stufe nach oben hebt.
Affiliate-Information
Bei den mit gekennzeichneten Links handelt es sich um Provisions-Links (Affiliate-Links). Erfolgt über einen solchen Link eine Bestellung, erhält TechStage eine Provision. Für den Käufer entstehen dadurch keine Mehrkosten.









