Clubkultur 4.0: Elektronische Tanzlokale zwischen gläsernen Kunden, Online-Booking und handgemaltem Flyer
Die Digitalisierung macht auch vor der Clubszene nicht halt. Ohne spezielle Booking-Plattformen, Messenger, soziale Medien, Chipkarten, Datenanalysen oder gar Chatbots läuft oft nichts mehr in der Disco. Doch es gibt auch Gegenbewegungen.
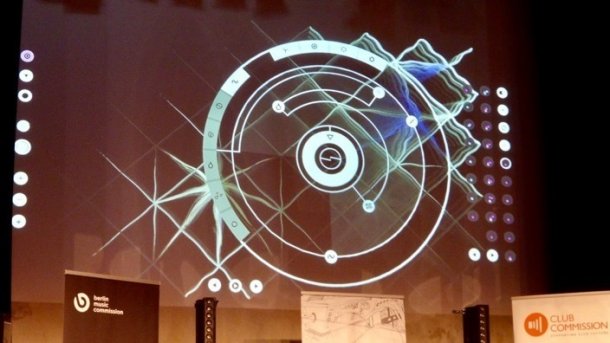
(Bild: heise online/Stefan Krempl)
"Die meisten Clubs müssen Online-Medien nutzen", weiß Jens Schwan, Macher der Szeneseite The Clubmap und Organisator des Berliner "Zugs der Liebe". Da gebe es ja auch einige Möglichkeiten, meint der Mittvierziger, der im "richtigen Leben" Online-Redakteur bei einer Autovermietung ist. "Zielgruppen targeten ist klasse, aber man muss die Werkzeuge richtig einsetzen". Wer seine potenziellen Besucher nur eingrenze auf Bands und Musikstile, verpasse damit viele Ansprachemöglichkeiten. Eher den Kopf schüttelt der Ex-Punk auch über "manche Großen" aus der Club-Branche, die für die Werbung "auf Chatbots ausweichen".
Schwan sitzt mit Basecap und Dreitagebart auf einem Panel zum Thema "Clubkultur 4.0" bei einer Konferenz des Hybrid Music Lab auf dem Gelände des neuen Erwachsenenspielplatzes Holzmarkt 25 (vormals: Bar 25) der Hauptstadt, als er die Lanze für ein sachgerechtes Online-Marketing von Tanztempeln mit elektronischer Musik bricht. Dabei spreche auch nichts dagegen, sich eine eigene Community im Netz aufzubauen, die sich Snapchat und Instagram verweigere. Trotzdem mache es Sinn zu messen, "wer den Newsletter öffnet", und beim Aussenden mit unterschiedlichen Betreffs zu experimentieren.
Warum Clubkultur 4.0?
"Was ist Clubkultur 4.0 eigentlich?", will Jacob Bilabel mitten in der Diskussion wissen. Er steckt eigentlich mittendrin in der Schnittstelle zwischen Informationstechnologie und Musik, hat mit der Green Music Initiative eine Plattform ins Leben gerufen, die eine "klimaverträgliche Musik- und Entertainmentbranche" fördern will, und mischt beim europaweiten Dachprojekt EE Music für eine "energieeffiziente und nachhaltige" Eventproduktion mit. Doch mit dem Begriff kann Bilabel nichts anfangen, hält den Status der Pole Technik- und Musikindustrie generell am besten mit der Angabe umschrieben: "Es ist kompliziert."
Lutz Leichsenring, Sprecher der Clubcommission Berlin, bemüht sich um eine Erläuterung und verweist auf die sprachliche Nähe zu Industrie 4.0 und die Tatsache, dass in Clubs verstärkt "gängige Tools und Plattformen" zum Einsatz kommen. "Vieles davon ist freie Software", weiß der Insider, sodass die Werkzeuge frei genutzt und an die eigenen Zwecke recht einfach angepasst werden könnten.
Im Rahmen der Clubcommission hat Leichsenring selbst zwei Datenportale mit auf die Beine gestellt: Clubkataster ist ein Verzeichnis für Unterhaltungsstätten mit dem Schwerpunkt elektronische Musik von der gängigen Disco bis hin zu Open-Air-Arenen. Mit Creative Footprint soll zudem sich analog zum "CO2-Fußabdruck" die Lebendigkeit des kulturellen Lebens von Städten messen lassen. Für Berlin sind dort momentan rund 500 Veranstaltungsorte aus der Clubszene eingetragen, die monatlich mindestens ein öffentlich zugängliches Event durchführen. Ziel ist es zugleich, Mittel gegen kommerziellen Druck vor allem aus der Immobilienbranche und die zunehmende "kulturelle Gentrifizierung" zu finden.
Digital ist einfach
Trotz Retrotrend zum Auflegen mit Vinylplatten arbeiten viele DJs schon seit gut zehn Jahren digital, rücken meist nur noch mit einem Songrepertoire auf einem USB-Stick bei ihrem nächtlichen Arbeitsplatz an. Musikmixprogramme wie Live von Ableton oder Final Scratch und Traktor von Native Instruments haben den klassischen Rollkoffer verdängt. Derlei Spezialsoftware erlaubt es auch, auf der Bühne in Echtzeit mit dem Laptop Musik zu machen. Man kann damit Soundelemente aufnehmen, festhalten und überspielen, Musik in kleine Schleifen ("Loops") zerlegen und am Mischpult oder direkt im Mobilrechner individuell wieder aneinander fügen. Als schier unendliches digitales Archiv steht Soundcloud zur Verfügung.
(Bild: heise online/Stefan Krempl)
Für die "Visuals", die Elektrobeats in den Clubs mit Projektionen fürs Auge ergänzen, taucht ebenfalls kaum einer der Bildkünstler mehr ein in einen Berg von VHS-Kassetten: Laser, Pixel-Stripes und LEDs werden längst vom Computer gesteuert, die Bilderflut darin erzeugt.
Inzwischen gibt es aber auch Softwarelösungen, mit der sich schier die ganze Organisationsarbeit in einem Club digitalisieren lässt. Book me Tender etwa ist ein Web-Dienst, der Werkzeuge für das Booking von DJs, Musikern oder Bands sowie für das "Beziehungsmanagement" mit den Künstlern und für die rollenbasierte Interaktion mit Besuchern kombiniert mit einem Online-Kalender. Optionale Funktionen seien das "Kostenmanagement für Events mit Break-Even-Kalkulation", eine Gästeliste "analog oder auf dem iPad" oder die Schichtplanung für Mitarbeiter, erklärt Christian Schmidt von dem gleichnamigen Startup. Letztlich könne so ein mittelgroßer Tanzschuppen ab 80 Euro monatlich schier die "Lebenszeit" einzelner Partys oder des ganzen Hauses sichtbar machen.
Keine Eigenwerbung nötig
Andere Plattformen haben sich darauf spezialisiert, Event-Promoter und DJs zusammenzubringen und das Booking online zum Kinderspiel zu machen. "Wir verknüpfen Profile", streicht Eelke Arjaans, Mitgründer des Amsterdamer App-Diensts Bookya, dessen Vorteile heraus. Ein Künstler müsse so "nicht mehr lang erklären, was er schon alles gemacht hat", seine Booking-History könne von Clubmachern direkt oder Vermittlern sofort abgerufen werden. Solche Werkzeuge vermittelten eine gute Übersicht über das Angebot auf dem Markt, ergänzt Steffen Rudnik von Gigmit. "Wir vermitteln 2500 Gigs jeden Monat." Kritiker wenden ein, dass durch die neue Transparenz und die Nähe zum "Clickworking" auch die Preise gedrückt würden. Rudnik spricht aber von einem "Problem für sich", dass die Löhne teils so niedrig sind. Auf der Plattform finden sich durchaus Angebote, bei denen für einen DJ pro Auftritt nicht mehr als 150 Euro herausspringen.
Das dicke Rolodex eines allmächtigen Agenten verliere an Wert, der Booker als alleiniger Gatekeeper an Bedeutung, kann Annika Weihrich von Fling.fm den Portalen auch Gutes abgewinnen. Früher sei es oft schwer gewesen, überhaupt mit den Künstlervermittlern ins Gespräch zu kommen, was aber schon durch Myspace als Facebook-Vorläufer einfacher geworden sei. Nun komme noch mehr "Demokratie in den Markt".
Marc Lankreijer von AMS Bookings sieht seinen Job aber trotzdem nicht in Gefahr. "Ich kenne die Clubs alle von innen", weiß er sich eines guten Werbearguments sicher. Er habe nichts gegen die Sharing Economy oder einen offenen Austausch von Kontakten über spezielle Messenger wie Slack in westlichen Ländern oder WeChat in China: "Aber am Ende zählt die persönliche Verbindung." Susanne van Maanen von der Agentur Komm schon Alter sieht ebenfalls noch keinen Grund, vor der günstigeren Online-Konkurrenz zu kapitulieren. Ihre Erfahrung: "Es ist schwer, in Roboterart über einen Künstler zu reden." Musik sei ein emotionales Geschäft. Datenanalysen könnten zwar zeigen, "wer populär ist". Sie selbst sei aber ein "altmodisches Mädchen" und bevorzuge den menschlichen Kontakt und das Telefon.
Gläsern Tanzen
Leichsenring will es mit Big Data in der Clubszene auch nicht übertreiben, warnt vor der Gefahr des "gläsernen Gasts". Vor allem Festivals arbeiteten mittlerweile mit Chipkarten, was gerade für die Betreiber Vorteile bei der Abrechnung von Getränken und Speisen mit sich bringe, die Kunden aber durchsichtig mache. Er selbst sei in Brasilien erst in einen Club gekommen, nachdem er an der Tür seinen Pass habe einscannen lassen. So etwas sei grenzwertig. Auch Modellversuche für eine Art "DJ-Monitor" oder "Verwertungsboxen", die aufzeichnen, was an einem Abend gespielt wird, hätten Vor- und Nachteile. Es sei zwar zu begrüßen, dass so im Fall der Fälle "nicht Dieter Bohlen wieder die Kohle kriegt von der Gema". Andererseits müsse es aber ein Betriebsgeheimnis auch bei der Kunstproduktion im digitalen Zeitalter geben.
Mike Riemel, der Veranstaltungsflyer als Mediengattung untersucht und schon die ein oder andere Technoparty organisiert hat , sieht "Musik-Tracking" und eine allzu offene Clubkultur ebenfalls sehr skeptisch. "In Israel sind 3000 Leute mit einem Schlag ins Gefängnis gewandert, weil sie staatsgefährdende Goa-Musik verbreiteten", gibt er zu bedenken. Auch politische Freiräume, die oft mit Musik zu tun hätten, drohten wegzubrechen.
"Wir zeigen weltweit die Vielfalt, die Schönheit des Clublebens", hält Michail Stangl dagegen, der das Portal Boiler Room in Deutschland betreut, auf dem Videos und Live-Übertragungen von DJ-Gigs im Mittelpunkt stehen. Er hält es für "grandios, wenn Clubs bereit sind, ihre Petrischale mit der Welt zu teilen". in vielen Teilen der Welt gebe es schließlich gar keine Chance, jemals einen großen Meister an den Plattentellern vor Ort zu erleben. Die Aufnahmen gäben der elektronischen Kultur so eine Lobby, ohne jedoch physikalische Schutzräume aufzubrechen: "Wir zerren nichts ans Licht, was noch keiner kennt."
Stangl kann aber trotzdem verstehen, dass viele Betreiber "nicht mit uns zusammenarbeiten wollen". Manche Veranstalter seien darauf aus, "den ganzen Hedonismus zu zeigen", andere hielten dies für kontraproduktiv. Letztlich sei es vor allem so ein "Berliner Ding", Clubs nicht für die Online-Welt öffnen zu wollen: in der Hauptstadt gebe es einfach zu viele davon, da könne man sich das leisten.
Back to the Roots
Jakob Turtur gehört zu denjenigen, die den Boiler Room zwar prinzipiell als "Botschafter des Technos" gut finden, seine unter dem Namen "Jonny Knüppel" teils in einer rechtlichen Grauzone in leerstehenden Häusern oder Kellern stattfindenden Tanz-Happenings aber niemals dort übertragen wissen wollte. Er besetzt gemeinsam mit einer überschaubaren Anzahl anderer Berliner Veranstalter die Nische "intim, versteckt", verwaltet das Erbe der Underground-Kultur mit. "Data Crunching" könne Spaß machen, findet er, "aber bin froh, dass wir das nicht machen müssen".
Turtur und sein Team setzen auf den Gegentrend zu 4.0, wollen bald an einem Punkt sein, wo sie selbst auf die derzeit noch ab und an aktivierte Facebook-Werbung verzichten können: "Wir schreiben handschriftlich Briefe, das sind Unikate, die wir den Leuten auf Partys in die Hand drücken". Bei dieser Form der Publikumsansprache handle es sich um eine "ganz persönliche Angelegenheit". Back to the Roots, lautet das Motto, zurück zu den Zeiten etwa des legendären, mehrfach umgezogenen WMF in denen das Wort Club im Sinne des traditionellen englischen Vorbilds als abgeschlossener Mitgliedszirkel verstanden wurde.
"Wir wollen auch weniger Arbeit haben", schielt Turtur zwar doch auf einen gewissen Grad der Digitalisierung im Bereich Organisation. Er glaubt aber, dass es schon einen Unterschied macht, "ob wir eine offene Ladenkasse oder ein Display haben". Mit letzterem werde das Kassieren am Eintritt "etwas unrealer". Ein technisch perfekt und auf Effizienz getrimmter Clubablauf ist nicht sein Ding: Der Mensch fühle sich "in einem solchen Raum nicht mehr wohl" und "auf ein Konsumobjekt degradiert", wenn er nur noch durch eine Maschinerie gehe. Für die Knüppel-Reihe habe man auch ein Fotoverbot einführen müssen, weil Gäste angefangen hätten, sich in die Untergrund-Locations auf Facebook und Co. einzuchecken. Dies habe sogar Strafandrohungen zur Folge gehabt, da "das Amt mittlerweile auch Computer und Internetanschluss hat". (mho)