Wissenschaftler: "Tablets und Laptops machen die Kinder dümmer"
Über 40 Forscher rund um die Gesellschaft für Bildung & Wissen fordern ein Moratorium der Digitalisierung an Schulen und Kitas. KI dürfe Lehrer nicht ersetzen.
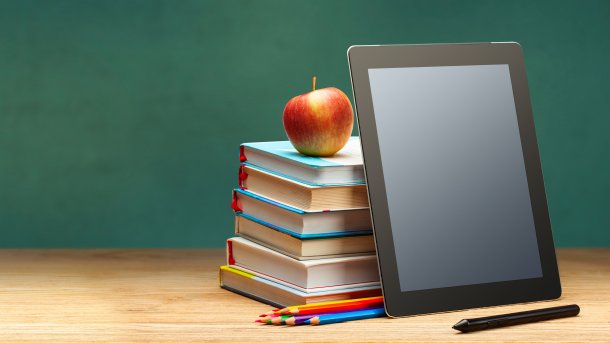
(Bild: ADragan/ Shutterstock.com)
Mitten während der Verhandlungen über eine Neuauflage des Digitalpakts Schulen von Bund und Ländern verlangen über 40 Forscher aus Deutschland, Österreich und der Schweiz einen vorübergehenden Stopp der Digitalisierung an Schulen und vorschulischen Bildungseinrichtungen wie Kitas. Ein solches Moratorium insbesondere bis zur 6. Klasse sei nötig, da sich die wissenschaftlichen Hinweise "auf enorme Nachteile und Schäden für die Entwicklungs- und Bildungsprozesse von Kindern und Jugendlichen durch digitale Medien" verdichteten. Die Schutzbefohlenen hätten "nur ein Leben, nur eine Bildungsbiografie und wir dürfen damit nicht sorglos umgehen", heißt es in einer unter der Woche veröffentlichten Petition der Gesellschaft für Bildung und Wissen an die Kultusminister.
Digitale Bildung schadet Kindern
"Die wissenschaftliche Erkenntnis ist inzwischen, dass Unterricht mit Tablets und Laptops die Kinder bis zur 6. Klasse nicht schlauer, sondern dümmer macht", begründet der Offenburger Medienpädagoge Ralf Lankau die Initiative. Er gehört neben weiteren Koryphäen wie dem Ordinarius für Schulpädagogik Klaus Zierer sowie den Medizinern Manfred Spitzer und Thomas Fuchs zu den Erstunterzeichnern des Gesuchs. Lankau verweist auf aktuelle Studien, die "negative gesundheitliche, psychische und soziale Wirkungen durch den vermehrten Einsatz digitaler Geräte im Unterricht" belegten. Der "Versuch des digitalen Unterrichts" müsse gestoppt werden. Die Petenten monieren etwa, dass an Schulen "immer mehr Datenverarbeitungssysteme" verwendet würden, "die als 'Künstliche Intelligenz' (KI) automatisiert beschulen und testen sollen". Dabei habe zuletzt die Corona-Pandemie das Scheitern solcher Ersatzsysteme belegt.
Die skandinavischen Länder seien Vorreiter bei der Digitalisierung von Bildungseinrichtungen gewesen, schreiben die Forscher. Doch die schwedische Regierung habe in diesem Jahr die Entscheidung ihrer Vorgänger korrigiert, bereits Vorschulen des Landes verpflichtend mit digitalen Geräten auszustatten. Grund für das Umdenken sei ein Professoren-Gutachten des renommierten Stockholmer Karolinska-Instituts. Die behaupteten positiven Befunde digitaler Bildung sind demnach nicht belegbar. Dem ständen "große, negative Auswirkungen auf den Wissenserwerb der Schüler" entgegen. Ziele wie Bildungs- und Chancengerechtigkeit, Unterrichtsverbesserung und gesellschaftliche Teilhabe seien nicht erreicht worden. Vielmehr behinderten Bildschirmmedien bei kleinen Kindern das Lernen und die Sprachentwicklung. Sie könnten zu Konzentrationsschwächen führen und die körperliche Aktivität verdrängen.
Videos by heise
IT in Bildungseinrichtungen "aus wirtschaftlichen Interessen"
Auch die Deutsche Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ) hat 2023 Leitlinien herausgegeben. Darin empfiehlt sie, Bildschirmzeiten zu reduzieren. Kinder sollten zudem keine einschlägigen eigenen Geräte und vor allem keinen unkontrollierten, unbegleiteten Zugang zum Internet erhalten. Die Experten verweisen ferner etwa auf eine Studie der obersten US-Gesundheitsbehörde aus diesem Jahr, wonach junge Menschen von digitalen Medien stark beeinflusst und abhängig werden. Immer längere Nutzungszeiten und ein frühes Einstiegsalter förderten Körperunzufriedenheit, gestörtes Essverhalten, Schlaf- und Konzentrationsstörungen, geringes Selbstwertgefühl und Depressionen.
Branchenverbänden wie dem Bitkom, die immer wieder einen großen Nachholbedarf an Schulen bei der Digitalisierung bemängeln und für einen Digitalpakt 2.0 trommeln, halten die Wissenschaftler den globalen Ausbildungsüberblick 2023 der Unesco entgegen. Bei aktuellen IT-Konzepten für Bildungseinrichtungen stehen demnach nicht das Lernen und der pädagogische Nutzen im Mittelpunkt, sondern wirtschaftliche Interessen. Laut der Petition ist es daher "dringend notwendig, die einseitige Fixierung auf Digitaltechnik in Kitas und Schulen zu revidieren". Es gelte, in der geforderten Pause "interdisziplinär und wissenschaftlich fundiert" mit Fokus auf Entwicklungs-, Lern- und Bildungsprozesse über IT und KI in Bildungseinrichtungen zu diskutieren.
Kritiker wie der Schweizer Informatik-Didaktiker Beat Döbeli Honegger geben zu bedenken, dass unter den Erstunterzeichnenden des Positionspapiers mehrere Personen seien, "die bereits früher durch unwissenschaftliche, tendenziöse oder polemische Aussagen und Publikationen aufgefallen sind". Viele forschten zudem nicht mehr aktiv. Die Ersteller der Petition zögen auch teils falsche Schlüsse aus zitierten Studien oder gäben diese inkorrekt wieder. So empfehle die Unesco etwa, eine Altersgrenze für die unbeaufsichtigte Nutzung allgemeiner KI-Werkzeuge wie Chatbots festzulegen.
(tiw)