Science Fiction: Weißmalerei
Viele SF-Werke zeichnen ein düsteres Bild von der Zukunft. Aber müssen neue technische Möglichkeiten wirklich zu Unterdrückung und totaler Kontrolle durch Staaten oder Unternehmen führen?
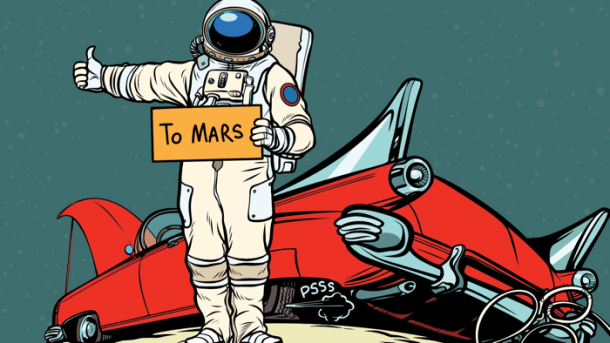
(Bild: Studiostoks/Shutterstock)
- Jens Lubbadeh
Was wäre, wenn doch alles gut wird? Jens Lubbadeh hat sich drei bekannte Romane vorgenommen und ihre Geschichten umgeschrieben. Lubbadeh ist Journalist und Schriftsteller. Sein neuester Roman "Neanderthal" spielt in einer Zukunft, in der es keine Krankheiten mehr gibt – Verbrechen aber durchaus.
George Orwell: 1984
Es war ein strahlend kalter Apriltag, und die Uhren schlugen dreizehn. Winston Smith, das Kinn an die Brust gezogen, um dem scheußlichen Wind zu entgehen, schlüpfte rasch durch die Glastüren der Victory-Mietskaserne, doch nicht rasch genug, um zu verhindern, dass mit ihm auch ein grießiger Staubwirbel hereinwehte. Am Ende des Flurs hing ein riesiges Plakat. Es zeigte das Gesicht eines 45-jährigen Mannes mit wuchtigem schwarzen Schnurrbart und kernigen, ansprechenden Zügen. Es war eines jener Bilder, die einem mit dem Blick überallhin zu folgen schienen. DER GROSSE BRUDER SIEHT DICH, lautete die Textzeile darunter.
Winston lächelte, als er das Gesicht sah, es hing fast überall. Dem Großen Bruder verdankte Mrs. Parsons ihr Leben. Sie wohnte gegenüber, allein. Die 113-Jährige hatte ihre beiden Kinder überlebt, und obwohl sie allein war, passte der Große Bruder auf sie auf. Er hatte durch ihren Televisor gesehen, als Mrs. Parsons letzte Woche gestürzt war und hilflos am Boden lag. Sofort kam eine Ambulanz, sonst hätte sie wohl stundenlang allein in ihrer Wohnung gelegen. Winston kam immer sehr spät von der Arbeit.
Der Große Bruder war keine Person, kein Politiker, er stand sinnbildlich für die Idee, dass sich jeder um jeden kümmerte: Bürger um Mitbürger, Bürger um den Staat, der Staat um den Bürger. Das war wahrer Sozialismus oder in Neusprech: doppelplusguter Deusoz. Neusprech war eine von der Dudenkommission beaufsichtigte kontrollierte Vereinfachung der Sprache, die bildungsschwachen Mitbürgern die Teilnahme am täglichen Leben einfacher machen sollte.
Winston arbeitete im Ministerium für Wahrheit (Miniwahr in Neusprech). "2 + 2 = 4" stand in großen Lettern über dem Eingang. Winston arbeitete als Verifikator, ein hoch angesehener Beruf. Seine Aufgabe war die Korrektur von Unwahrheiten und Fake-News im Netz, sein Ministerium war eine wichtige Säule, um den sozialen Frieden in Ozeanien zu bewahren – genauso wie die Idee des Doppeldenk, das schon Schülern beigebracht wurde. Es bedeutete, einen Sachverhalt, eine Meinung immer als Pro und Contra zu denken, Argumente dafür und dagegen zu berücksichtigen. Doppeldenk steigerte die Empathiefähigkeit und verhinderte Filterblasen.
Die vier Ministerien arbeiteten eng zusammen, neben Miniwahr gab es noch Minipax, Minifülle und Minilieb, die Ministerien für Frieden, Überfülle und Liebe. Minipax kuratierte den äußeren Frieden: Ozeanien war neben Eurasien und Ostasien eines der drei großen Staatenbündnisse der Welt, bald würde es nur noch zwei geben, die Gespräche mit Eurasien schritten voran. Die Metastaaten hatten ein beherztes Unterbinden von nationalen Kriegen sehr viel einfacher gemacht und das Ideal einer Weltregierung näherrücken lassen.
Winston liebte den Großen Bruder, diese große soziale Idee, genauso wie er seine Freundin Julia liebte. Kennengelernt hatte er sie über Minilieb, das Ministerium sorgte dafür, dass sich in Ozeanien alle elf Minuten jemand verliebte. Es half auch bei der Organisation der Hochzeit, kuratierte die Ehe und vermittelte in Krisenzeiten. Nach Jahrzehnten des privatwirtschaftlichen Datings, das eine konsumistische Einstellung gegenüber Beziehungen befördert hatte, waren die Scheidungsraten und die Anzahl der Single-Haushalte drastisch gesunken.
Privates und berufliches Glück sollten jedoch Hand in Hand gehen, das war die Aufgabe von Minifülle, dem vierten Ministerium. Seitdem es Arbeit und Einkommen entkoppelt und vor dreißig Jahren das bedingungslose Grundeinkommen eingeführt hatte, war es in Ozeanien nicht mehr zu Ausschreitungen gekommen. Der Bürokratieabbau hatte das Grundeinkommen finanzierbar gemacht. Die Menschen hatten nun wieder mehr Zeit, für sich selbst, für ihre Partner, ihre Kinder und gute Bücher.
Ray Bradbury: Fahrenheit 451
Es war eine Lust, Feuer zu legen. Es war eine Lust zu sehen, wie etwas verzehrt wurde, wie es schwarz und zu etwas anderem wurde. Das gelbe Strahlrohr in der Hand, die Mündung dieser mächtigen Schlange, die ihr giftiges Kerosin in die Welt hinausspie, fühlte er das Blut in den Schläfen pochen, und seine Hände waren die eines erstaunlichen Dirigenten, der eine Symphonie des Sengens und Brennens aufführte.
So viele Bücher auf einem Haufen hatte der Feuerwehrmann Guy Montag schon lange nicht mehr gesehen. Werke von Kafka, Goethe, Steinbeck, Orwell, Roth… Dutzende gedruckter Bücher, darunter viele alte Ausgaben, sie mussten jahrzehntelang illegal in Privatbesitz versteckt worden sein. Hauptmann Beatty und er hatten sie alle aufgeschichtet, und nun brannten sie wie ein Scheiterhaufen, und die knisternden, sich im Feuer windenden Seiten schickten glühende Funken durch die nächtliche Luft wie kleine verzweifelte Rettungsbojen. Plötzlich hörte Montag ein Sirren neben sich, dann erkannte er das metallische Tapsen des mechanischen Hundes. In seinem Maul hatte er ein Buch. Montag entriss es ihm: Auf dem Umschlag war ein großer Käfer abgebildet, Franz Kafka, "Die Verwandlung" stand darauf. Montag erinnerte sich, er hatte das Buch als Fernsehserie gesehen. Sie hatte ihm gefallen. Er warf es zu den anderen in die Flammen.
Im Schein des Feuers sah er das traurige Gesicht der alten Frau, der die Bücher gehört hatten. Mitgefühl regte sich in ihm, obwohl er wusste, dass das Recht auf seiner Seite war. "Es tut mir leid", sagte er zu ihr, "aber privater Besitz von Büchern ist verboten. Das wissen Sie doch." Sie sah ihn nur regungslos an. Es wunderte ihn, dass manche Menschen noch immer nicht verstanden hatten, dass Bücher – oder besser gesagt, ihr Inhalt – eine Allmende waren, ein Kollektivgut, das allen gehörte. Ihr Platz war in Bibliotheken und Schulen, sie sollten nicht weggeschlossen sein in Privatbesitz. Nie wieder sollte Reichtum über Bildung entscheiden dürfen. Das war es, worüber Montag und seine Kollegen von der Feuerwehr wachten. Selbst wenn es bedeutete, paradoxerweise Bücher vernichten zu müssen.
Es ging nicht um die Bücher an sich. Es ging um das, was sie transportierten: Geschichten, Gedanken, Ideen, Meinungen. Die Form war nicht so wichtig wie der Inhalt. Ob er nun getragen wurde von Text, Ton oder Bild, spielte keine Rolle. Montag lebte in Zeiten, wo das Bild das Wort als das dominierende Medium abgelöst hatte. Das konnte man bedauern, aber es hatte auch sein Gutes. Bücher zu lesen kostete sehr viel Zeit. Zeit, die fehlte für Freundschaften, Familie oder die Arbeit. Und das Format Buch stand auch noch immer sinnbildlich für ein Klassensystem, an deren Spitze sich früher Privilegierte aus höheren sozialen Schichten befanden. Jetzt standen jedem alle Bücher offen, unabhängig von seiner sozialen Herkunft und seinem Bildungsgrad. Und wer nicht den Intellekt, die Sprache oder die Zeit besaß, um zu lesen, für den hatten Netflix und Amazon längst alle Klassiker der Weltliteratur als Serie herausgebracht: "Don Quijote", "Faust", "Die Odyssee", "Robinson Crusoe", "Moby Dick", "Das Kapital", "Ulysses", "Krieg und Frieden", "Der alte Mann und das Meer", "Pippi Langstrumpf", "Der Zauberberg", "1984"... Das alles konnte man bequem im Fernsehen sehen.
Die alte Frau würde den Verlust von ein paar Büchern überleben, dachte Montag. Er hatte jetzt Feierabend und freute sich schon auf die neue Netflix-Serie "Fahrenheit 451". Er hatte gehört, dass sie auf einem guten Buch basierte.
Dave Eggers: The Circle
Wahnsinn, dachte Mae. Ich bin im Himmel. Das Gelände war riesig und weitläufig, ein wildes pazifisches Farbenmeer und doch bis ins kleinste Detail sorgfältig geplant, von überaus gewandten Händen geformt.
An diesem sonnigen Montag im Juni blieb Mae vor dem Haupteingang stehen, über dem das in Glas geätzte Firmenlogo prangte. Das Unternehmen war noch keine sechs Jahre alt, doch sein Name und Logo – ein Kreis um ein engmaschiges Gitter mit einem kleinen "c" für "Circle" in der Mitte – zählten bereits zu den bekanntesten der Welt.
Geschafft hatte The Circle das mit einer so einfachen wie genialen Applikation: TruYou – sie gab jedem Internetnutzer eine unverwechselbare Identität im Netz. TruYou fasste sämtliche Social-Media-Profile, E-Mail-Konten, Zahlungssysteme und Identitäten eines Nutzers zusammen, "ein einziger Button für den Rest deines Onlinelebens" – das war das Versprechen, und The Circle hielt es. Nun war endlich Schluss mit den unzähligen Passwörtern, die sich keiner merken konnte. Schluss mit den nervigen Captchas, die beweisen sollten, dass man kein Roboter war. Schluss mit Kreditkartennummern, die jederzeit gehackt werden konnten. "Ein Konto, eine Identität, ein Passwort, ein Zahlungssystem pro Person", das war TruYou, und es funktionierte. Auch Mae hatte längst ein TruYou-Konto, wie mittlerweile drei Milliarden andere Menschen – fast die halbe Weltbevölkerung.
Und nun würde Mae tatsächlich hier arbeiten, bei dem Konzern, von dem immer mehr sagten, dass er mit TruYou einen entscheidenden Webfehler des Netzes repariert hatte: die Anonymität. Natürlich hatten viele Kritiker gewarnt, dass dies die Freiheit des Netzes zerstören würde, hatten gewarnt vor der totalen Überwachung. Als wenn die im NSA-Zeitalter nicht schon längst Realität war. Warum sollten für das Internet Sonderregeln gelten? Im realen Leben war man ja auch identifizierbar und für seine Worte und Taten verantwortlich.
Der Erfolg gab den Befürwortern recht: All die negativen Auswüchse, die das Netz zu einem immer nervigeren, unappetitlicheren Ort gemacht hatten, Fake-News, Hate Speech, gekaufte Trolle, Hetz-Bots und Wahlkampfmanipulationen verschwanden quasi über Nacht. Diskussionen auf Twitter, Facebook, in Foren wurden endlich wieder zivilisiert, so wie Menschen es ja meistens auch waren, wenn sie sich persönlich begegneten.
Wer es wollte, konnte sich immer noch anonym bewegen. Ihm standen VPN-gesichert Chaträume, Mailprogramme oder Foren zur Verfügung, er konnte sich im Darknet tummeln. Wie im echten Leben gab es auch im Netz noch verborgene Hinterhöfe und dunkle Ecken. Aber ihre Reichweite war begrenzt, die Teilnehmer blieben mehr oder weniger unter sich. Wer in die Öffentlichkeit wollte, musste TruYou nutzen. Ein breites Publikum mit Lügen und Hetzerei zu erreichen war unmöglich.
Aber TruYou hatte noch Webfehler. Im realen Leben wurde vieles vergessen. Im Netz konnte alles, was man je gepostet hatte, gesammelt und für alle Zeit gegen einen verwendet werden. Und im realen Leben lief man nicht ständig mit Namensschild herum, so wie auf Facebook und Twitter und Instagram. Eine von Maes Aufgaben bei The Circle würde es sein, die digitale Öffentlichkeit so wie die des echten Lebens zu gestalten.
Und sie wusste auch schon wie: Sie würde TruYou mit einer Vergessen-Funktion ausstatten. Nutzer konnten auf ihrem TruYou-Account alle Beiträge, die sie unter ihrer Netz-ID veröffentlicht hatten, einsehen. Jeder persönliche Beitrag würde nach wenigen Monaten von selbst verschwinden, es sei denn, der Nutzer schaltete ihn aktiv auf dauerhaft. Man konnte Beiträge auch vor Suchmaschinen verstecken. Denn warum sollte das Netz gnadenloser sein als das reale Leben? Und Mae würde anregen, dass ihr Arbeitgeber die Verwaltung von TruYou freiwillig abgibt. Denn warum sollte ein privater Konzern das tun, was den Staaten vorbehalten war: Ausweise auszustellen?
(jlu)