Das autonome Material-Labor
Mit künstlicher Intelligenz und Robotik konstruiert und testet ein Start-up neue Verbindungen. Das System soll bessere Materialien für Medizin und Elektronik entstehen lassen.
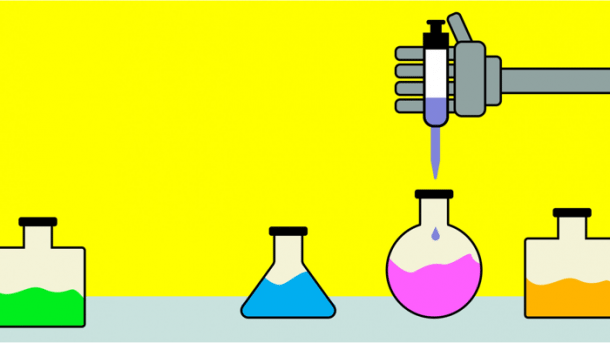
(Bild: MS. TECH)
- Will Knight
Ein Roboter-Arm taucht eine Pipette in eine Petrischale und überträgt eine winzige Menge Flüssigkeit in einen der vielen Behälter vor ihm. Als alle Proben fertig sind, testet eine zweite Maschine ihre optischen Eigenschaften. Die Ergebnisse laufen in einen Computer ein, der den Arm steuert. Software analysiert die Daten, formuliert Hypothesen und lässt den Prozess von neuem beginnen. Menschen werden kaum gebraucht.
Materialwissenschaft revolutionieren
Das System, entwickelt von einem Start-up namens Kebotix, lässt erkennen, wie Maschinenlernen und Roboter-Automation in den kommenden Jahren die Materialwissenschaft revolutionieren könnten. Kebotix will neue Verbindungen finden, die Schadstoffe aufnehmen, resistente Pilzinfektionen bekämpfen oder effizientere Optoelektronik ermöglichen sollen. Die Software des Unternehmens lernt aus 3D-Modellen von Molekülen mit bekannten Eigenschaften.
Software-Algorithmen werden bereits genutzt, um chemische Verbindungen und Materialien zu entwickeln, aber der Prozess ist langsam und ungenau. Meist testet eine Maschine schlicht leichte Variationen eines Materials und sucht blind nach einer gelungenen neuen Kombination. Maschinenlernen und Robotik aber könnten den Prozess viel schneller und effektiver machen. Kebotix ist eines von mehreren Start-ups, die diese Idee verfolgen.
Maschinenlernen für neuartige Verbindungen
Das Ziel ist, mittels Maschinenlernen Material-Kandidaten zu generieren. „Die Entdeckung dauert zu lange“, sagt Jill Becker, CEO von Kebotix. „Man hat eine Idee für ein Material, man versucht es zu produzieren, man testet es. So werden nur wenige Ideen getestet, mit noch weniger Ergebnissen.“
Kebotix nutzt Maschinenlern-Methoden, um neuartige chemische Verbindungen zu konstruieren. Molekulare Modelle von Verbindungen mit wünschenswerten Eigenschaften werden in ein neuronales Netz eingegeben, das eine statistische Abbildung dieser Eigenschaften erlernt. Anschließend kann der Algorithmus neue Beispiele entwickeln, die demselben Modell entsprechen.
Außerdem nutzt Kebotix ein weiteres Netzwerk, um Entwürfe auszusieben, die zu weit vom Original abweichen und deshalb wahrscheinlich nutzlos sein werden. Anschließend testet das Roboter-System die verbleibenden chemischen Strukturen. Die Ergebnisse dieser Experimente können wieder in die Maschinenlern-Schleife eingespeist werden, damit sie den gewünschten Eigenschaften immer näher kommt. Das Unternehmen bezeichnet sein Gesamtsystem als „autonomes Labor“.
Autonomes Labor: Menschen werden kaum gebraucht
Laut Christoph Kreisbeck, Chief Produkt Officer des Unternehmens, will es zunächst an Molekülen für elektronische Anwendungen arbeiten und sich dann neuen Polymeren und Legierungen zuwenden.
„Die KI sagt voraus und plant, was als Nächstes geschieht. Das Roboter-System testet unser neues Molekül dann sehr schnell“, sagt Kreisbeck. „Die Maschine kann aus der Datenbank lernen und in der nächsten Runde eine bessere Entscheidung treffen.“
Gegründet wurde Kebotix von Forschern am Labor von Alán Aspuru-Guzik, der in diesem Jahr von der Harvard University zur University of Toronto gewechselt ist. Kebotix, angesiedelt bei der MIT-Wagniskapitalfirma The Engine, hat vor kurzem fünf Millionen Dollar Startfinanzierung erhalten. Angeführt wurde die Runde von One Way Ventures, einer Gesellschaft, die sich auf die Finanzierung von eingewanderten Unternehmern spezialisiert hat. Alle Mitglieder des Gründungsteams von Kebotix sind Einwanderer in die USA.
Qualität der Daten entscheidend
Klavs Jensen, Industriechemie-Professor am MIT, leitet ein Labor, das ebenfalls mit automatisierten Ansätzen versucht, nützliche neue Chemikalien zu produzieren, unter anderem mit Maschinenlernen und Robotik. Das Problem bei solchen Methoden sei, so erklärt er, dass sie enorme Datenmengen benötigen, was die Sammlung zeitaufwendig und schwierig mache. Je komplizierter die Materialien werden, desto höher werde der Aufwand. „Man kann definitiv viel machen“, sagt Jensen, „aber wie bei allem anderen ist die Qualität der Daten entscheidend.“
Auch in der Materialforschung wird Automatisierung zunehmend Verbreitung finden, wie in der Pharma-Industrie, sagt Jensen voraus. „Sie wird Experten nicht ersetzen, aber man wird in der Lage sein, sehr viel schneller zu arbeiten.“
(sma)