Dr. Watson weiß nicht weiter
Mit künstlicher Intelligenz wollte IBM die Medizinbranche aufmischen. Das klappte nicht wie gedacht. Eine Geschichte darüber, wie sich eine neue Technologie am Gesundheitssystem die Zähne ausbeißt.
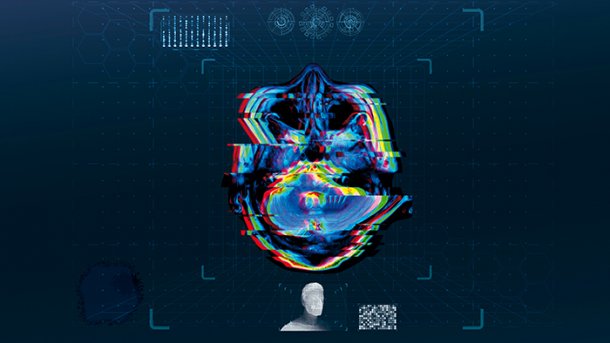
(Bild: Grafik: Shutterstock)
- Christian Honey
Hochmut kommt vor dem Fall. Fragt sich nur, wer der Hochmütige in dieser Geschichte ist. „Schätze aus dem Datendschungel heben“ – das war der Plan, den IBM und das Deutsche Krebsforschungszentrum (DKFZ) auf der Cebit 2011 angekündigt hatten. Watson, IBMs künstliche Intelligenz, sollte maßgeschneiderte Krebstherapien in den Bergen ärztlicher Befunde aufspüren, die am DKFZ lagern. Doch wie im vergangenen Jahr bekannt wurde, lief der Rahmenvertrag ganz ohne Ergebnis aus. Das Projekt habe „nie richtig begonnen“, erklärt die Presseabteilung des DKFZ auf Anfrage. Bei IBM will man „nicht schon wieder“ über Heidelberg sprechen.
Dabei ist Heidelberg kein Einzelfall. Auch am Universitätsklinikum Gießen-Marburg sollte Watson Ärzten als virtueller Experte zur Seite stehen, in diesem Fall bei der Diagnose seltener Krankheiten. Losgehen sollte es im Februar 2016. Doch auch dieses Projekt endete vorzeitig, im September 2017. „Die Performance war inakzeptabel, das medizinische Verständnis bei IBM nicht da“, sagte Stephan Holzinger, CEO der Rhön-Klinikum AG, zu der die Uniklinik gehört, dem „Spiegel“ im August 2018.
Woran war Dr. Watson gescheitert? Lag der Hochmut wirklich nur bei IBM und seinen werbewirksamen Versprechen? Oder auch bei einem medizinischen System, das sich nach wie vor nicht von Computern helfen lassen will – trotz gegenteiliger Beteuerungen? Wie sich zeigt, ist die Geschichte von Dr. Watson auch eine über die lahmende Digitalisierung des deutschen Gesundheitssystems.
„Um Algorithmen in der Medizin anzuwenden, braucht man geeignete Daten“, sagt Peter Gocke, Chief Digital Officer an der Charité Universitätsmedizin Berlin. „Idealerweise müssten die irgendwo zentral im immer gleichen Format abgelegt sein.“ Dann hätten Algorithmen eine Chance, daraus etwas Sinnvolles zu lernen. „Das hat sich in der Radiologie als segensreich erwiesen“, sagt Gocke. „Da waren die Bilddaten so standardisiert, dass man sie auf Workstations verschiedenster Hersteller lesen und bearbeiten konnte.“
Mehrere Studien der vergangenen Jahre zeigten, dass künstliche Intelligenzen aus guten Daten medizinisch korrekte Schlüsse ziehen können. Die Forschungsgruppe um Sebastian Thrun von der Stanford University etwa hat ein neuronales Netz auf rund 130000 Bildern von Leberflecken trainiert, Hautkrebs zu erkennen. Mit beachtlichem Erfolg: Die Erkennungsrate des neuronalen Netzes stand der von 21 Dermatologie-Experten in nichts nach. Von einer vergleichbaren Leistung berichtete jüngst eine Forschergruppe vom Massachusetts General Hospital der Harvard University. Im Oktober 2018 zeigten sie im Fachjournal „Radiology“, dass ihr neuronales Netzwerk Brustkrebs so gut auf Röntgenbildern erkennt wie geübte Radiologen. Heute wird diese künstliche Intelligenz standardmäßig im Klinikalltag des Massachusetts General Hospital eingesetzt.
Doch die Radiologie ist bisher die große Ausnahme. Gocke weiß aus seiner jahrelangen Tätigkeit am Universitätsklinikum Essen, dass medizinische Daten noch heute in den meisten Fällen ungeeignet sind, um Algorithmen wie Watson damit zu füttern. „Wir Ärzte haben die Daten ja nie im Hinblick auf eine maschinelle Weiterverarbeitung erhoben und gespeichert“, sagt er. Bis heute liegen sie überwiegend unstandardisiert, teils handschriftlich in den Aktenordnern und auf den Festplatten der deutschen Praxen und Kliniken.
(rot)