FOSDEM: Open-Source und das große Geschäft
Open-Source-Lizenzen schließen nicht aus, mit Software Geld zu verdienen. Ein FOSDEM 22-Beitrag stellt Gemeinschaften von Big Tech und freien Projekten infrage.
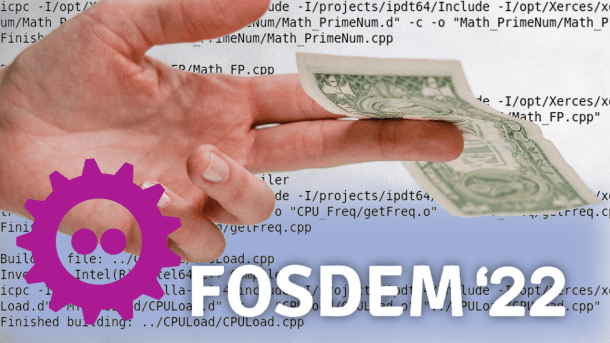
(Bild: Public Domain / FOSDEM)
Die Zweckgemeinschaft großer Tech-Unternehmen und Open-Source-Projekte läuft nicht ideal – so die Argumente von Matt Yonkovit, Strategiechef hinter der Percona. Es brauche eine gezielte Nachschärfung von Zielen in Open-Source-Projekten, damit diese von Unternehmen, aber auch Behörden nicht völlig an die Wand gedrückt werden. Es gehe dabei um nichts anderes als um die Seele und den Fortbestand von Open-Source, meint Yonkovit, den der steile Aufstieg von Open-Source-Datenbanken in seiner Karriere begleitete.
Der Talk beantwortet allerdings nicht alle aufgeworfenen Fragen, sondern fordert vielmehr die kommende Generation auf, Antworten zu suchen und damit Open-Source als Geschäftsmodell zu retten. Denn die aktuellen, schmerzhaften Erfahrungen für freie Projekte im IT-Business prägen bereits nachrückende Entwickler und User, aber auch Investoren.
Ende einer Zweckgemeinschaft
In seinem Talk zur FOSDEM 22 hat der Datenbankexperte auch nicht lange nach Beispielen der jüngsten Vergangenheit suchen müssen, um seine Punkte vorzubringen. Die tonangebenden IT-Firmen präsentieren sich heute gerne als Verfechter und aktive Förderer von Open-Source: Google hat den "Summer of Code", Microsoft liebt nach eigenem Bekunden Linux sehr und hat Github vor mehr als drei Jahren übernommen. Amazon unterstützt die Entwicklung zahlreicher Open-Source-Tools, die heute im gut sortierten DevOps-Werkzeugkasten unentbehrlich scheinen, und investiert groß in die Programmiersprache Rust. Bekannte Firmenlogos zieren auch die Liste der Sponsoren der FOSDEM 22.
Videos by heise
Es zeichne sich in den letzten Jahren im Handeln von Tech-Unternehmen aber ein Muster ab, das den Bestand unabhängiger Projekte und freier Lizenzen gefährde: Erst erfolgt willkommene Unterstützung, dann die Übernahme von Dienstleistungen.
Unfreundliche Übernahme: Alles "As-a-Service"
Das bekam vor drei Jahren schon Redis Labs zu spüren, deren In-Memory-Datenbank "Redis" als konkurrierender Dienst von Cloud-Providern übernommen wurde. Ähnliches war kurz darauf der No-SQL-Datenbank "MongoDB" widerfahren und vor einem Jahr traf es das Geschäftsmodell von Elasticsearch. Das Schema hinter der Übernahme von Software als Dienst in die Cloud ist stets das Gleiche: Anbieter wie Amazon Web Services (AWS) nehmen eine Datenbanksoftware wie Redis, MongoDB oder Elasticsearch und stricken daraus ein Angebot, das Kunden der Cloud-Plattform hinzubuchen können, ohne sich um Infrastruktur, Einrichtung und Administration der Software kümmern zu müssen.
Die freizügigen, immer noch weit verbreiteten Open-Source-Lizenzen wie die GNU General Public License 2 und 3 sowie die MIT- und Apache-License erlauben diese Art der Übernahme von Software als Dienstleistung. Und die Reaktion der Entwicklerfirmen hinter Open-Source-Projekten folgte deshalb auch einem Schema: Wechsel oder Ergänzung der Lizenz oder auch Abkehr von der Entwicklung freier Software. Fundamentale Änderungen, wie diese bergen wiederum das Risiko, die Community und die eigenen Kunden zu verschrecken. Im Falle von Elasticsearch betraf diese Entscheidung immerhin 600 Mitwirkende.
User: Wir zahlen aber auch nicht!
Laut Matt Yonkovit sind aber nicht nur profitorientierte Firmen ein Problem von Open-Source, nur eben ein neueres. Anwender sind auch nicht viel besser und haben meist gar nicht vor, die Entwickler finanziell zu unterstützen, wenn die Software sowieso frei ist. Nach einer eigenen jährlichen Umfrage von Percona denken zwei Drittel der Anwender gar nicht daran, etwas für Open-Source zu bezahlen. Und auch ein breiter aufgestelltes Projekt mit Service-Verträgen als auch "As-a-Service"-Angeboten wird doch nur "wie ein kostenloses Buffet gesehen", aus dem man sich die besten Teile herauspickt und den ungeliebten Rest liegen lässt.
Das sorgt für Frust, für zu wenig Einkommen auf Entwicklerseite, zu schlechter Softwarequalität und schlimmstenfalls zu einem Burn-out der Macher. Yonkovit führt für letzteres das Beispiel eines Node.JS-Entwicklers an, der seine populären Pakete colors.js und Faker.js eigenhändig in der NPM-Paketdatenbank zerstört hat. Als Musterfall für leidende Softwarequalität von Open-Source dient im Talk die schwere Log4j-Lücke. Dem Ruf nach staatlichem Eingriff kann Yonkovit nichts Gutes abgewinnen – dafür gäbe es zu wenig Erfolgsstory, was bei staatlicher Einmischung mit Software passiert. Lähmung durch einen Wust an notwendigen Zertifizierungen und Compliance sei meist die Folge.
Kleine Änderungen: Die Rettung für Open-Source
Während Investoren auf die enormen Adaptionsraten von verbreiteter, freier Software schielen und IT-Unternehmen auf Wachstumsmöglichkeiten durch Open-Source "As-a-Service", sind es laut des Talks doch vor allem die Anwender, die über den Erfolg entscheiden. Und für Anwender ginge es hauptsächlich um Neuerungen und Anpassungsfähigkeit für eigene Zwecke. Ein Ausweg aus der Misere ist laut Matt Yonkovit, den Erfolg von Projekten eben nicht allein an finanziellen Profiten festzumachen.
Die Größe und das ernsthafte Engagement der Community und Anwendergemeinde könnte einen Ausgleich schaffen und dann auch einzelne Entwickler vor dem Ruin oder Burn-out retten. Damit solche Gemeinschaften gedeihen, braucht es in den führenden Köpfen der Open-Source-Szene dringend wieder einen fest verankerten Community-Gedanken, der sogar ein dickes Bankkonto übertrumpft. Denn dann erst fühlen sich genügend Anwender gebraucht und als Mitwirkende ernst genommen.
Nach Ansicht Yonkovits ist dieser Konflikt zwischen finanziellen Interessen und Open-Source-Tugenden keineswegs entschieden, wird aber in den nächsten Jahren über die Zukunft des Entwicklungsmodells und der Lizenzen entscheiden.
(bme)