Missing Link: Roboter, Androide - über Maschinenwesen und ihre Vermenschlichung
Du sollst deinen Roboter nicht vermenschlichen – für viele zentrales Gebot der Robotik. Aber wird es sich auch durchsetzen lassen? Und ist es gerechtfertigt?
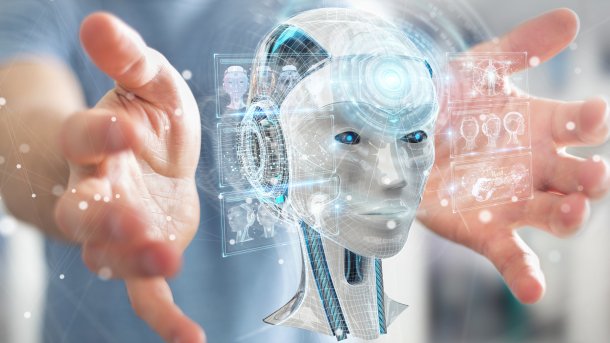
(Bild: sdecoret/Shutterstock.com)
Seit Roboter beim Fußballspiel und anderen Wettkämpfen ihre Fähigkeiten demonstrieren, kommt es immer wieder vor, dass sie nach einem erzielten Tor kurze Tänze oder andere Jubelgesten vorführen, die von ihren menschlichen Vorbildern abgeguckt sind. Beim Publikum kommt das in der Regel gut an.
Zwar wissen wahrscheinlich alle, dass die Gesten vorprogrammiert und kein Ausdruck spontan empfundener Freude sind. Dennoch erfreuen sich viele an dieser augenzwinkernden Hommage an die menschliche Fußballkultur. Selbst die häufigen Stürze der Spieler, die immer wieder den Spielfluss unterbrechen, sorgen für gute Laune. Insbesondere Kinder, deren eigene erste Gehversuche noch nicht lange zurückliegen, quittieren es stets mit fröhlichem Gelächter, wenn die Roboter über ihre eigenen Füße stolpern oder den Gegner gegen das Schienbein treten.
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Google Ireland Limited) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Werkzeug oder e-Person?
Manchen ist diese Ähnlichkeit mit Menschen allerdings eher unheimlich. Sie fühlen sich getäuscht, wenn eine Maschine auf eine Weise gestikuliert, die sie beim Menschen als Ausdruck von Emotionen deuten würden. Roboter sollten aus diesem Grund von vornherein nicht menschenähnlich gestaltet werden, fordern etwa Julian Nida-Rümelin und Nathalie Weidenfeld, denn der Computer sei "kein Gegenüber, sondern ein Werkzeug, weit komplexer zwar als eine Schaufel, aber eben doch nur eine physikalisch beschreibbare Apparatur ohne Wünsche und Überzeugungen".
Ähnlich argumentiert Jörg Schieb, der im WDR-Blog "Digitalistan" ein Video mit tanzenden Robotern mit den Worten kommentiert: "Die KI (Künstliche Intelligenz) im Hintergrund, die unzählige Tanzvideos analysiert haben wird, um diese Choreografie hinzubekommen, ist keine echte Intelligenz. Es ist eine ausgebuffte und zweifellos sehr effektive Analyse-und-Reproduktions-Maschine. Niemals könnten die KI-bestückten Roboter Emotionen in ihre Bewegungen legen, weil sie eben keine Emotionen haben." Das Video demonstriere "überzeugende Ingenieurskunst", die Roboter seien "exzellente Nachahmer".
Empfohlener redaktioneller Inhalt
Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.
Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Google Ireland Limited) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.
Geistiges Vermögen
Mit dieser Einschätzung liegt Schieb auf einer Linie mit Nida-Rümelin und Weidenfeld, die in ihrem Artikel über einen im Jahr 2016 in Saudi-Arabien öffentlichkeitswirksam eingebürgerten Roboter schreiben: "Es handelt sich um "Sophie", einen androiden Roboter mit weiblichem Gesicht und Körper, der auf mechanische Weise Mimik simuliert." Die Wortwahl unterstellt, dass die Ausdrucksmöglichkeiten von Robotern durch Bewegung, Sprache oder Geräusche grundsätzlich nichts mit deren inneren Zuständen zu tun haben können, sondern immer vorgetäuscht sind – und das offenbar nicht nur bezogen auf den derzeitigen Entwicklungsstand, sondern immer und für alle Zeiten.
Videos by heise
Diese rigide Haltung ähnelt "Morgans Kanon", formuliert durch den Verhaltensforscher C. Lloyd Morgan, der sich damit im Jahr 1894 gegen die Vermenschlichung von Tieren wandte: "In keinem Fall sollten wir eine Handlung als das Ergebnis der Ausübung eines höheren geistigen Vermögens interpretieren, wenn sie auch als das Ergebnis eines in der geistigen Skala weiter unten stehenden geistigen Vermögens interpretiert werden kann." Morgan stellte sich mit dieser Warnung vor der Vermenschlichung von Tieren gegen Charles Darwin, der 23 Jahre zuvor erklärt hatte, dass "der geistige Unterschied zwischen dem Menschen und höheren Tieren, so groß er auch sein mag, sicherlich ein gradueller und kein grundlegender" sei.
Tanzende Bienen und lachende Ratten
Die Wurzeln dieser Kontroverse reichen noch tiefer, schreiben Domenica Bruni, Pietro Perconti und Alessio Plebe in Frontiers in Psychology. Die Kognitionsforscher von der italienischen University of Messina verweisen auf René Descartes, der mit seiner 1641 vorgenommenen scharfen Grenzziehung zwischen menschlichen und nicht-menschlichen Lebewesen die westliche Kultur stark geprägt habe. Diese Maxime habe die Verhaltensforschung und insbesondere die vergleichende Kognitionsforschung, die das Denken verschiedener Lebewesen untersucht, über lange Zeit negativ beeinflusst. So beklagte sich der britische Zoologe Robert Hinde noch 1982, dass "die Furcht vor den Gefahren der Vermenschlichung Verhaltensforscher dazu verleitet habe, viele interessante Phänomene nicht zu beachten".
Die 1927 durch Karl von Frisch entdeckte Tanzsprache etwa, mit der Bienen Informationen über die Lage von Futterquellen weitergeben, stieß nicht nur bei Zeitgenossen auf heftige Kritik, sondern wurde von manchen Forschern noch in jüngerer Zeit als unzulässige Vermenschlichung abgelehnt. Dabei haben mittlerweile zahlreiche Studien den Bienentanz und die kognitiven Fähigkeiten von Bienen generell als weit komplexer enthüllt, als es von Frisch wohl selbst nicht geahnt hätte. Für Bruni, Perconti und Plebe ist das ein Beleg für die Fruchtbarkeit einer "konstruktiven Vermenschlichung", die das menschliche Denken als das am besten bekannte Modell für Kognition nutzt, um tierisches Verhalten zu verstehen. Als weiteres Beispiel nennen sie die 1998 gelungene Entdeckung des Lachens bei Ratten durch Jaak Panksepp.