Studenten-Projekt: Wie betreibe ich eine Kernfusionsanlage?
Erstmals nach den Plänen und Ideen von Studenten soll in Sydney eine Tokamak-Anlage entstehen. Auch den Betrieb sollen sie übernehmen.
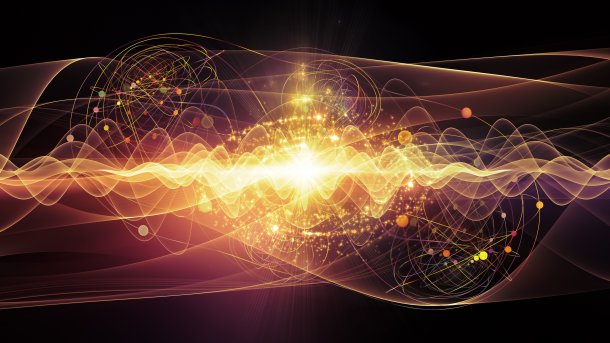
(Bild: agsandrew/Shutterstock.com)
Die einen Studenten verwalten Studentenwohnheime, die anderen eine Kernfusionsanlage. Letzteres ist jedenfalls der Plan für Studenten der University of New South Wales (UNSW) in Sydney. Auf dem dortigen Hauptcampus soll ein kleiner Tokamak entstehen, der von Studenten verschiedener Studienrichtungen entworfen, gebaut und verwaltet wird. Das Ziel ist es, die Anlage innerhalb von zwei bis drei Jahren in Betrieb zu nehmen – allerdings ohne tatsächlich eine Fusionsreaktion auszulösen.
Der geplante Tokamak soll vor allem zweierlei Zwecken dienen: einem technischen und einem gesellschaftlichen. So geht es zum einen darum, bei der etwa einem Meter mal einem Meter messenden, donutförmigen Anlage im kleinen Maßstab besser zu verstehen, wie das mehrere Millionen Grad heiße Wasserstoff-Plasma in den Vakuumkammern aufrechterhalten werden kann, ohne Schäden an den Wänden zu verursachen – eine Hürde, die weltweit Forscherinnen und Forscher in experimentellen Anlagen meistern wollen.
Die zweite Absicht hinter dem Studierenden-Tokamak ist es, die gesellschaftliche Wahrnehmung und Akzeptanz der Fusionstechnologie in der Öffentlichkeit zu analysieren. Es gehe darum herauszufinden, "wie wir am besten mit der Gesellschaft zusammenarbeiten können, um den Nutzen, den diese Technologie bringen könnte, zu vermitteln", erklärt der Nuklearingenieur Patrick Barr, der das Projekt leitet. Somit kommt das Projekt doch nicht ganz ohne Experten aus. Barr ist Lehrender an der UNSW und erforscht, welchen Degradationsmechanismen Kernmaterialien ausgesetzt sind.
Studenten in anspruchsvolle Projekte einbinden
Mit seinem Ansatz ist das Tokamak-Projekt Teil des VIP-Programms (Vertically Integrated Projects) der Universität. Es soll Studenten und Doktoranden in anspruchsvolle, langfristige und multidisziplinäre Projekte unter der Leitung von UNSW-Akademikern einbinden. Das Programm wird vom UNSW Digital Grid Future Institute und den Industriepartnern Tokamak Energy (das britische Start-up arbeitet seinerseits an kleinen, kompakten Tokamaks und will in Großbritannien "in den 2030ern" Energie aus der Fusion liefern) und HB-11 Energy (ein australisches Start-up, das an der Bor-Protonen-Laserfusion arbeitet) unterstützt. "Wir wollen die nächste Generation von Innovatoren begeistern und ihnen zeigen, wie sie die Welt verändern können", sagt Barr.
Auf der Kernfusion liegt eine große Hoffnung für die Energieversorgung. Allerdings ist die praktische Nutzung der Energie noch fern, auch wenn es im privaten Sektor bereits rund 30 Unternehmen gibt, die von Investoren mit Finanzmitteln in Milliardenhöhe bedacht werden. Auch Deutschland setzt auf Fusionsforschung. Das Bundesforschungsministerium hat erst kürzlich die Fördermittel für diesen Forschungsbereich auf eine Milliarde Euro bis zum Jahr 2028 erhöht. Gefördert werden sollen Projekte aus der Laserfusion, die jüngst Fortschritte gemacht hat, aber auch aus der Magnetfusion, wonach Tokamak-Anlagen, wie jene geplante an der UNSW in Australien, funktionieren.
(jle)