Missing Link: Rebellische Replikanten – der Ursprung von "Blade Runner" bei Philip K. Dick
"Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" – das "Blade Runner"-Urmanuskript, in Erwartung von "Blade Runner 2049" neu gelesen im Spiegel der Zeit: Hat uns die Story heute noch etwas zu sagen?
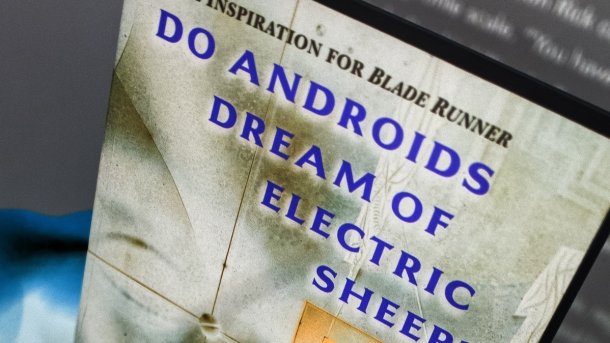
(Bild: Roland Tanglao, CC BY 2.0)
Ich dachte, vielleicht hat er noch irgendwo etwas hineinverschlüsselt. Also ließ ich den Namen der Hauptperson – Rick Deckard – auch noch durch einen Anagrammgenerator laufen. Er kombiniert die Buchstaben des Namens zu neuen Worten, die gerade noch einigermaßen Sinn ergeben ("ARD CD KICKER"). Erstaunlich oft taucht darin das Akronym CD auf. Es schien, als sei der Algorithmus zu einer merkwürdigen Art der künstlichen Vorausschau fähig. Während die CD erst 1981 auf der Funkausstellung in Berlin öffentlich vorgestellt wurde, war der Roman mit Rick Deckard bereits im Jahr 1968 erschienen – "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" von Philip K. Dick, die literarische Vorlage zu dem ikonischen Kinofilm "Blade Runner".
Zu "Blade Runner" siehe:
Gewagte Wahrnehmung
Schon die Widmung für den Roman ist chiffriert. Auch wenn sie das Vorbild für die schöne Androidin Rachael im Buch war, ist es nicht seiner damals 21-jährigen Frau Nancy Hackett gewidmet, sondern einer 1967 verstorbenen Maren Augusta Bergrud – der Mädchenname von Maren Hackett, der Stiefmutter von Nancy. Philip K. Dick ging auf die 40 zu und Maren war nur wenig älter als er, während Nancy mit ihren 20 Jahren seine Tochter hätte sein können. Freunde deuten an, er habe Nancy auch aus Mitleid geheiratet. Sie war gerade aus einer psychiatrischen Anstalt entlassen worden, in der bei ihr eine Schizophrenie diagnostiziert wurde. Für Dick, der für Wahrnehmungswagnisse viel übrig hatte, war das schlicht eine andersartige Weise, sich in die Welt einzufühlen.
Der Familie Hackett war er schon während der Ehe mit seiner dritten Frau Anne begegnet. Man kannte sich aus der Kirchengemeinde des Episkopal-Bischofs und Fernsehpredigers James Pike, der als ebenso progressiv wie kontrovers galt und die spirituelle Vorstellungswelt des Science-Fiction-Autors maßgeblich prägte. Pikes Ansehen beruhte nicht nur darauf, dass er Dogmen wie die Dreifaltigkeit ablehnte. Dem Zeitgeist entsprechend ging sein Privatleben ins Polyamouröse. Jeder wusste, dass Pike Affären hatte, damals mit seiner Sekretärin Maren Hackett. 1967 nahm sie sich im Haus des Bischofs das Leben.
Chiffriertes wurde für Dick zur Manie. 1972 schrieb er Briefe an das FBI und kalifornische Bezirksbehörden, in denen er behauptete, eine "offensichtlich anti-amerikanische" Geheimorganisation habe versucht ihn anzuwerben, um verschlüsselte Botschaften in seinen Büchern unterzubringen (was er abgelehnt habe). Nachfolgend beschuldigte er den Schriftstellerkollegen Thomas Disch, 1968 in seinem Roman "Camp Concentration" genau solche kryptierten Geheiminformationen versteckt zu haben. Nachdem Dick 1982 starb, rief Thomas Disch ihm zu Ehren den Philip K. Dick Award ins Leben, der neben dem Hugo Award und dem Nebula Award inzwischen zu den angesehensten Science-Fiction-Preisen im angloamerikanischen Raum gehört.
Übermenschmaschinen
In diesem emotionalen Spannungsfeld entstand "Träumen Androiden von elektrischen Schafen?" Die Zeit war jugendbewegt und Dick, in dieser Hinsicht spätblühend, gab sich alle Mühe, aufzuholen. Kaum eine Droge blieb unverkostet, er nahm an Seancen teil und war im übrigen ein obsessiver Leser und verschlang literarische, wissenschaftliche und philosophische Werke. Angetrieben von Amphetamin schrieb er bis zu 60 Seiten am Tag. In einem trotzdem erstaunlich ungehetzten, klaren Stil erzählt die Dystopie von einer verseuchten Erde nach einem atomaren Weltkrieg, der viele Menschen in Kolonien auf die Nachbarplaneten getrieben hat. Hilfe bei der Siedlungsarbeit leisten ihnen dabei Androiden, beziehungsweise Replikanten, artifizielle Wesen, die von Baureihe zu Baureihe immer menschenähnlicher werden, hergestellt von einem Konzern in Familienbesitz – im Buch der Firma Rosen, im Film der Tyrell Corporation.
Die jüngste Replikantengeneration Nexus-6 ist sogar mit künstlichen biografischen Erinnerungen ausgestattet, und ein paar Exemplare der Gattung, deren Lebenszeit ab Werk auf vier Jahre begrenzt ist, machen sich auf die Suche nach einer Möglichkeit, dieser Begrenzung der Daseinsspanne zu entkommen. Sie wollen leben. Auch andere rebellische Replikanten missachten gelegentlich das strikte Verbot, auf die Erde zurückzukehren, manche ermorden ihre Inhaber. Dann schlägt die Stunde der "Prämienjäger" – im späteren Drehbuch in die titelgebenden "Blade Runner" umgetauft –, Polizeibeamte, die diese illegalen Eindringlinge aufspüren und neutralisieren sollen und für die schmutzige Arbeit mit Sonderzahlungen belohnt werden – um sich Tiere kaufen zu können, die wie zuvor Autos und Häuser, als Statusobjekte zählen. Da nur die Wenigsten sich eines der in dem radioaktiven Staub verbliebenen echten Tiere leisten können, ist die Herstellung artifizieller, naturidentischer Tiere ein blühender Industriezweig – wobei die Besitzer solcher Substitute sich schämen, kein echtes Tier zu haben und dessen androidische Herkunft möglichst zu verbergen versuchen. Prämienjäger Rick Deckard hat ein elektrisches Schaf, das auf dem Dach seines Hauses grast, im Gatter nebenan das Pferd eines Nachbarn, ein Renommierobjekt.
Regenglänzende Großstadtbilder
Wer den "Blade Runner" im Kino gesehen hat und danach zum ersten Mal das Buch liest, wird feststellen, dass er in eine fremde Welt geraten ist. Der Film beschränkt die Handlung auf einen weitgehend linearen Action-Verlauf – die Verfolgung von sechs abtrünnigen Replikanten – und badet dafür in von Vangelis-Sounds und regenglänzenden Großstadtbildern ausgelösten Hochgefühlen. Der Roman entfaltet einen Reichtum an Themensträngen, der eine ganz andere Generalstimmung als Antwort auf die Kernfrage der Geschichte zur Verfügung stellt als der düster-poetische Film. Woran erkennt man, dass ein Mensch ein Mensch ist und nicht nur so tut, als wäre er einer? Daran, dass er Humor hat. Dass er Heiterkeit, Sarkasmus, Ironie produzieren und wahrnehmen kann. Dass er Mehrdeutigkeiten in der Schwebe halten kann. Und der Roman macht sich sogleich daran. Oder wie es der deutsche KI-Papst und Inhaber der Johannes-Gutenberg-Stiftungsprofessur 2017 an der Uni Mainz, Prof. Wolfgang Wahlster seit Jahren avisiert: "Das Ziel ist erreicht, wenn die Maschine bei den Stummfilmkomödien von Buster Keaton an der richtigen Stelle lacht".
Blade Runner (1982) (25 Bilder)

(Bild: Warner Home Entertainment)
Unerschöpflich ist das weite Feld menschlicher Intuition und Launen, und in diesen Mikrokosmos der Gefühle zieht einen das Buch. Besonders beeindruckend ist die Modernität der Geschichte. Wobei der Test auf Nerd-Tauglichkeit auf den ersten Blick ja ziemlich schwach ausfällt. Das Jahr, in dem der Roman entstand, hat zwar einer ganzen Generation den Namen gegeben, technologisch aber war Philip K. Dick von einer Silizium-Verson der Steinzeit umgeben. 1968 wurde Apple gegründet (die Plattenfirma der Beatles), im Juni nahm die Firma Intel den Betrieb auf und in dem Raumgefährt Apollo 8 umrundeten drei Astronauten erstmals den Mond. Unterstützt wurden sie dabei von einem knapp 30 Kilo schweren Computer mit 74 KB Hauptspeicher, 4 KB Arbeitsspeicher und einem mit 1,024 MHz getakteten Prozessor. Zwar fand im Dezember 1968 in San Francisco eine visionäre Vorführung statt, bei der Douglas Engelbart erstmalig einen vernetzten Rechner mit grafischer Benutzeroberfläche und Maussteuerung präsentierte – sie erhielt später den Ehrentitel "Mutter aller Demos" –; ob die Begeisterung des Fachpublikums auch Philip K. Dick erreichte, ist allerdings fraglich.
Zank an der Stimmungsorgel
Auch ein Blick auf das zukunftsmächtige Equipment, das in der Geschichte zum Einsatz kommt, lässt eher abwinken: Fliegende Autos ("Schwebewagen"), die inzwischen zu den parodistischen SF-Ideen gehören, Videophone mit Wählscheiben, City-Einschienenbahnen und Laserpistolen sind nicht gerade die schärfsten Erfindungen seit dem tiefen Teller. Was aus dem Roman mühelos bis ins Hier und Jetzt reicht, ist das komplexe Strömungsbild fühlender, denkender, zweifelnder Menschen, die angesichts immer realistischer nachgeschaffener Naturphänomene und Mitwesen in eine tiefe Krise geraten. Wenn sich der Rick Deckard des Buchs eingangs mit seiner Frau Iran an der Stimmungsorgel zankt, an der man nach Nummern abgestufte Gemütsverfassungen abrufen kann ("888 – der Wunsch, fernzusehen, gleichgültig, was gesendet wird"), und man mitfühlen kann, wie er das unechte elektrische Schaf auf seinem Dach verabscheut, darf man die Lektüre mit einem Grinsen begleiten und möchte dem Mann, der einen wirklich harten, unangenehmen Job hat, den Arm um die Schulter legen und ihn kurz aufmunternd ranziehen.
Anders als die ausgekochten, zynischen Detektive der Schwarzen Serie, die, inklusive Femme Fatale, als Vorlage für Ridley Scotts Film-Deckard dienten, ist der Roman-Rick ein volatiles Menschenwesen, das nicht so sehr Angst hat, von einer hyperintelligenten Maschine übertrumpft zu werden, sondern die Unterscheidungsmöglichkeiten zwischen Mensch und Maschine schwinden zu sehen und sich in dem tristen Gefühl zu verlieren, nur noch ein nachgemachter Mensch zu sein, der sich ein nachgemachtes Schaf hält.
Eine Geschichte der Täuschung
Philip K. Dick schürt nicht, wie es uns heute oft begegnet, die platte Kinderangst vor einer bösen KI, die sich ein paar Menschen zur Dekoration hält und im Sauseschritt die Evolution fortsetzt. Es geht auch nicht um die Frage, ob Maschinen ein Bewusstsein entwickeln können, sondern wie perfekt wir uns täuschen lassen können – und wollen. Die ganze Mediengeschichte des 20. Jahrhunderts ist eine Geschichte des Einverständnisses, sich täuschen zu lassen. 24 Bilder pro Sekunde reichen für den perfekten Eindruck einer fließenden Bewegung aus – bis hin zu der, William Gibson zu danken, kollektiven Illusion des Cyberspace. Maschinen können kein Bewusstsein entwickeln, aber sie lösen längst in uns den Reflex aus, auf sie wie auf Lebewesen zu reagieren – ein uralter stammesgeschichtlicher Automatismus, dem wir uns kaum entziehen können und den uns Philip K. Dick in seiner ganzen Albernheit und Tristesse deutlich vor Augen führt.
Wahrscheinlich werden pragmatische Auswirkungen der Künstlichen Intelligenz unseren Alltag und die Art, wie wir leben auf eine Art verändern, von der wir heute noch gar keine Vorstellung haben. Vielleicht ist KI auch nur eine moderne Form von Aberglauben. So wie magiegläubige Menschen glaubten, dass Tonfiguren zu leben anfangen, wenn man die richtigen Worte kennt, glauben heute andere, dass sich in einem Computer Bewusstsein bildet, wenn man ihn nur richtig programmiert. Vielleicht hat ein solcher Aberglaube ähnlich unerwartete positive Auswirkungen wie die Alchemie. Den Alchemisten war es zwar nie gelungen, künstliche Wesen zu schaffen ("Homunculus") oder Quecksilber in Gold zu verwandeln. Unbeabsichtigt entstanden bei den unzähligen Versuchen aber die Grundlagen der Chemie und Pharmakologie, ohne die eine moderne Welt nicht denkbar wäre.
Warum sollte eine Maschine so leben wollen wie ein Mensch?
Künstliche Intelligenz, so kann man nach der Lektüre des Buchs festhalten, widmet sich vor allem der Fähigkeit, verbergen zu können, dass man eine Maschine ist. Und warum sollte eine hyperkomplexe Maschine ausgerechnet so leben wollen wie ein Mensch und nicht ein Existenzmodell aus der Unendlichkeit anderer Möglichkeiten wählen, die ihr im Gegensatz zum Menschen zur Verfügung stehen. Dass es auch in Bleiwesten gehüllt im radioaktiven Staub oder im Steinhagel, den man bei der Ausübung einer postmodernen Religion namens Mercerismus über sich ergehen lassen muss, nichts Schöneres gibt als ein Mensch zu sein, ist doch wohl auch ein ziemlich eitler Impuls.
"Alles um mich herum ist unnatürlich geworden", merkt Deckard an einer Stelle an. "Ich selbst bin ein unnatürliches Wesen." Einen Augenblick lang liegt die Möglichkeit in der Luft, auch der Prämienjäger könnte ein "Andy" sein, ein Android, und einen als menschlichen Leser alleinlassen vor dem Buch. Aber in bester Tradition des Turing-Tests gibt es da noch den Voigt-Kampff-Test, mit dem sich Menschen von Menschenimitaten unterscheiden lassen.
Eine ironiefunkelnde Version davon hat Stanislaw Lem bereits 1957 in den "Sterntagebüchern" beschrieben. In der Erzählung "Die Waschmaschinen-Tragödie” wird vom Konkurrenzkampf zweier Waschmaschinenkonzerne berichtet – der Firmen Snodgrass und Nudlegg –, die ihre Maschinen mit immer neuen Features ausstatten, die allerdings immer weniger mit Wäschewaschen zu tun haben. Am Ende baut einer der Konzerne Waschmaschinen für Junggesellen, die aussehen wie schöne Frauen. Kein Mann weiß nun mehr genau, ob er an der Bar gerade neben einer Frau oder einer Waschmaschine sitzt. Die Krise spitzt sich zu, als der Bordcomputer eines Raumschiffs einen Roboterstaat ausruft und eine Sekte von Robotersympathisanten gründet. Anlässlich einer parlamentarischen Anhörung, in dem es um die Einführung des Wahlrechts für Roboter geht, wird schließlich mithilfe der Magnetnadel eines Saaldieners ein Redner nach dem anderen als Roboter enttarnt.
Blade Runner 2049 (16 Bilder)

(Bild: © 2017 Sony Pictures Releasing GmbH)
Die Bedeutungsmaschine
Die Geschichte von Rick Deckard und Iran endet mit dem desillusionierten Wunsch, eine Maschine möge "in jeder Hinsicht einwandfrei funktionieren". Sieht man einen Roman als eine Bedeutungsmaschine an, zeigt sich, dass Philip K. Dick der Aufforderung seiner eigenen Helden zum Glück nicht Folge leistet. Das Besondere bei ihm ist, dass alle Handlungsverläufe einer eigenen Logik folgen. Sie führt zur Katastrophe, die aber keine Katastrophe ist, sondern nur die Wahrnehmung des ganz normalen Wahnsinns. "Es erinnerte sich auch niemand mehr daran, warum der Krieg ausgebrochen war oder wer – falls überhaupt – ihn gewonnen hatte."
Bei der Recherche zu einem Roman in den frühen Sechzigern in einer Bibliothek in Berkeley stieß Philip K. Dick auf das Tagebuch eines SS-Offiziers, der in Warschau stationiert war. Eine Zeile traf ihn besonders: "Wir werden nachts wachgehalten von den Schreien verhungernder Kinder." – "Es gibt in uns etwas", schrieb er später, "das zweibeinig und humanoid ist, morphologisch identisch mit einem Menschen, aber es ist kein Mensch. Es ist nicht menschlich, sich in seinem Tagebuch darüber zu beklagen, dass einen verhungernde Kinder wachhalten."
Lesen Sie auch die Filmkritik zu "Blade Runner 2049" sowie den Rückblick auf "Blade Runner" auf heise online:
- "Blade Runner 2049": Gelungene Rückkehr in die düstere Zukunft der 80er
- Blade Runner: Das Kult-Desaster
(mho)