Missing Link: Wenn Science-Fiction und Realität die Wege kreuzen
Das Zukunftsgenre als Mutmacher und Prognosehilfe: Wie Wirklichkeit und Fiktion derzeit aufeinandertreffen — und auseinanderklaffen
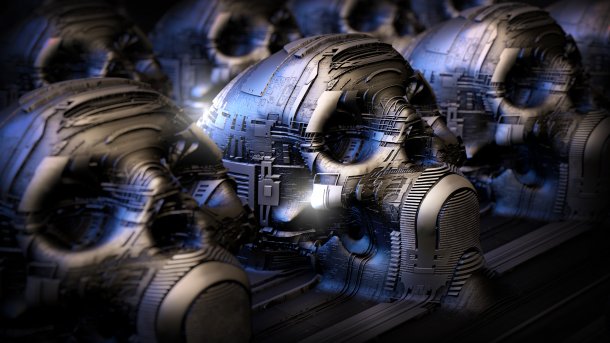
(Bild: CROCOTHERY / Shutterstock.com)
Wahnsinn, das ist ja wie im Kino! Die Ähnlichkeit des aktuellen Geschehens mit den aus Science-Fiction-Geschichten vertrauten Szenarien dürfte vielen aufgefallen – und nahegegangen – sein. Spätestens als die Einschränkungen im Zusammenhang mit der weltweiten Verbreitung des Corona-Virus auch hierzulande spürbar wurden und im Fernsehen die ersten Polizeisperren in Europa zu sehen waren, ließen sich die Parallelen zu einschlägigen Seuchenthrillern kaum übersehen. Das ist zutiefst verstörend und beunruhigend, zugleich aber auch faszinierend und spannend.
Die Beunruhigung liegt auf der Hand: Wenn die bisherigen Ereignisse schon so dicht den Schilderungen folgen, die sich Autoren wie Stephen King, Michael Crichton oder Sakyō Komatsu ausgedacht haben – die vergeblichen Versuche, die Ausbreitung des Virus zu verhindern, Straßensperren, leer gekaufte Supermärkte, aufgeregte Fernsehnachrichten – was mag dann noch alles auf uns zukommen? Man möchte lieber nicht daran denken. Was einst bei der Lektüre oder beim Zuschauen wohliges Gänsehautkribbeln erzeugte, würde jetzt wohl eher Angstschweiß und Panik ausbrechen lassen.
Science-Fiction trifft auf Realität
Die Faszination resultiert daraus, dass sich Science-Fiction und Realität selten so nahe kommen. Eines der wenigen anderen Beispiele ist die Robotik, bei der sich die Visionen der fantastischen Literatur und des Kinos schon seit Jahrzehnten mit realen Entwicklungen kreuzen. Anfangs geschah das noch weitgehend unbemerkt: Kaum jemand nahm zur Kenntnis, dass das US-amerikanische Kriegsschiff „USS Vincennes“, das 1988 während des Iran-Irak-Krieges im Persischen Golf den Schiffsverkehr schützte, wegen seiner Ausstattung mit dem automatischen Verteidigungssystem Aegis und seines aggressiven Auftretens von den Besatzungen anderer Schiffe „RoboCop“ genannt wurde.
Was zunächst wohl eher scherzhaft gemeint war, wurde blutiger Ernst, als das Schiff am 3. Juli 1988 ein iranisches Passagierflugzeug mit 290 Menschen an Bord fälschlicherweise als angreifenden Kampfjet identifizierte und mit zwei Raketen abschoss. Die erschreckende Parallele zum Film RoboCop, der ein Jahr zuvor in den US-Kinos gestartet war und in einer legendären Szene einen amoklaufenden Kampfroboter zeigt, blieb lange Zeit unbeachtet. Ebenso wenig interessierte sich jemand dafür, dass im Februar 1991, wenige Monate vor dem Kinostart von „Terminator 2: Judgment Day“, auf der kuwaitischen Insel Failaka reale Soldaten erstmals vor einem Roboter kapituliert hatten.
Realität vs. Science-Fiction
Seit jedoch Honda 1996 mit dem P2 den ersten vollständigen humanoiden Roboter öffentlich präsentiert hat und mit dem RoboCup eine Bühne entstanden ist, auf der sich die Evolution künstlicher Intelligenz praktisch in Echtzeit mitverfolgen lässt, kann die Wirklichkeit hinsichtlich der Spannung locker mit den fiktiven Abenteuern auf Leinwänden und zwischen Buchdeckeln mithalten. Mittlerweile ist das Verhältnis von Realität und Science-Fiction ein auf Konferenzen regelmäßig diskutiertes Thema. Dabei geht es inzwischen auch um Leben und Tod, unentbehrliches Element jedes Thrillers: Bewaffnete Roboter (Drohnen) haben seit 2001 bereits mehrere tausend Menschen gezielt getötet. Und die drohende Machtübernahme künstlicher Intelligenz ist keine ferne Fantasie mehr, sondern spürbare Realität.
heise online: Welten - eine Leseprobe aus "Die letzte Crew des Wandersterns"
Diese Reibungen zwischen Wirklichkeit und Vision, die sich bei Robotik und KI bereits über Jahre hinziehen und allmählich ins kollektive Bewusstsein eindringen, laufen mit der Virus-Epidemie jetzt allerdings quasi im Zeitraffer ab. Da scheint keine Zeit zu sein, sich mit Science-Fiction zu beschäftigen. Was soll das auch bringen, außer dass man vor Angst erstarrt und völlig handlungsunfähig wird?
Planspiele der Science-Fiction aus dem Giftschrank
Nun gibt es die Momente der Erstarrung und Verleugnung aber ohnehin. Die meisten werden es in diesen Wochen erlebt haben oder noch erleben, dieses Schwanken zwischen demonstrativer Sorglosigkeit und Erschrecken, zwischen dem Gefühl der Unverwundbarkeit und der Hilflosigkeit angesichts des Fortschreitens der Epidemie. Es braucht Zeit, die Dimension des Geschehens und den Ernst der Lage zu erfassen. Wenn der Alltag so wie jetzt unvermittelt zerrissen wird und alle Pläne für die nähere Zukunft mit einem Schlag hinfällig werden, ist das schwer zu akzeptieren. Wer schon einmal einen schweren Unfall erlebt hat, den Tod einer nahestehenden Person verkraften musste oder mit einer niederschmetternden ärztlichen Diagnose konfrontiert wurde, wird das kennen: Man will das erst mal nicht wahrhaben. Das soll alles nicht geschehen sein.
Wer diese Phase überwunden hat, die Planspiele der Science-Fiction wieder aus dem Giftschrank holt und doch noch mal einen Blick darauf wirft, wird sehen, dass sie gar nicht so entmutigend sind, wie zunächst befürchtet. Zum einen folgt dort auf die Katastrophe zumeist der Wiederaufbau der Gesellschaft, womöglich stärker und besser als zuvor, so in Stephen Kings „The Stand“ oder in George Stewarts „Leben ohne Ende“. Selbst Sakyō Komatsu, der mit „Der Tag der Auferstehung“ eine der pessimistischsten Varianten des Pandemie-Szenarios geschrieben hat, lässt am Ende zumindest ein wenig Raum für Hoffnung. Tatsächlich haben auch in unserer gegenwärtigen Realität bereits die Diskussionen über die Zeit danach begonnen. Die Kommerzialisierung des Gesundheitswesens ist als großer Fehler erkannt worden, manche reden vom Ende der neo-liberalen Politik, die vierzig Jahre lang das Weltgeschehen bestimmt hat.
Zum anderen geht es in den fiktiven Szenarien eigentlich immer um Killerviren. Deren Todesraten liegen nahe bei hundert Prozent. Oft stammen sie aus geheimen Militärlaboratorien, manchmal (wie in dem Film „Outbreak“) sind es auch natürlich entstandene Krankheitserreger, für die sich dann das Militär so stark interessiert, dass es den Kampf gegen die Epidemie behindert. Es geht immer um das Überleben der Menschheit, um alles oder nichts. Das muss auch so sein: Wer nur zwei Stunden zur Verfügung hat, um maximale Spannung aufzubauen, ist gut beraten, die Einsätze so hoch wie möglich zu schrauben.