Medienstaatsvertrag: Pornowerbeverbot und Google-Ausnahme sind raus
Die Länder haben bei den Regeln zu Jugendschutz und Diskriminierungsverbot noch einmal nachgebessert. Jetzt sind die Parlamente am Zug.
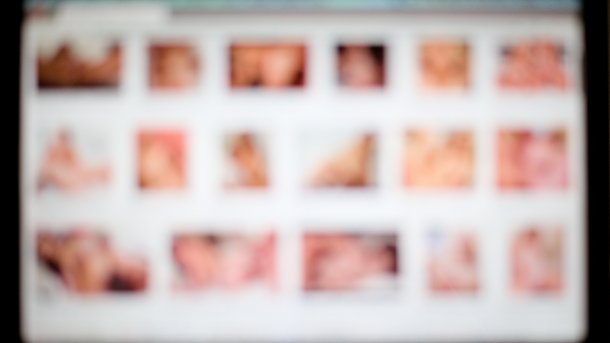
(Bild: Shutterstock/Empirephotostock)
Vorige Woche unterzeichneten die Länderchefs den lange umstrittenen Medienstaatsvertrag, nachdem die EU-Kommission mit Hängen und Würgen grünes Licht gegeben hatte. Der Staatsvertrag geht jetzt in die Landtage, die noch zustimmen müssen. Zwei größere Stolpersteine haben die Medienpolitiker in der letzten Version noch ausgeräumt, was die Passage durch die Parlamente vereinfachen könnte.
So findet sich das zunächst vorgesehene Pornowerbeverbot nicht mehr in der aktuellen, heise online vorliegenden Version. Ursprünglich wollten die Länder Werbung für Inhalte, die "in sonstiger Weise pornografisch sind", auf eine Ebene stellen mit "indizierten", also auf der schwarzen Liste der zuständigen Bundesprüfstelle verzeichneten Angeboten. Betreiber von Telemediendiensten hätten damit sicherstellen müssen, dass solche Werbung nur Erwachsenen nach einer strengen Altersprüfung zugänglich ist.
Werbeverbot eingeschränkt
Medienrechtler hatten die Klausel als Absatzförderung für ausländische Angebote wie Youporn kritisiert, da bislang jugendschutzkonforme Anbieter hierzulande ohne weitere Option der Kundenansprache wohl hätten einpacken müssen. Jetzt sollen die Hürden nur noch bei absolut unzulässigen Inhalte gelten, etwa Propaganda gegen die freiheitliche demokratische Grundordnung, Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen oder sexuellem Kindesmissbrauch. "Einfache" Pornografie wird nicht mehr erfasst.
Auch die nicht minder umstrittene Ausnahme vom geplanten Diskriminierungsverbot von "journalistisch-redaktionell gestalteten Angeboten" für Suchmaschinen ist nicht mehr im Entwurf. Suchmaschinen dürfen Inhalte von Presseverlegern nicht benachteiligen. Dies sollte ursprünglich nicht gelten, wenn ein Betreiber bestimmte Angebote in den Suchergebnissen "aufgrund urheber- bzw. leistungsschutzrechtlicher Regelungen nicht vergütungsfrei anzeigen darf oder kann".
Ausnahmen für Suchmaschinen
Die Verwertungsgesellschaft VG Media, die neben privaten Rundfunksendern auch mehrere hundert digitale verlegerische Angebote vertritt, war gegen diese Passage Sturm gelaufen. Wer sein mit der EU-Urheberrechtsreform verknüpftes Leistungsschutzrecht durchsetzen wolle, werde gar nicht mehr verbreitet oder lande auf den hinteren Rängen, befürchtete der Zusammenschluss.
Die Länder haben die Klausel daher allgemeiner gefasst und den direkten Bezug zum Leistungsschutzrecht entfernt: Insbesondere rechtstreues Verhalten oder "das Befolgen anderweitiger gesetzlicher Verpflichtungen" könne einen "sachlichen Grund" für einen Betreiber darstellen, "zugunsten oder zulasten eines bestimmten Angebots systematisch" vom Diskriminierungsverbot abzuweichen, heißt es nun. Entsprechende Vorgaben können sich etwa aus jugendschutz-, straf-, persönlichkeits- oder urheberrechtlichen Bestimmungen ergeben.
Mit ihrem Prestigeprojekt wollen die Länder hauptsächlich Internet-Plattformen auch mit nutzergenerierten Inhalten strenger regulieren. Nach Ansicht von Kritikern verstößt der Medienstaatsvertrag aber gegen EU-Recht wie die E-Commerce-Richtlinie oder die neuen Vorschriften für audiovisuelle Medien und die darin unter anderem enthaltenen Haftungsprivilegien für Diensteanbieter. Das Normenwerk dürfte daher trotz des wackeligen Plazets der Kommission rasch vor dem Europäischen Gerichtshof landen, der es in Teilen für unanwendbar erklären könnte. (vbr)