Kernfusion mit Bor und Protonen in Stellarator gelungen
Fusionsforscher des US-Unternehmens TAE haben gemeinsam mit japanischen Kollegen erstmals eine Bor-Protonen-Fusion in einem Reaktor gezündet. Ein Durchbruch?
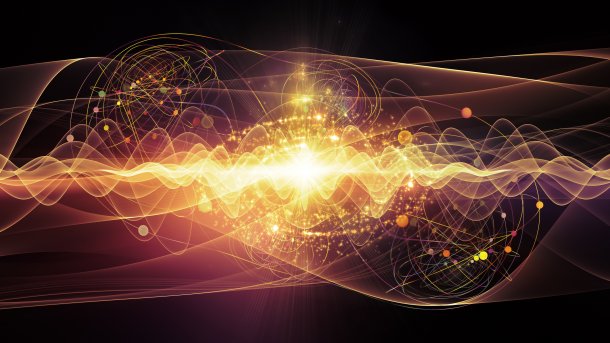
(Bild: agsandrew/Shutterstock.com)
TAE Technologies will nicht nur einen kommerziellen Fusionsreaktor bauen, der deutlich vor dem internationalen Forschungsprojekt ITER Energie liefern soll. Die Gründer des US-Unternehmens haben einen auf den ersten Blick auch noch deutlich schwierigeren Weg gewählt: Sie setzen auf Wasserstoff und Bor als Brennstoff für den Reaktor. Dafür müssen sie ein Plasma erzeugen, das noch etwa acht bis zehn Mal heißer ist als das Plasma in einem mit Deuterium und Tritium betriebenen Reaktor – rund drei Milliarden Grad.
In Zusammenarbeit mit dem japanischen National Institute for Fusion Science (NIFS) hat TAE nun gezeigt, dass die Idee zumindest prinzipiell funktioniert. Sie erzeugen die allerersten Wasserstoff-Bor-Fusionsexperimente in einem magnetisch eingeschlossenen Fusionsplasma. Die Einzelheiten des Experiments beschreiben die Forschenden jetzt in einem Paper in Nature Communications.
Videos by heise
TAE Technologies wurde 1998 als Tri Alpha Energy gegründet – und war damit eines der ersten privat finanzierten Unternehmen, die an einem Fusionsreaktor arbeiteten. Bis 2015 war die Firma praktisch im Stealth Mode unterwegs. "Eigentlich hatten wir ursprünglich auf staatliche Unterstützung gehofft", sagt TAE-CEO und Mitgründer Michl Binderbauer. "Aber die US-Regierung zog sich Ende der 1990er-Jahre aus Kostengründen aus dem ITER-Projekt zurück. Fusion galt der US-Politik als zu teuer."
(Bild: TAE Technologies)
Höhere Temperaturen für die Proton-Bor-Fusion
Doch private Investoren waren bereit, der Vision des Physikers Norman Rostoker von University of California, Irvine zu folgen. Nahezu die gesamte Fusionsforschung konzentrierte sich damals auf die Fusion von Deuterium und Tritium. Die lässt sich in einem Plasma mit rund 100 Millionen Grad zünden. Allerdings werden dabei hochenergetische Neutronen frei, die die Spule im Zentrum des Tokamak-Reaktors bombardieren und die Wände des Fusionsreaktors aktivieren, sodass sie radioaktiv werden.
(Bild: Nature Communications)
Rostoker wollte dagegen auf eine Proton-Bor-Fusion setzen. Denn bei dieser Fusionsreaktion werden keine Neutronen, sondern nur – elektrisch geladene – Alpha-Teilchen frei. Die lassen sich durch Magnetfelder eindämmen, und geben ihre Bewegungsenergie schließlich über die Elektronen an die Reaktorwand ab – wo sie über einen Wärmetauscher schließlich in einer Dampfturbine genutzt werden kann. Allerdings braucht die Bor-Protonen-Fusion wesentliche höhere Temperaturen. "Aber wenn man dieses Problem gelöst hat, ist alles andere technisch vergleichsweise einfach", sagt Binderbauer.
Um ein derartig heißes Plasma zu erzeugen und lange genug stabil zu halten, setzt TAE auf eine Technologie, die Field Reversed Configuration genannt wird: Eine Art Ring aus Plasma, der mithilfe von Teilchenstrahlen in Rotation versetzt wird. Der elektrische Strom, der dadurch entsteht, erzeugt Magnetfelder, die das Plasma zusammenhalten. Prinzipiell funktioniert das auch, allerdings ist die Energie des aktuellen Fusionsreaktors von TAE nicht hoch genug, um das Plasma auf die erforderlichen Temperaturen zu bringen.
"Entspricht einer Temperatur von 1,7 Milliarden Grad"
Die Protonen-Bor-Fusion ist zwar experimentell bereits gezeigt worden, allerdings bisher nur mit Teilchenstrahlen, die auf Targets geschossen werden, oder mithilfe extrem starker, kurzer Laserpulse – ein Plan, den beispielsweise das deutsche Start-up Marvel Fusion verfolgt. In einem magnetisch eingeschlossenen Plasma dagegen war diese Fusionsreaktion bisher noch nicht beobachtet worden.
Das Large Helical Device (LHD) des NIFS – ein Fusionsreaktor nach dem Stellarator-Prinzip wie der Wendelstein-7x in Greifswald – ist mit zwei Teilchenstrahlen-Injektoren mit je 160 Kilovolt (kV) Beschleunigungsspannung ausgerüstet. "Das entspricht etwa einer Temperatur von 1,7 Milliarden Grad", sagt Binderbauer. "Aber genau genommen haben wir hier nicht eine Temperatur, sondern eine Temperaturverteilung." Am "fernen Ende" dieser Verteilung gibt es einige Teilchen, die genug Energie haben, um eine Fusionsreaktion auszulösen. Alles, was fehlte, war ein Detektor für die Alpha-Teilchen, der von TAE entwickelt wurde.
Wasserstoff-Bot in der kommerziellen Fusionsenergie
"Dann haben wir unsere Leute mit dem Detektor nach Japan geschickt, aber die durften wegen Covid nicht einreisen", sagt Binderbauer. "Wir mussten die Zusammenarbeit dann im Wesentlichen über Zoom erledigen", sagt er. "Nichts, das wir uns gewünscht hätten, aber letztendlich hat es geklappt". Zwar war von Anfang an klar, dass in diesem Reaktor keine sich selbst erhaltende Fusionsreaktion erzeugt werden kann – dazu waren die Magnetfelder nicht stark und die Temperaturen nicht hoch genug. Außerdem sind die Strahlungsverluste in dieser Konfiguration hoch. Aber das Experiment liefert "eine Fülle von Daten, mit denen wir arbeiten können, und zeigt, dass Wasserstoff-Bor einen Platz in der kommerziellen Fusionsenergie hat".
Derzeit baut und konstruiert TAE zwei weitere Anlagen, Copernicus und Da Vinci, in denen Plasma mit höherer Temperatur als bisher erzeugt werden soll. Die nächste Generation, Copernicus, soll die Partikelstrahlen mit 100 kV beschleunigen und könnte damit erstmals ein Deuterium-Tritium-Plasma zünden. Eigentlich sollte die Maschine längst fertig sein, aber Covid hat die Entwicklung ausgebremst.
Die Copernicus-Maschine soll in rund zwei Jahren fertig sein, wird dann aber erst langsam hochlaufen, weil die Kontrolle des Plasmas unter anderem mithilfe von maschinellem Lernen optimiert ist. "Unsere bisherigen Erfahrungen haben gezeigt, dass man mit solch einer Maschine nicht aus dem Stand auf volle Leistung kommt", so Binderbauer.
Da Vinci soll dann "um 2030" zeigen, dass die Proton-Bor-Fusion von TAE wirklich funktioniert. Ob das gelingt? "Fusionsforschung spielt sich immer an den extremen Rändern des Parameterraumes ab", sagt Binderbauer. "Das ist das aufregende daran. Es ist ein bisschen wie die Mond-Mission der NASA damals. Technisch so herausfordernd, dass es jede Menge Innovationen hervorbringen wird."
(wst)