Die Mär vom rasenden Fortschritt
Der Fortschritt wird immer schneller, behaupten Medien, Vordenker oder Unternehmensberater immer wieder. Doch eine Analyse von Technology Review zeigt: Es stimmt nicht.
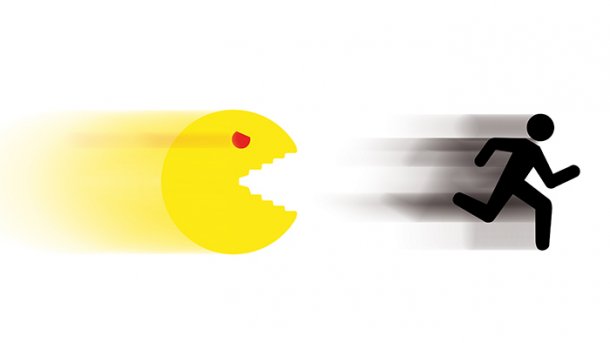
(Bild: Shutterstock)
- Eva Wolfangel
Der rasante technische Wandel kann jederzeit das Leben umkrempeln und Unternehmen hinwegfegen. So lautet die stetige Predigt auf Konferenzen, in Medien und Strategiesitzungen von Unternehmen. Gefühlt scheint es tatsächlich zu stimmen. Der Umbruch zur digitalen Fotografie hat den Filmhersteller Kodak komplett aus dem Markt gedrängt. Apples iPhone hat die Wertschöpfung vieler Unternehmen vom Taxidienst bis zur Hotelgewerbe verändert. Das Wort Disruption wurde 2011 nur fünfmal in deutschen Medien erwähnt, 2015 bereits 205-mal, hat das Medienforschungsinstitut Prime Research im Auftrag der FAZ herausgefunden.
Handelsblatt-Herausgeber Gabor Steingart stellt auf einer Diskussionsveranstaltung klar: "Die Gegenwart wird nicht bleiben, sie wird untergehen." Der Spiegel widmete gleich eine ganze Titelgeschichte dem Thema "Was der rasante digitale Fortschritt dem Menschen abverlangt". Und das Beratungsunternehmen KPMG meint, dass "die Geschäftswelt gerade kräftig von neuen, disruptiven Technologien durchgerüttelt" wird. Doch wie eine Analyse in der aktuellen Ausgabe der Technology Review (jetzt im Handel und im heise shop verfügbar) zeigt, fehlen der Behauptung die Belege.
Einzug in die Haushalte als Gradmesser
Als ein Gradmesser für den technischen Wandel gilt die Geschwindigkeit, mit der sich Innovationen durchsetzen. Ökonomen dient die Zeit als Maßstab, die es braucht, bis 50 Prozent aller Haushalte mit einer neuen Technik ausgestattet sind. Aktuelle Innovationen müssten diese Marke also schneller erreicht haben als vorherige. Dem aber ist nicht so, wie David Moschella zeigt, wissenschaftlicher Leiter des IT-Forschungs- und Beratungsunternehmens "Leading Edge Forum". Er hat die Zahlen für die USA erhoben. "Sowohl das Radio als auch der Fernseher erreichten diese 50-Prozent-Grenze schneller als der Computer oder das Mobiltelefon", erläutert Moschella. 1939 wurde der Fernseher erstmals verkauft, bereits neun Jahre später war er in jedem zweiten US-Haushalt zu finden. Das Radio verbreitete sich gar in acht Jahren (1922 bis 1930). Das Mobiltelefon hingegen brauchte 15 Jahre (1980 bis 1995), der Computer gar 17 Jahre (1976 bis 1993).
Verbreitung von TV schneller als Computer
Für Deutschland ist es zwar schwieriger, vergleichbare Zahlen zu finden. Aber jene, die es gibt, legen einen vergleichbaren Schluss nahe. Das Statistische Bundesamt führt seit 1962 eine Einkommens- und Verbrauchsstichprobe, in der auch die Ausstattung deutscher Haushalte mit Unterhaltungselektronik enthalten ist. Besonders auffällig ist der Vergleich zwischen Fernseher und Computer. TV-Geräte verbreiteten sich deutlich schneller als Computer (siehe Grafik). Ähnliches gilt für Privatautos, das Telefon oder die Waschmaschine. Schneller als frühere Technik verbreitete sich nur das Mobiltelefon. Ein Beispiel aber beweist noch keinen grundlegenden Trend.
Hinzu kommt der fast schon ernüchternd geringe Wandlungsdruck aus Start-ups. Sogar im Gründerland USA hat sich der Anteil der Firmen, die jünger als ein Jahr sind, von 1978 bis 2011 fast halbiert. Wer Erfolg hat, wird oft von den Großen aufgekauft und integriert. "Es ist zunehmend vorteilhaft geworden, ein etablierter Anbieter zu sein, und weniger vorteilhaft, als Neueinsteiger zu agieren", schreiben die Ökonomen Ian Hathaway und Robert Litan in einer Studie der Brookings Institution.
Gründungsraten rückläufig
Ähnliches legen Untersuchungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung DIW nahe. Sowohl Gründungsraten als auch Insolvenzen von Unternehmen seien derzeit tendenziell rückläufig. "Alle Indikatoren zum Strukturwandel weisen auf eine normale Situation hin", sagt Wirtschaftsprofessor Martin Gornig gegenüber Technology Review.
Auch im Dax, dem Aktienindex der 30 größten und umsatzstärksten deutschen Unternehmen, zeigt sich vor allem eins: zähe Konstanz. Seit der ersten Zusammenstellung im Dezember 1987 wurde im Schnitt pro Jahr etwa ein Unternehmen ausgetauscht. Zwischen 2012 und 2015 blieb die Zusammensetzung sogar konstant. 2016 gab es einen Wechsel. Und im technikorientierten TecDax, in dem die 30 größten und umsatzstärksten deutschen Technologiewerte vertreten sind? Dort fallen im Schnitt immerhin zwei bis drei Unternehmen pro Jahr heraus. Wer aber genauer hinsieht, erkennt, dass sich oft kaum mehr als die Namen der beteiligten Unternehmen ändern.
"In der Regel kommt die Entwicklung nicht mit Lichtgeschwindigkeit", sagt Kai Goerlich, Chief Futurist des Softwarekonzerns SAP. "Ich als Biologe setze eher auf das Prinzip Evolution." Viele vermeintliche Umwälzungen seien entweder "technisch nicht wirklich verblüffend" – oder meist das Ergebnis einer langen Entwicklung. Man denke nur an den Übergang von der SMS zu WhatsApp. Die Kommunikationsfunktion sei die gleiche geblieben. "Wenn das als Revolution gesehen wird, ist das gutes Marketing von WhatsApp." (jle)