Dr. Data – was Künstliche Intelligenz in der Medizin kann
Sind Computer – etwa bei Krebsdiagnosen – schon klüger als ein Fachärzteteam? Mediziner bezweifeln das und nutzen Rechner bislang meist nur als Assistenten.
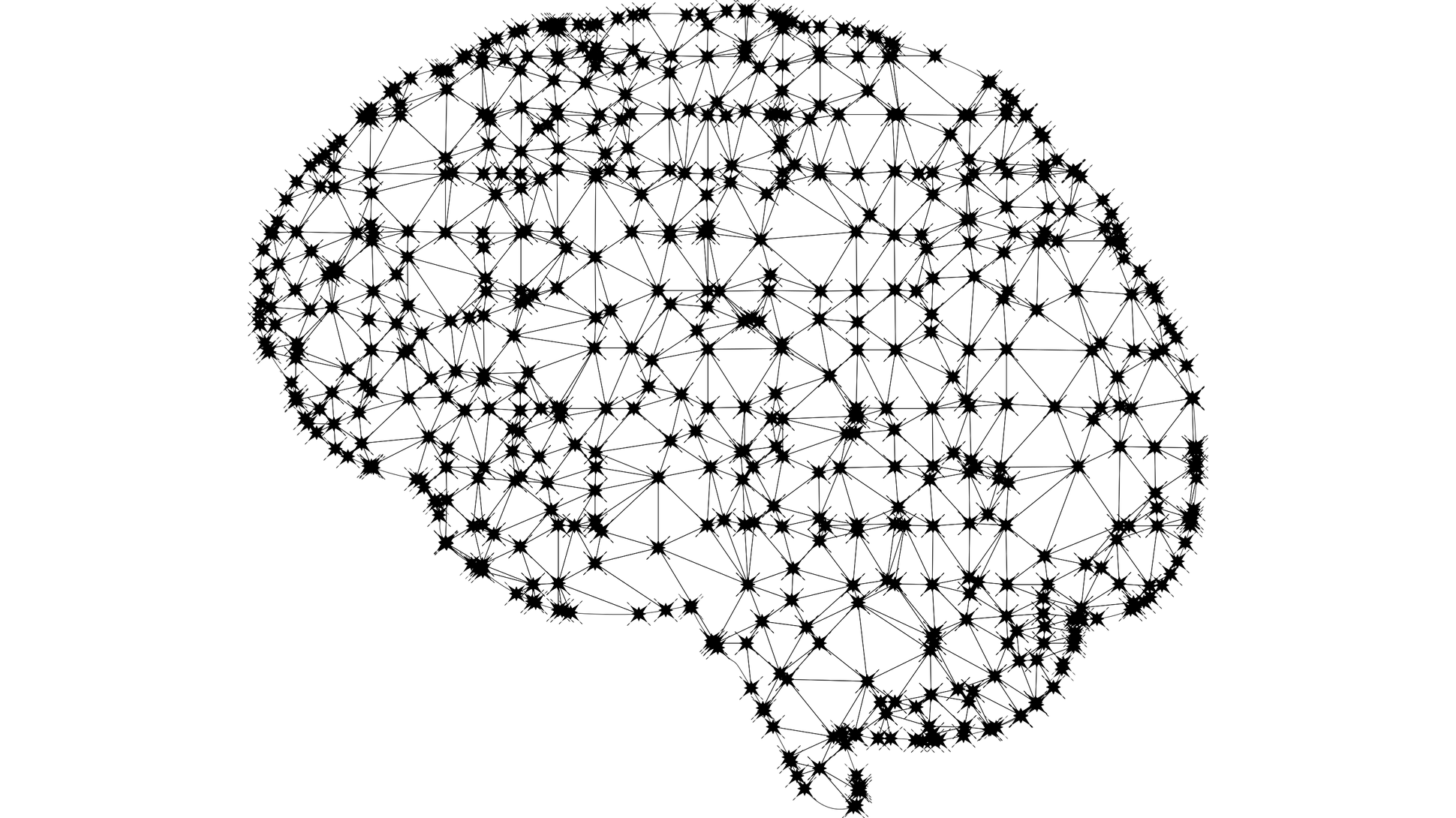
(Bild: Pixabay)
Dr. Data in die Notaufnahme: Für Dietmar Frey ist das keine Science-Fiction. Der Neurochirurg an der Berliner Charité und sein Team aus Ärzten und IT-Experten tüfteln an Rechnern mit Künstlicher Intelligenz, die einer Behandlung von Patienten mit akutem Schlaganfall zugute kommen soll. "Das ist mehr als eine Idee. Wir haben die Technik, einen Prototypen und erste Machine-Learning-Modelle", sagt Frey. Das Forschungsprojekt hat im Mai begonnen und läuft über mehrere Jahre. Frey ist jetzt schon überzeugt: "Wir können individueller therapieren." Wenn 2019 das Wissenschaftsjahr mit dem Schwerpunkt Künstliche Intelligenz beginnt, wird es in der Medizin um Fragen gehen wie: Was können Computer – und wo bleiben Ärzte unersetzlich?
Gegen die Regel
Rund 270.000 Bundesbürger trifft jedes Jahr "der Schlag". Dann rennt die Zeit. Wird das Gehirn nicht ausreichend mit Blut und Sauerstoff versorgt, stirbt Gewebe ab. Die Folgen können dramatisch sein, Sprachausfälle und Lähmungen drohen. Ärztliche Leitlinien in Deutschland besagen, dass das betroffene Hirngewebe nach viereinhalb Stunden tot ist und Nebenwirkungen einer Therapie noch mehr Schaden anrichten können – Blutungen im Kopf zum Beispiel. Deshalb werde nach viereinhalb Stunden heute routinemäßig nicht mehr therapiert, sagt Frey. "Das mag statistisch korrekt sein, für den individuellen Patienten ist das jedoch nicht immer die richtige Therapie."
Für Frey ist ein Patient mehr als eine statistische Größe. Er vermutet, dass Therapien in bestimmten Fällen auch nach viereinhalb Stunden noch sinnvoll sind – und in anderen vielleicht schon nach zwei Stunden nicht mehr. Aber wie weiß man, für wen was gilt? Für Frey ist die Antwort klar: Eine Maschine könnte in Minutenschnelle tausende Vergleichsdatensätze zu Schlaganfällen durchsuchen. Sie abgleichen und Muster aufzeigen, die einem Arzt in der Rettungsstelle bei der Entscheidung helfen könnten. Ein Job für Dr. Data.
Das ist ein Spitzname für Rechner, die in der Medizin mit Künstlicher Intelligenz (KI) arbeiten. Der Doktortitel ist dabei wohl zu hoch gegriffen: Rechner könnten und sollten im Moment keine Ärzte ersetzen, sondern sie als Assistenten in ganz unterschiedlichen Bereichen unterstützen, sagt Felix Nensa, Radiologe und Informatiker an der Uniklinik Essen. Vor allem dort, wo der Mensch eine Fehlbesetzung sei: bei langweiligen und ermüdenden Tätigkeiten wie der Tumorvermessung oder auch beim Speichern und Scannen tausender Bild- und Textdateien.
Variabilität abbilden
KI meint – noch – nicht, dass Computer wie "Hal 9000" in "2001: Odyssee im Weltraum" nach Herrschaft streben und Menschen überflüssig machen. KI steht für Datenbanken und Rechner, die trainiert werden, nach programmierten Mustern zu fahnden.
Sinnvolles Programmieren ist eine Kunst, auch in der Medizin. "Man braucht ausreichend große Trainingsdaten-Sets und muss Variabilität abbilden können", sagt der Bioinformatiker Benedikt Brors am Deutschen Krebsforschungszentrum (DKFZ) in Heidelberg. Sei ein Datensatz zu klein, könne der Rechner zum Beispiel Muster bei sehr seltenen Tumorerkrankungen nicht erkennen – zu wenig Input.
"Ganz vereinfacht ist es so, dass ein Computer erkennt: Auf diesem Bild ist eine Katze. Und auf jenem ist ein Hund." Lege man ihm ein neues Bild vor, ordne er Katze und Hund richtig zu. Das System könne aber prinzipiell nur das lernen, was man ihm vorsetze. "Mit einem Bild von einem Pferd kann es nichts anfangen." Doch im besten Fall lernten die Programme mit jedem neuen Input dazu und steigerten so ihre Leistungsfähigkeit.
Das DKFZ entwickelt seit zehn Jahren ein KI-System, das anzeigen soll, ob Neuroblastome – sehr seltene Tumore bei Kindern – aggressiv sind oder eher harmlos. Davon hängt die Therapie ab. Doch es wird noch dauern mit der klinischen Erprobung. Die Anforderungen für eine Zertifizierung seien extrem hoch, sagt Brors. "Normalerweise würde man sich eine Firma dafür suchen. Aber mit rund 120 Neuerkrankungen in Deutschland pro Jahr ist der Markt zu klein." Das lohne sich nicht für ein Unternehmen. "Also müssen wir das selbst machen."