Missing Link: Wer bändigt die Künstliche Intelligenz?
Mit Spannung wird der Rahmen der EU-Kommission für menschliche und ethische KI erwartet: gelingt ein Wurf wie die DSGVO? Forscher sind für harte Regulierung.
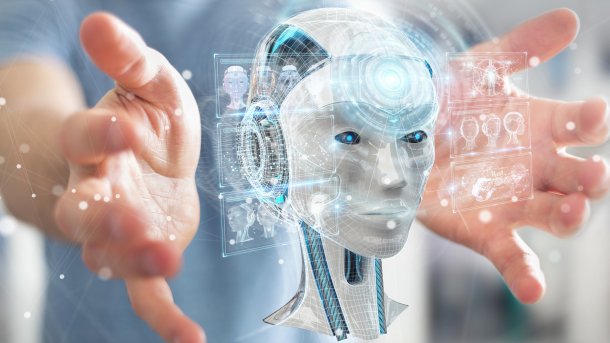
(Bild: sdecoret/Shutterstock.com)
"Daten können Leben retten." Mit dieser Ansage warb Roland Eils, Gründungsdirektor des Zentrums "Digitale Gesundheit" am Berliner Institut für Gesundheitsforschung, am Donnerstag bei einer PR-nahen Veranstaltung des Bundespresseamts für eine bessere Verfügbarkeit forschungsrelevanter Patienteninformationen. Eine solche sei nötig, um Konzepte der Künstlichen Intelligenz (KI) im Gesundheitswesen im großen Maßstab nutzen zu können. Wichtig seien daher etwa bundeseinheitliche Vorgaben für die Datenspende von Patienten.
Therapieempfehlungen vom Computer
Gerade die datengetriebene Genomsequenzierung bringe mittlerweile deutliche Vorteile in der klinischen Versorgung mit sich, begründete der einstige Leiter des Bereichs "Bioinformatik und funktionelle Genomik" an der Universität Heidelberg sein Plädoyer. Bei einem dortigen Projekt mit 1800 schwer Krebskranken habe mithilfe der Genomentschlüsselung am Ende der Computer Therapien empfohlen, was "wunderbar funktioniert" habe. Für 80 Prozent der Teilnehmer habe das eingesetzte KI-System Ratschläge ausgesprochen, die die Ärzte zumindest in einem Drittel der Fälle umgesetzt hätten. Knapp die Hälfte der Palliativ-Patienten habe auf die so erfolgte Behandlung positiv angesprochen.
Zugleich verwies Eils auf Erfolge der "automatisierten Unterstützung" von Medizinern bei bildgebenden Verfahren gerade im Bereich der Radiologie und goss damit Wasser auf die Mühlen von Andreas Lemke, Gründer des Berliner Startups Mediaire, das an Assistenzsystemen zur Analyse medizinischer Bilddaten in der Strahlenheilkunde arbeitet. "Ein Radiologe hat nur drei Sekunden Zeit für eine Diagnose", erläuterte der Physiker. Hier könne die KI ansetzen, und dem menschlichen Experten "einfache Aufgaben" bei der Erkennung etwa von Anzeichen für Alzheimer oder Multipler Sklerose abnehmen.
Vom Radiologen bekommt der Bestrahlte in der Regel eine CD mit Bildmaterial. Solche Formate sollten Patienten schon jetzt Forschern verfügbar machen, wünschte sich Lemke. Zudem gebe es in diesem Medizinsektor bereits einen recht großen Pool an wissenschaftlichen Daten, die "fast schon zu gut sind für die Wald- und Wiesenradiologie". Um eine Generalisierbarkeit herzustellen, könne es aber "gar nicht genug Daten geben", solange diese qualitativ hochwertig seien.
Bessere Diagnose-Systeme fördern auch unnötige Behandlungen
Doch bei so manchen Erfolgsmeldungen aus diesem Bereich ist Vorsicht geboten. Anfang des Jahres sorgten Forscher aus den USA und Großbritannien mit einer Studie für Schlagzeilen, wonach Googles KI DeepMind Brustkrebs besser erkennen könne als Radiologen. Bis zu 9,4 Prozent habe die Fehlerrate bei der Auswertung von Mammografien niedriger gelegen.
Der Berliner Psychologe Gerd Gigerenzer und sein Team von der "Unstatistik des Monats" verweisen dagegen darauf, dass in Großbritannien das KI-System im Durchschnitt nur etwas besser als der erste Radiologe und leicht schlechter als der zweite und das Konsensus-Urteil gewesen sei. Die Autoren der Studie hätten selbst klargestellt, dass die Ergebnisse generell bei spezialisierten Radiologen wahrscheinlich besser ausgefallen wären.
Die "Unstatistiker" geben zu bedenken: "Je besser die Diagnose-Systeme werden, desto mehr kleine und klinisch irrelevante Krebsformen werden entdeckt, die nur technisch gesehen Krebs sind." Da man zum Zeitpunkt der Früherkennung diese harmlosen Formen von anderen nicht unterscheiden könne, erhielten bereits heute viele verunsicherte Patientinnen unnötige Operationen und Strahlen- oder Chemotherapien. Die Gesamtzahl der Frauen, die an Krebs sterben, ändere sich durch Screenings nicht.