Chinas Tech-Crackdown: Von der EU inspiriert, aber drastischer im Durchgriff
Die Rechtswissenschaftlerin Angela Huyue Zhang erklärt das Vorgehen Pekings im "Guerilla-Stil" gegen Alibaba, Tencent & Co. mit dem Streben nach Ausgleich.
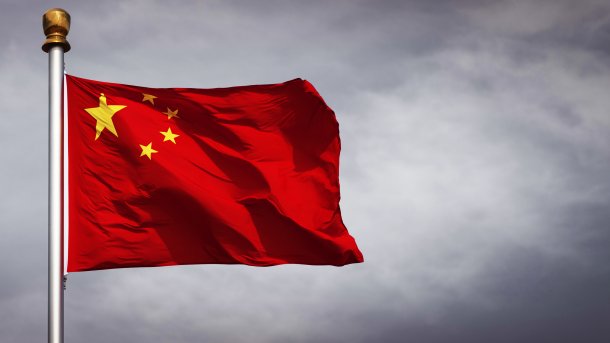
(Bild: rongyiquan/Shutterstock.com)
Das energische Vorgehen der chinesischen politischen Führung und Regulierungsbehörden gegen ausländische und vor allem nationale Technologie-Konzerne wie Alibaba, Tencent und den Fahrdienst-Vermittler Didi mag westlichen Beobachter schwer verständlich erscheinen. Für Angela Huyue Zhang, Leiterin des Zentrums für chinesisches Recht an der Universität Hongkong, leitet es sich aber prinzipiell direkt aus den drei hauptsächlichen Prinzipien und Zielen der kommunistischen Staatslenker ab.
"Reichtum, Stabilität und Nationalismus"
Peking wolle vor allem "das Wirtschaftswachstum und den Reichtum für die einzelnen Bürger, die gesellschaftliche Stabilität und den Nationalismus fördern", erklärte Zhang am Freitag zugeschaltet auf der Konferenz des Kölner Instituts für Medien- und Kommunikationspolitik zur "neuen politischen Ökonomie der Information" in Straßburg. Dabei gehe es insgesamt auch darum, die Legitimität der Staatsspitze zu erhalten. Diese müsse diese Ziele "unter einen Hut" und in ein Gleichgewicht bringen, "um am Ruder zu bleiben".
Wenn es der Wirtschaft nicht gut gehe, verletze dies nicht nur die Interessen der Reichen, sondern aller Bürger, verdeutlichte die Rechtswissenschaftlerin. Das exponentielle und damit zu schnelle Wachstum der Digital-Giganten habe zu Problemen etwa mit dem Finanzsystem geführt. Die Plattformen hätten die Wirtschaft effizienter gemacht, etwa mit Lösungen fürs mobile Bezahlen, wie sie Tencent mit WeChat und Alibaba mit Alipay anbieten. Sie wollten letztlich jedoch möglichst viel Profit machen. Diese Logik habe etwa Monopole begünstigt und Marktversagen verursacht; die Nutzerbeschwerden hätten sich gehäuft.
Videos by heise
Strafen der Behörden wirkungslos
Die chinesischen Regulierer, die als Ausführungs- und Durchsetzungsorgane der Regierung fungierten, neigen laut Zhang eigentlich dazu, ihre Hände in den Schoß zu legen und nicht über den Tellerrand zu blicken. Gleichzeitig seien sie darauf bedacht, die eigenen Karrieren zu sichern und die Politik ein wenig zu kontrollieren. Das ganze System sei "sehr hierarchisch" organisiert.
Jahrelang habe Peking die Plattformen ermutigt, unternehmerische Entscheidungen zu treffen, führte die Juristin aus. Dabei habe die Maßgabe eine entscheidende Rolle gespielt, den Fokus von der Industrieproduktion auf mehr Dienstleistungen zu legen. "Die Regulierer mussten vorsichtig sein", weiß Zhang. Zudem sei das Kartellrecht weitgehend zahnlos, Strafen fielen ziemlich niedrig aus. Selbst als einige Konzerne die "kritische Masse" erreicht hätten, seien Nadelstiche der Behörden wirkungslos geblieben.
Regulierung von Big Tech
Den Umschwung brachte eine Rede des Alibaba-Gründers Jack Ma im vorigen Herbst, in der Chinas reichster Mann den Finanzsektor des Reichs der Mitte als rückständig abtat und die Aufsicht angriff. Diese beschloss der Expertin zufolge daraufhin, "sich dies nicht gefallen zu lassen". Staats- und Parteichef Xi Jinping sei nach Berichten informiert worden und habe persönlich den Börsengang der Alibaba-Finanztochter Ant Group untersagt.
Die politische Leitungsebene habe daraufhin mehr oder weniger über Nacht eine Kampagne gestartet, "um Big Tech besser zu regulieren", berichtete Zhang. Bei dem seither erfolgenden Crackdown kämen nicht nur Kartellfragen auf den Tisch, sondern etwa auch das Arbeitsrecht. So sollten die Angestellten der Konzerne besser gestellt und zugleich die Unterstützung der Nutzer sichergestellt werden. Politische Führungskräfte würden nun sogar in die Firmen eingeschleust.
Grundrechte im Zeitalter von KI und großer digitaler Plattformen
Eine Quelle der Inspiration dabei war laut der Forscherin auch der "Übergang zu einem Interventionsmodell" gegenüber den US-Internetgrößen in Europa: "Wenn die EU agiert, ist das ein Grund für Peking nachzuziehen." In China werde der alte Kontinent als "Supermacht im Bereich der Regulierung" und als Vorbild gesehen. Die chinesischen Kartellvorschriften bauten so auf dem europäischen Wettbewerbsrecht auf, das neue Datenschutzgesetz sei eng an die Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) angelehnt. Peking reagiere bei Bedarf aber oft im "Guerilla-Stil" und so schneller und drastischer als westliche Länder.
Paul Nemitz, Chefberater der EU-Kommission für Recht und Verbraucherschutz, plädierte für die demokratische Gesetzgebung, um die Imperien von Google, Apple, Microsoft, Amazon, Facebook & Co. einzuhegen. Dieser Ansatz könne am ehesten sicherstellen, dass alle von verbindlichen Regeln profitierten. Es gelte, die Grundrechte im Zeitalter von Künstlicher Intelligenz (KI) und großer digitaler Plattformen insbesondere aus den USA und China zu erhalten. Zugleich sei die freie Presse zur Kontrolle staatlicher und privatwirtschaftlicher Machthaber entscheidend.
Medienplattformen
Mit dem Aufstieg sozialer Netzwerke wie Facebook und Twitter haben sich "Populismus und antidemokratische Propaganda" verstärkt, rügte Nemitz. Die Betreiber trügen einen Teil der Verantwortung für den Sturm auf das Kapitol und den versuchten Angriff auf den Reichstag. Die Internetkonzerne hätten zudem die meisten Daten über die Nutzer. Dies gebe ihnen letztlich sogar die Macht, deren Gehirne zu beeinflussen.
Technologische Akteure "werden im Kern Medienplattformen", arbeitete der Kommissionsvertreter heraus. Sie müssten daher den einschlägigen Wettbewerbsbedingungen unterliegen, wofür in Europa künftig der Digital Markets Act (DMA) mit seinen Eingriffsbefugnissen schon vor einem Rechtsverstoß sorgen solle. Derzeit gebe es noch kein Instrument, um etwa den Kauf von Axel Springer durch Facebook zu verhindern, womit die US-Plattform ein dominierender Inhalteproduzent in Europa würde. Der parallel verhandelte Digital Services Act (DSA) sei wichtig, "um den öffentlichen Diskurs angstfrei zu halten".
"Es darf kein Eigentum an Daten geben"
Google und Facebook warf Nemitz vor, verhindern zu wollen, "dass die demokratisch gemachten Regeln greifen". Er spielte damit auf die finanzielle Unterstützung von Medienhäusern durch beide Unternehmen für Content-Kooperationen an. Auf Basis des neuen Leistungsschutzrechts für Presseverleger im Internet, das Teil des Urheberrechtspakets der EU ist, sei dagegen "noch kein Pfennig" an die Berechtigten in Deutschland geflossen. Wichtig seien daher auch die Strukturen, "um unser Recht durchzusetzen".
Als wichtiges Instrument gegen den Informationskolonialismus begrüßte Viktor Mayer-Schönberger, Professor für Internetregulierung an der Oxford-Universität, den Vorschlag der EU-Kommission zum Teilen insbesondere nicht-personenbezogener Daten. "Es darf kein Eigentum an Daten geben", betonte er. Sonst könnte sich auch jemand anmaßen, die Luft zu besitzen. Nötig sei ein dezentraler Ansatz, bei dem Startups einfach Zugangsanfragen an Konzerne senden könnten.
Frieden und politische Einheit in kultureller Vielheit
Die laufende Marktkonzentration in der Netzwirtschaft bezeichnete der Wissenschaftler als gefährlich für Innovation und Wettbewerb in einer Zeit, in der technologische Neuheiten im Kampf etwa gegen die Pandemie, das Bevölkerungswachstum und die globale Erwärmung dringlich gebraucht würden. Auch im Silicon Valley gingen immer weniger Startups an die Börse, deutlich mehr würden von großen Plattformen aufgekauft.
Wolfgang Blau vom Reuters-Institut in Oxford bemängelte, dass die EU es nicht schaffe, ihre Erfolgsgeschichten wie Jahre von Frieden und politischer Einheit in kultureller Vielheit nach außen zu transportieren. Dies liege auch an der begrenzten Reichweite der Medien in den Mitgliedsstaaten. Viel stärker seien hier britische Medien wie die BBC, der "Economist", die "Financial Times", der "Guardian" oder die Boulevard-Zeitung "Daily Mail", die weiter den Brexit-Mythos nähre. Wichtig seien daher Allianzen großer europäischer Medienmarken und auch englischsprachige Veröffentlichungen investigativer Geschichten. Die EU sollte "stark in die maschinelle Übersetzung investieren", da es dafür bald einen Massenmarkt geben werde.
(bme)