Das Erdbeben in Taiwan lässt die Weltwirtschaft erzittern
Weltweit sind Firmen von Chips aus Taiwan abhängig. Daran ändert sich trotz enormer Risiken wenig, wie Christof Windeck analysiert.
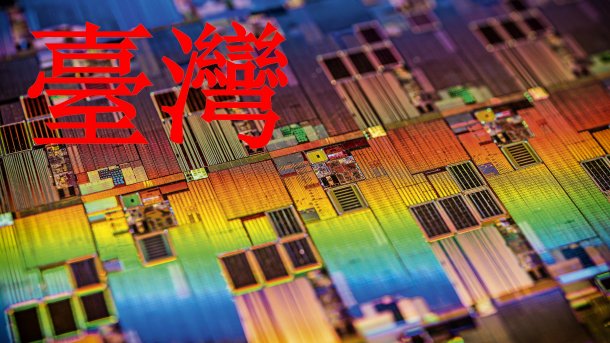
(Bild: c’t Magazin)
Die Weltwirtschaft ist stark von Halbleiterchips aus Taiwan abhängig. Das dortige Erdbeben am 3. April führte diese riskante Situation wieder einmal deutlich vor Augen. Dennoch ändert sich wenig, obwohl die Unwägbarkeiten wachsen – nicht nur wegen der Drohungen Chinas, sich Taiwan einzuverleiben.
Das Erdbeben in Taiwan am 3. April kostete mindestens neun Menschen das Leben und verletzte wohl über Tausend. Außerdem weckte es bei vielen Firmen rund um den Globus Befürchtungen, dass Lieferungen wichtiger Halbleiterchips ausbleiben oder viel teurer werden können. Denn taiwanische Firmen produzieren einen erheblichen Teil sämtlicher weltweit verkauften Chips.
Ein sehr schweres Erdbeben in Taiwan könnte daher die Weltwirtschaft hart treffen; einen Vorgeschmack darauf gab vor drei Jahren der lange anhaltende Chipmangel, der eine indirekte Folge der Coronapandemie war.
In Bezug auf das Erdbeben vom 3.4.2024 gaben die taiwanischen Chipfertiger schon Entwarnung: Die Schäden halten sich in Grenzen.
Doch extremere Folgen für die Chip-Lieferkette hätte ein Angriff von China auf Taiwan. Experten von Bloomberg schätzen den dadurch möglichen Schaden auf bis zu 10 Billionen Euro, nämlich rund 10 Prozent des Bruttoweltprodukts.
Videos by heise
Eine solche Krise würde vermutlich in Europa schlagartig Massenarbeitslosigkeit und viele andere schwerwiegende Folgen nach sich ziehen. Nicht nur brächen die Lieferketten zusammen, sondern auch die Exporte nach China und Taiwan. Die deutschen Autohersteller verkaufen mehr als ein Drittel ihrer neuen Fahrzeuge in China.
Trotz dieser Bedrohung sinkt die Abhängigkeit von taiwanischen Chipfirmen bisher nicht erkennbar. Und es gibt noch weitere Risiken.
Chip-Dominanz in Taiwan & Korea
In Taiwan sitzt mit TSMC (Taiwan Semiconductor Manufacturing Company) der mit riesigem Abstand marktführende Auftragsfertiger für Halbleiterbauelemente. TSMC ist der wichtigste Zulieferer für US-amerikanische Chip-Weltmarktführer wie Nvidia, AMD, Qualcomm und Broadcom, aber auch Apple. Auch Intel bestellt dort viele Chiplets. Mit UMC sitzt noch ein weiterer großer Chip-Auftragsfertiger (Foundry) in Taiwan, zudem gibt es mehrere Fabs für DRAM-Speicherchips.
(Bild: TSMC)
Die zweite führende asiatische Chip-Nation ist Südkorea, vor allem wegen Samsung Semiconductor / Foundry und SK Hynix. Samsung ist die weltweit zweitgrößte Chip-Foundry und zugleich Marktführer bei DRAM- und NAND-Flash-Speicherchips, SK Hynix ist bei Speicherchips die Nummer zwei vor Micron aus den USA.
Die Chip-Dominanz von Taiwan und Korea ist kein Zufall, sondern Ergebnis jahrzehntelanger staatlicher Förderung, auch mit hohen Subventionen.
Zumindest in Taiwan hat der Chip-Fokus ausdrücklich auch das Ziel, die USA und andere westliche Nationen als Schutzmächte an das Land zu binden. Denn Taiwans gigantischer Nachbar China sieht den Inselstaat als abtrünnigen Teil seiner selbst und droht immer wieder mit der Invasion. Südkorea wiederum hat den bedrohlichen Nachbarn Nordkorea. Wegen der Bedeutung der Chips für den Weltmarkt, aber auch wegen der geopolitischen Lage der beiden Länder haben die USA ein starkes Interesse, sie zu schützen.
(Bild: Gartner, c’t Magazin)
China selbst spielt als Zulieferer von Chips für den Weltmarkt vom Umsatz her keine große Rolle. Es gibt dort zwar erhebliche Fertigungskapazitäten, aber die bedienen vor allem den lokalen Markt. Trotzdem ist Elektronik aus China essenziell für die Welt: Von dort kommt ein großer Teil der billigeren, einfacheren Bauelemente, etwa simple Widerstände, Kondensatoren und Mikrocontroller. Auch Knappheit bei diesen Bauteilen stört die Lieferkette, wie sich schon mehrmals zeigte. Und China setzt seine Marktdominanz strategisch ein, auch das ist kein Hirngespinst.
Schwache EU-Anstrengungen
Die plötzliche Knappheit an Chips 2021 beschleunigte die trägen EU-Prozesse. Denn sie machte einer breiten Öffentlichkeit (wieder einmal) klar, was Fachleute seit Jahrzehnten wissen: Die Chip-Lieferketten sind fragil, obwohl Chips für viele Wirtschaftsbranchen unverzichtbar sind.
"Nearshoring" ist eine angedachte Lösungsmöglichkeit, also mehr lokale Fertigung von Halbleiterbauelementen. Dabei ist Europa in den vergangenen Jahren immer weiter abgerutscht. Es gibt in der EU zwar zahlreiche Chip-Werke (Fabs) sowie mit STMicroelectronics einen der zehn umsatzstärksten Chipfirmen der Welt. Infineon gehört zu den 20 weltweit größten, zudem sitzen hier etwa noch Bosch, NXP, Auftragsfertiger wie Globalfoundries, Intel und X-Fab sowie wichtige Zulieferer wie ASML. Doch der Umsatzanteil der Chipfertigung in Europa liegt unter 10 Prozent des Weltmarkts.
Sehr schnell erschollen 2021 Reden, laut denen die Chipfertigung in Europa durch Subventionen wachsen sollte. Die Umsetzung zog sich dann aber noch zwei lange Jahre hin, erst 2023 wurde der European Chips Act nach dem Vorbild des US Chips Act verabschiedet. Und die EU lobt nur einen Bruchteil der Subventionen aus, die die USA herausfeuern. Das ist kein guter Start, wenn man genau weiß, dass es um ein Wettrüsten der Subventionen geht.
(Bild: c’t Magazin/Christof Windeck)
EU-Binnenmarktkommissar Thierry Breton will den Umsatzanteil der europäischen Chipfertigung bis 2030 auf 20 Prozent des Weltmarkts hochtreiben. Dafür braucht es Abermilliarden an Investitionen, weil auch Taiwan und Korea die Fertigung weiter ausbauen. Über die nächsten zehn Jahre wollen die dort ansässigen Chip-Giganten insgesamt mehr als 500 Milliarden US-Dollar investieren. In den USA geht man von rund 200 Milliarden aus. Daneben sehen die 43 in der EU erhofften Milliarden winzig aus.
Die Fabs für die Chips mit den feinsten Strukturen – zurzeit werden Bauelemente der 3-Nanometer-Klasse produziert – sind die jeweils teuersten, Intel plant für zwei Fabs in Magdeburg mit über 30 Milliarden Euro. Mit diesen Chips lässt sich aber auch pro Wafer am meisten verdienen.
Breton plädiert dafür, dass auch modernste Chips in der EU produziert werden – obwohl bisher nur wenige Firmen in der EU solche Chips entwickeln und in ihre Produkte einbauen. Breton geht es darum, mit anderen starken Chip-Nationen auf Augenhöhe verhandeln zu können.
Trotzdem steckt die EU in dieses Projekt nur wenige "frische" Milliarden, sondern widmet im Wesentlichen Mittel um und erlaubt vor allem den einzelnen Mitgliedsstaaten höhere nationale Förderquoten.
Zusatzrisiko Trump
(Bild: Weißes Haus)
Schon vor 2021 hatte die EU Anstrengungen verstärkt, die hiesige Chip-Branche zu stärken – und zwar vor allem unter dem Eindruck der US-Regierung von Donald Trump. Denn der zog nicht nur gegen China in einen Handelskrieg, sondern auch gegen Europa, getreu seinem Motto "America First!".
Die Angst davor, dass die US-Regierung den Export von Chips für europäische Supercomputer und Autohersteller beschränken könnte, war etwa eine wesentliche Triebfeder für die European Processor Initiative (EPI). Mit dem Brexit brach der EU auch der lokale CPU-Champion ARM mit Sitz in Cambridge weg, daher setzte man zusätzlich aufs RISC-V-Pferd als alternativen CPU-Befehlssatz.
Als Atommacht ist Frankreich besonders stark an möglichst hoher Autonomie bei Supercomputern interessiert – keine Kernwaffen ohne Simulation. Digitale Souveränität bedeutet in diesem Zusammenhang, Hardware fürs High-Performance Computing (HPC) im eigenen Land oder Bündnis fertigen zu können.
Dazu kommt, dass Frankreich den USA und auch den dortigen IT-Konzernen deutlich kritischer gegenübersteht als etwa Deutschland und andere EU-Länder. Der französische Staatspräsident Emmanuel Macron plädiert häufig für eine stärkere EU, etwa auch bei der Rüstung.
(Bild: EPI)
Der Franzose Thierry Breton war einst Firmenchef sowohl von Bull als auch Atos, die traditionell Supercomputer fürs französische Militär liefern. Breton dürfte den Halbleitermarkt sehr viel besser kennen als das Gros der europäischen Politiker. Es ist aber wohl auch kein Zufall, dass das bei EPI führende Unternehmen SiPearl in Frankreich sitzt (aber etwa auch eine deutsche Niederlassung hat).
Eine zweite Trump-Regierung in den USA verheißt für Europa wenig Gutes. Auch bei Halbleitern könnte Trump argumentieren, dass die Europäer dafür zu wenig investieren, oder sie als Druckmittel in Handelskriegen einsetzen.
Vorbild dafür sind die Exportbeschränkungen nach China, die bisher mit anderen Argumenten begründet werden: Die militärische Macht Chinas soll nicht auch noch durch westliche Halbleiter weiter anschwellen. Aber bei den Sanktionen sind militärische und wirtschaftliche Aspekte nicht immer scharf zu trennen – China ist eben auch wirtschaftliche Weltmacht und Konkurrent.
Keine Souveränität absehbar
(Bild: dpa, Etienne Ansotte/European Commission/dpa)
Beim Drängen auf mehr europäische Chiptechnik hat Thierry Breton die EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen wohl an seiner Seite. Schließlich pumpt Deutschland besonders viele Subventionen in Chiptechnik, siehe Intel Magdeburg, Infineon Dresden, TSMC/ESMC, Wolfspeed Ensdorf und andere.
Die deutsche Regierung wirbt für diese Subventionen auch mit dem Argument, die Chipbranche erscheine zukunftsfähiger als etwa Braunkohlegruben, Stahlwerke und Verbrennungsmotoren. Zudem braucht die Chipfertigung eher Strom als Gas.
Doch viele sehen die Chip-Subventionen kritisch. Die meisten Gegner argumentieren mit den hohen Kosten für die Steuerzahler und den Risiken, dass Subventionen auf Dauer verpuffen. Beispielsweise plädierte der ehemalige "Wirtschaftsweise" Prof. Dr. Lars P. Feld vor einigen Monaten in der Talkshow von Markus Lanz dafür, Chips im Wesentlichen beim jeweils billigsten Anbieter zu kaufen.
Viele halten die Versorgung der wichtigen hiesigen Industriesparten wie Auto- und Maschinenbau sowie Medizintechnik für ausreichend, weil die erwähnten EU-Chip-Firmen STMicro, Infineon, NXP, Bosch und X-Fab genau dafür wichtige Bauelemente produzieren.
Klar ist zudem: Auch mit sehr viel mehr Geld kann sich die EU keine "Chip-Souveränität" erkaufen, zumindest nicht innerhalb weniger Jahre beziehungsweise Regierungszeiträume.
Dazu sind die Verflechtungen in der Chip-Industrie zu komplex und global verteilt. Eine einzige Fab kann bis zu 15.000 verschiedene Zulieferer haben, die ihrerseits hochspezielle Vorprodukte fertigen.
Daher argumentiert Thierry Breton auch dafür, die EU durch einen höheren Anteil am Chip-Weltmarkt erst einmal in eine bessere Verhandlungsposition zu bringen. Damit sinkt das Drohpotenzial von Konkurrenten.
Politische Entscheidung
Letztlich ist es eine politische Richtungsentscheidung, wie hoch der lokale Anteil an der weltweiten Chipfertigung in der EU sein soll. Die Marktwirtschaft wird das nicht regeln, ganz im Gegenteil beschleunigte der Preisdruck die Abwanderung in Länder wie Korea und Taiwan.
Investitionen in Chiptechnik sind riskant, weil sich die Technik rasant fortentwickelt. Schon nach wenigen Jahren können jeweils andere Verfahren profitabler sein. Davor warnt etwa TSMC-Gründer Morris Chang: Mit hohen Subventionen geförderte Chip-Werke in den USA und der EU könnten relativ rasch unrentabel werden, wenn sie es nicht schaffen, auf Dauer zu konkurrenzfähigen Preisen zu produzieren.
Auch der bekannte "Schweinezyklus" durch den Wechsel von Unter- und Überkapazitäten fordert von den Investoren Weitsicht und Nerven. Der (Wieder-)Aufbau einer konkurrenzfähigen Chip-Industrie ist ein Mammutprojekt, das langen Atem braucht.
Es stellt sich letztlich also die simple Frage, was der EU eine größere Unabhängigkeit von Taiwan bei der Chipfertigung wert ist. Ein Blick auf andere Branchen ernüchtert: Ähnliche Probleme gibt es auch bei anderen wichtigen Gütern wie Arzneimitteln, Munition oder Solarmodulen. Bei vielen dieser Produkte wäre die lokale Herstellung weitaus einfacher zu bewerkstelligen als bei Halbleitern mit feinsten Strukturen. Trotzdem bewegt sich wenig.
(ciw)