BGH-Urteil zum Abgasbetrug: Kein Schadenersatz für Daimler-Thermofenster
Das Thermofenster von Daimler sei nicht sittenwidrig, heißt es im Urteil. Für den Konzern ist die Angelegenheit damit aber nur zu einem kleinen Teil erledigt.

Im konkreten Fall geht es um eine Mercedes C-Klasse der Baureihe 204, die 2012 gebaut wurde. Der Kläger wirft Daimler vor, hier Abschalteinrichtungen eingesetzt zu haben. Die Dieselmotoren erfüllten zu diesem Zeitpunkt die Abgasnorm Euro 5.
(Bild: Daimler)
- Martin Franz
- mit Material der dpa
Fast sechs Jahre nach Bekanntwerden des Abgas-Betrugs von Volkswagen sind die juristischen Folgen für Verbraucher und Industrie noch immer nicht abgeschlossen. Der Bundesgerichtshof hat sich nun mit der Frage beschäftigt, ob ein sogenanntes Thermofenster in einem Mercedes einen Anspruch auf Schadenersatz nach sich ziehen könnte. Dem ist nicht so.
Unterschiede zu Volkswagen-Urteil
Allein wegen des Thermofensters in vielen Mercedes-Dieselmotoren haben klagende Autobesitzer noch keinen Anspruch auf Schadenersatz von Daimler. Selbst wenn es sich dabei um eine unzulässige Abschalteinrichtung handeln sollte, sei der reine Einsatz der Technik nicht sittenwidrig, urteilte der Bundesgerichtshof in Karlsruhe. Denn anders als beim Dieselmotor EA189 von Volkswagen unterscheide die Software nicht danach, ob das Auto auf dem Prüfstand stehe. (Az. VI ZR 128/20)
Nicht sittenwidrig
Der BGH erneut klargemacht, dass "der Einsatz der temperaturabhängigen Steuerung des Emissionskontrollsystems (Thermofenster) für sich genommen nicht ausreicht, um einen Schadensersatzanspruch wegen vorsätzlicher sittenwidriger Schädigung (§ 826 BGB) zu begründen". Zur Sittenwidrigkeit müssen "weitere Umstände hinzutreten, die das Verhalten der handelnden Personen als besonders verwerflich erscheinen lassen", argumentierte der Senat.
Als Thermofenster wird ein Teil der Motorsteuerung bezeichnet, die unterhalb von einer bestimmten Außentemperatur die Abgasnachbehandlung in einen anderen Modus schaltet. Bei einigen Hersteller ist dieser Bereich schon bei weniger als 15 Grad Celsius erreicht. Die Industrie verteidigt Thermofenster. Sie würden dem Schutz von Bauteilen dienen. Die Kläger sehen darin eine unzulässige Abschalteinrichtung – wie bei Volkswagen.
Für Daimler nur ein Teilerfolg
Die Richter am Bundesgerichtshof hatten sich zu der Frage, ob Thermofenster grundsätzlich zulässig sind, vor einem halben Jahr schon einmal in einem schriftlichen Beschluss ähnlich geäußert. Jetzt verkündeten sie zum ersten Mal nach einer Verhandlung ein Urteil. Der konkrete Fall ist damit aber noch nicht abgeschlossen, denn der Kläger hatte Daimler vorgeworfen, etliche weitere unzulässige Vorrichtungen zur Abgasmanipulation zu verwenden, unter anderem über das Kühlmittelsystem. Diesem Vorwurf war das Oberlandesgericht Koblenz nicht nachgegangen. Das muss nun nachgeholt werden.
(Bild: Daimler)
Streit geht weiter
"Unter den Umständen des Einzelfalles rechtsfehlerhaft hat das Berufungsgericht aber den konkreten Sachvortrag des Klägers zu einer der weiteren behaupteten Abschalteinrichtungen als prozessual unbeachtlich angesehen. Aus diesem Grund war die Sache an das Berufungsgericht zurückzuverweisen, damit es die erforderlichen Feststellungen hierzu treffen kann", heißt es im Urteil. Übersetzen kann man das so: Das Thermofenster in den Daimler-Dieselmotoren ist nicht sittenwidrig. Der Vorwurf des Klägers, Daimler verwende weitere Abschalteinrichtungen, ist damit aber nicht vom Tisch, sondern wird vor dem OLG Koblenz weiter verhandelt. Der Autokonzern mag also eine Entscheidung zum Thermofenster erreicht haben, juristisch ist die Sache deswegen aber noch lange nicht erledigt.
Keine Prüfstandserkennung
Der jetzt verhandelte Fall von Daimler unterscheidet sich juristisch von dem Verfahren gegen Volkswagen. Im EA189 wurde eine Software eingesetzt, die einen Prüfstandslauf erkennen konnte. Im Anschluss daran wurde die Abgasnachbehandlung in einen anderen Modus umgeschaltet. Aufgefallen war das, weil sich die Abgaswerte, die im Labor ermittelt wurden, unter keinen Umständen auf der Straße nachvollziehen ließen. Hier liegt für die BGH-Richter der Hauptunterschied zum Daimler-Thermofenster, wie der Senatsvorsitzende Stephan Seiters in der Verhandlung am 29. Juni noch einmal ausgeführt hatte: Dieses arbeite immer gleich, ob auf der Straße oder im Test. Der Einsatz der Technik allein sei aber nicht sittenwidrig, löse also auch keine Schadenersatz-Pflichten aus.
Chronologie des Abgas-Skandals (78 Bilder)
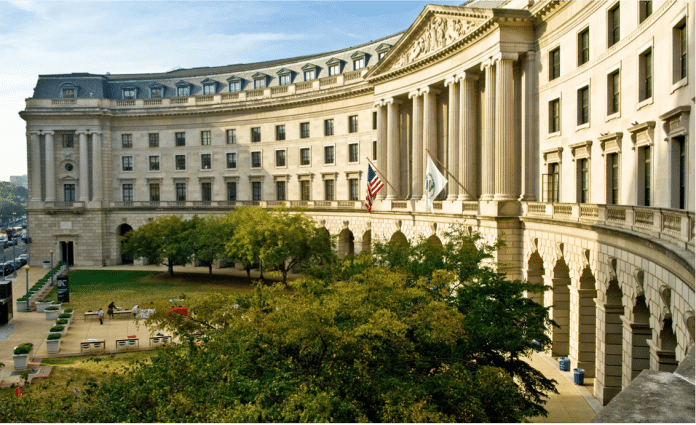
(Bild: EPA
)
Der Kläger will erreichen, dass Daimler das Auto zurücknehmen und ihm – abzüglich einer Nutzungspauschale für die gefahrenen Kilometer – den Kaufpreis erstatten muss. Er hatte seine C-Klasse 2012 für rund 35.000 Euro gekauft. Das Oberlandesgericht (OLG) Koblenz hatte seine Klage zuletzt abgewiesen. In den Vorwürfen des Klägers geht es in erste Linie um eine angebliche Manipulation des Kühlmittelsystems, um die Stickoxid-Werte in Tests auf dem Prüfstand unter das eigentliche Niveau im normalen Straßenverkehr zu drücken.
Musterfeststellungsklage gegen Daimler
Wegen solcher und anderer Vorwürfe bereiten die Verbraucherzentralen gerade eine Musterfeststellungsklage gegen Daimler vor. Sie wollen gerichtlich feststellen lassen, dass Daimler neben dem Thermofenster weitere Vorrichtungen eingesetzt habe, die tatsächlich die Behörden hinters Licht führen sollten. Dabei geht es um deutschlandweit knapp 50.000 Modelle der Baureihen GLC und GLK mit dem Dieselmotor OM 651, für die das Kraftfahrt-Bundesamt Rückrufe angeordnet hatte. Die C-Klasse des Klägers hat zwar auch so einen Motor, gehört aber nicht zu den Fahrzeugen, auf die sich die Musterklage beziehen soll. Sie war auch nicht von einem amtlichen Rückruf betroffen. (Az. VI ZR 128/20)
(mfz)